Also jetzt noch eine Besprechung von Akif Pirinçcis »Deutschland von Sinnen«? Noch ein Text, der die Menschenverachtung dieses Buches hervorhebt, die scheußliche Sprache geißelt? Diese tatsächlich fürchterlichen fast 230 Seiten, auf denen Pirinçci auf die »linksversiffte Presse« schimpft, die »Figuren aus dem Kuriositätenkabinett« (Politiker), »Multikulti-Engel aus dem Rotweingürtel« (die »Kindersex«-Grünen, dieser »komplett überflüssige Verein«), die »sozialpädagogische Witzjustiz« (später leicht variiert zur »deutsche[n] Augenzudrück-Justiz«) und das EU-»Gesindel«. Dieser Rausch des Autors, wenn es um den Islam geht (»gewaltaffine und leistungsfeindliche Ideologie«, die seit Jahrhunderten keine Erfindung mehr zustande gebracht habe [Enzensberger lässt grüßen] und Deutschland unweigerlich in ein schreckliches »Eurabia« stürzen wird), die »Geisteskrankheit namens Gender Mainstream« (nebst »Kampflesben«) und die »Vergottung« der Homosexualität. Also noch ein langweilig-selbstgerechter Gegentext, der sich am Ende in der Gewissheit suhlt, irgendwie doch auf der richtigen (vulgo: der anderen) Seite zu stehen und den Autor à la »heute show« mit ähnlichem Duktus zerrupft wie er dies mit der von ihm so verhassten Gesellschaft, dem journalistische Establishment, praktiziert?
Und wenn man dies vermeiden möchte – was dann? Ist Pirinçci ein Wiederkehrer des taxifahrenden Trevis Bickle, der sich aus lauter Ekel vor dem »Abschaum«, der ihm begegnet in Selbstjustiz flüchtet und dafür urplötzlich in der Öffentlichkeit als Held verehrt wird? Oder nur ein rhetorischer Amokläufer, ein Alfred Tetzlaff reloaded, jener »Ekel Alfred« genannten Figur aus der Anti-Familienserie der 1970er Jahre »Ein Herz und eine Seele«, die inzwischen einen Kultstatus erreicht hat? Wolfgang Menge, der die Idee zu dieser Serie aus Großbritannien übernommen und auf deutsche Verhältnisse angepasst hatte, inszenierte die Folgen wie ein Kammerspiel auf der Bühne vor Publikum. Tetzlaff wurde zur exemplarischen Spießer-Figur, der schon optisch einstimmte: klein, fast immer mit Pantoffeln, meist liederlich im Unterhemd herumsitzend, vor allem jedoch mit seinem speziellen Oberlippenbart und der Frisur durchaus (und gewollt) von Ferne an Adolf Hitler erinnernd. Die Gesinnung Alfreds war schon auf den ersten Blick klar.
Die Handlungen waren eher Nebensache – es ging um Alfreds Monologe, in denen er gegen die sozialliberale Regierung im Allgemeinen und Willy Brandt (später Helmut Schmidt) im Besonderen wetterte – und sich oftmals in seinen Verschwörungstheorien verhedderte und um »Kopf und Kragen« redete. Diese Art der Abbildung aktueller politischer Stammtischparolen im Fernsehen war ungewöhnlich. Die heute sich eher putzig ausnehmenden Beschimpfungen Tetzlaffs, seine vermeintliche Treue zum deutschen Wesen (sich u. a. dahingehend zeigend, dass er aufstand, wenn die Nationalhymne im Fernsehen gespielt wurde), die versteckten wie offenen Anspielungen über Willy Brandts Emigrantenzeit während des Nationalsozialismus (gängiges CDU/CSU-Ressentiment damals), das restaurative Menschen- und Frauenbild (»dusslige Kuh« nannte er seine Frau unter dem Beifall des Publikums mindestens einmal pro Folge) – all diese von Tetzlaff in der Serie vorgebrachten Ressentiments kursierten ja tatsächlich in der Gesellschaft. In der Schule, am Arbeitsplatz, in der Gaststätte – überall wurde politisch diskutiert und dies gelegentlich »ohne Rücksicht auf Verluste«. Freundschaften zerbrachen daran, ob man Brandts Politik akzeptierte oder verwarf. Die Serie knüpfte also an eine virulent vorhandene Stimmung in großen Teilen der Bevölkerung an, allerdings rhetorisch durchaus »entschärft«. Den in den 70ern kursierenden Spruch »Brandt an die Wand« hörte man von Tetzlaff nicht; soviel wäre dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen dann doch nicht zuzumuten gewesen.
Alfreds Reden wurden in der Sendung konterkariert durch den Schwiegersohn und seine Tochter, die sanft, aber auch bestimmt und zuweilen mit schlagfertiger Rhetorik den oft aberwitzigen Geschichtsklitterungen und Verschwörungstheorien entgegenwirkten. Ansonsten baute Menge darauf, dass sich die Figur durch Verhaltensweisen und (zum Teil misslungener) Rhetorik selber lächerlich machte. Menge vertraute darauf, dass der Zuschauer dies bemerkt und ein reinigender Effekt eintritt (allerdings ein leicht anderer als in der Tragödienlehre). 1976 wurde die Serie eingestellt; die politische Polarisierung kühlte sich ab. Menge revitalisierte das Format noch einmal 1993 mit dem West-Berliner »Motzki«, der sich über die Politik der Wiedervereinigung erregte und am liebsten die Mauer wieder errichtet hatte. Den Erfolg von »Ekel Alfred« der 1970er Jahre erreichte diese Serie nicht.
Alfred Tetzlaff und Motzki – die personifizierten Kotzbrocken, politisch reaktionär, boshaft, unbelehrbar, infam. Aber im Grunde harmlos. Diskussionen konnte man mit ihnen nicht führen, weil sie weder Argumenten aufgeschlossen waren, noch welche hatten. Menge gab ihnen eine Stimme – um sie dem Zuschauer zu zeigen, wie er besser nicht werden sollte. Inzwischen hat der radikale politische Vereinfacher, der an der Komplexität der Welt leidende und bisweilen überforderte keine Stimme mehr, die ihn wenigstens für 25 Minuten zeigt, selbst um ihn dann vorzuführen. Die Doku-Soaps im Privatfernsehen sind in diesem Sinne radikal unpolitisch.
Das seriöse Fernsehen hat sich entschieden, gesellschaftliche Zustände weitgehend in Krimis abzuhandeln. Und schließlich fürchtet man sich womöglich vor den Reaktionen; in Zeiten von Shitstorms und sprachlicher Ausgewogenheitsimperative würden die rhetorischen Eruptionen für bare Münze genommen; die ästhetische Bearbeitung würde entweder nicht verstanden oder als zu harmlos wahrgenommen.
»…im Ganzen wird es schon stimmen«
Ist also der seit 40 Jahren in Deutschland lebende Türke Akif Pirinçci Tetzlaffs Nachfolger? Kann dieses Phänomen des kommerziellen Erfolgs dieses Buches auf diese possierliche Rolle reduziert werden? Erstaunlich: Besprochen wurde es in den gängigen Feuilletons durchaus von bekannten Redakteuren; es war bei einigen sogar »Ressortchefsache«. Wobei Besprechungen schwierig sind, denn dieses verquere Zeug entzieht sich jeglicher Kritik, da es oft nur eine Aneinanderreihung von Behauptungen, Schimpfkanonaden, Beleidigungen und Ressentiments sind. Diese Mischung nennt Pirinçci tatsächlich »Argumente«. An anderer Stelle schwafelt er von »Polemik« (in Unkenntnis dessen, was Polemik ist) oder reklamiert für seinen Unflat sogar den Schutz der künstlerischen Freiheit. Während der Lektüre hofft man irgendwann, dass die Schar der Feuilletonisten dieses Buch nicht richtig gelesen hat und irgendwo, vielleicht auf Seite 141 oder 175, ein Kapitelchen mit »Ätsch, ist alles nur ein Scherz« steht. Aber die Hoffnung erfüllt sich nicht. Der Autor meint das alles ernst.
»Sarrazin auf Speed« sei das, lese ich in der FAZ von Harald Staun. Wobei Pirinçci mit Sarrazin und seinem umständlichen Geschreibe nichts anzufangen weiß; sein Ehrgeiz geht einzig dahin, mehr Bücher als Sarrazin zu verkaufen und ihn mit seinen Parolen an Vehemenz zu »überbieten«. Fast stolz sagt er am Ende, dass sein Buch keine Fußnoten habe. Vielleicht seien nicht alle genannten Zahlen korrekt, »aber im Ganzen wird es schon stimmen«. Wo keine Fußnoten, da auch offensichtlich kein Lektorat; in der mir vorliegenden Ausgabe als elektronisches Buch wurde regelmäßig das Substantiv Urteil durchgehend klein geschrieben; andere Substantive ebenfalls.
Um es deutlich zu sagen: Mit Sarrazin hat Pirinçci nichts zu tun. Wo dieser noch – wie auch immer – argumentierte, den Diskurs suchte (um dann beleidigt zu reagieren, wenn man seine Thesen nicht teilte und zerpflückte), da ist jener nichts weiter als jemand, der mit gehöriger Lust in einer Schmähschrift so ziemlich alle beleidigt. Diskurs, Diskussion, die Möglichkeit, dass auch der Andere Recht haben könnte – all dies kommt Pirinçci erst gar nicht in den Sinn.
Man kann sich über Pirinçcis über weite Strecken unerträglich banales und obszönes und auch langweiliges Buch trefflich erregen. Damit hätte der Autor ein Ziel erreicht. So verglich Ijoma Mangold »Deutschland von Sinnen« mit Hitlers »Mein Kampf«. Und Mangold hat vermutlich Recht – einige Passagen dürften den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Aber man sollte jetzt in Gottes Namen nicht diesem Buch noch mehr Leser (und sei es aus Mitleid) zuführen, um dies gerichtlich prüfen zu lassen. Wobei: Die coole Betrachtung von Jan Fleischhauer ist mir dann auch ein bisschen zu sehr distinguiert. Ich kann nicht ganz gleichgültig bleiben, wenn im Restaurant auf meinen Teller gekotzt wird. Und Pirinçci auch nur in eine Reihe »über Heine bis Henscheid« zu stellen – da muss dann Fleischhauer noch ein bisschen Literaturstudium nacharbeiten.
Die Kommentare
Die Frage nach dem Erfolg (der zunächst nur ein Kauferfolg ist) stellt kaum jemand. Wenn, dann wird sie abgetan. Oder in vorauseilender Arroganz wie Richard Gebhardt auf das vermeintlich »braune« publizistische Umfeld hingewiesen, ein bisschen Jünger und Carl Schmitt eingestreut (die beide rein gar nichts mit diesem Buch zu tun haben, aber der Autor hat das sicherlich irgendwo im Phrasenwörterbuch des Journalismus abgeschrieben), der übliche »Populismus«-Vorwurf mal da und mal dort platziert – fertig ist das Textlein. Die Mechanismen sind dabei ähnlich wie bei denen, die man bekämpft: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.
Vieles spricht dafür, dass der potentiellen Käuferschaft dieses Abwatschen nicht mehr genügt. So finden sich unter Mangolds Besprechung mehr als 600 Kommentare. Ein anderer Text auf zeitonline, von Richard Gebhardt, wurde über 450 mal kommentiert. Harald Stauns Beitrag auf faz.net kommt auf 165 Kommentare und Jürgen Kaubes Text 47. Während auf faz.net im Vorfeld Kommentare gefiltert werden, macht dies zeit.online erst nachträglich, entfernt die Aussagen und ersucht um einen anderen Tonfall. Dabei fällt zweierlei auf: Zum einen sind viele Kommentare dem Buch gegenüber positiv eingestellt, obwohl es die wenigsten damals gelesen haben dürften (einige wollten es kaufen). Zum anderen ist die Wortwahl auch der dem Buch gegenüber positiv eingestellten Kommentatoren sehr viel wohltuender als Pirinçcis. Nimmt man einmal an, dass einige der Kommentatoren Fakes sind (es gab ja unverhohlen Aufrufe, das Buch bspw. bei Amazon wohlwollend zu besprechen), so verblüfft doch am Ende durchaus die Tatsache, dass »Deutschland von Sinnen« zwischenzeitlich das meistverkaufte Buch bei Amazon war.
Also schickte die Redaktion der Zeit Stefan Willeke auf eine Reise zu Kommentatoren der Zeit-Artikel. Was gut beginnt, endet schließlich mit der üblichen besserwisserischen Arroganz. Die Kommentarschreiber würden Pirinçcis Buch nicht kennen, mutmaßt er (vermutlich in vielen Fällen durchaus korrekt). Dabei vergisst er jedoch, dass er es war, der die Auswahl getroffen hatte. Fanden sich denn wirklich keine Leute, die das Buch gelesen hatten? Wenn es Willeke schon nicht gelingt, kurzzeitig mit seinen Interviewpartnern Empathie zu empfinden, sollte er doch mindestens versuchen, eine halbwegs neutrale Position einzunehmen. Statt sich auf die besonnenen Stimmen zu konzentrieren, kommen auch wieder die üblichen Wirrköpfe zu Wort, die natürlich sofort die eigene Position bestätigen. 1738 Kilometer hat Willeke am Ende verfahren. Ein Besuch in einer U-Bahn in einer beliebigen deutschen Stadt beispielsweise nach einem sogenannten »Derby« nach einem Fußballspiel hätte so manchen Autobahnkilometer erspart. Sich einfach dazu setzen, zuhören, ein, zwei Fragen stellen.
Ist das eine Kluft zwischen Leser und Journalismus, wie NZZ und Cicero jetzt feststellen? Von »Hochmut nach dem Fall« schreibt Alexander Kissler und verknüpft mit der Entfremdung zwischen Journalisten und Leser das sukzessive Ende der Printmedien. Sogenannte Intellektuelle jubeln, wenn eine Lesung von Sarrazin so stark gestört wird, dass es sinnlos, sie abzuhalten. Sie rühmen sich das erfolgreich praktiziert zu haben, was Sarrazin ihnen vorwirft, aber angeblich gar nicht existiert.
Pirinçci hasst den Staat.
Pirinçci hasst das, was wir Staat nennen. Er verabscheut die gesellschaftlichen und politischen Institutionen. Er, der in der Gesellschaft einen für ihn unerträglichen Schwulenkult entdeckt, ist sogar für die Homo-Ehe, aber nur weil durch das Ehegattensplitting dem Staat beträchtliche Steuer-Mindereinnahmen drohen würden. Steuern sind für ihn ein rotes Tuch. Pirinçci legt dann auch ein »Steuermodell« vor. Es sieht vor, dass jeder nur noch 5 % Steuern zu zahlen habe (ob Einkommensteuer gemeint ist oder auch Verbrauchssteuern inkludiert sind – mit solchen lächerlichen Details beschäftigt sich der Autor nicht). Die Staatsschulden werden mit einem Federstreich annulliert; Sozialleistungen und alle Formen von Subventionen gestrichen. Der öffentliche Apparat bis auf Polizei und Justiz privatisiert. Alle Umweltgesetze seit 1973 werden zurückgenommen; Atomkraft ist, wie uns der Meister erklärt die sicherste Energie überhaupt. (Unter einem islamistischen »Eurabia«-Staat beklagt der Autor dann plötzlich die Luftverschmutzung infolge nicht eingehaltener Gesetze.) Nach zehn Jahren wird dann der Steuersatz nochmals gesenkt: auf 0 %. Die EU kann aber aufatmen: Deutschland bliebe Mitglied, zahlt aber selbstredend keinen Cent mehr. »Ansonsten können sie uns alle am Arsch lecken, weil wir die besten Autos der Welt bauen!« Alternativ schlägt er einen Steuerstreik vor. 300.000 Personen und 15.000 Betriebe müssten einfach nur die Zahlung ihrer Steuern einstellen – der Apparat würde zusammenbrechen, so die These (nein: »These« kann man einen solchen Unfug eigentlich nicht nennen).
Ein eigenes Kapitel widmet Pirinçci dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dem er natürlich auch den Garaus machen möchte (obwohl es gerade dieser »Idiotenverein« war, der seine Katzenkrimis bekannt gemacht hat). Man entbinde mich von den stark anal-fixierten Injurien, die hier zum Einsatz kommen; ich möchte nicht unter einem gewissen Niveau zitieren. Lustig übrigens, wie Pirinçci »analysiert«, warum das Privatfernsehen so wenig Kultursendungen anbietet (außer die Sendungen von »dctp«, die er heftig attackiert): Weil die öffentlich-rechtlichen Sparten wie Kultur für sich beanspruchen würden (ihre Magazine wie »ttt« oder »aspekte« beispielsweise), können die Privaten damit nicht brillieren. Diese Aussage sei, so Pirinçci, eine Art »spieltheoretisches« Geheimwissen, denn das wissen die privaten Fernsehmacher nicht mal selber. Jetzt weiß man auch endlich, warum die »Bild«-Zeitung keine Feuilleton hat: FAZ, SZ und Zeit lesen denen das einfach weg. Schon grandios.
Pirinçcis politische Weltanschauungen weisen sehr große Ähnlichkeiten mit der amerikanischen »Tea-Party«-Bewegung auf (einzig die Vergötterung von Schusswaffen kommt bei ihm nicht vor). Eine andere Parallele auf die David Brooks schon vor einigen Jahren hingewiesen hat, ist sehr interessant. Brooks entdeckte verblüffende Übereinstimmungen nicht nur zwischen der zwischen der amerikanischen Tea-Party-Bewegung und der Linken, sondern auch mit den Lehren von Jean Jacques Rousseau. Letzterer sah ja tatsächlich den unschuldigen Naturzustand des Menschen durch Institutionen jeglicher Art deformiert und am Ende gar ausgetrieben. Auch Pirinçci will den Menschen aus den Ketten des Staates befreien. Das geht so weit, dass er sogar die Sozialleistungen bis hin zur Altenpflege wieder in die Familien zurücküberweisen und entinstitutionalisieren möchte. Die Gemeinschaft ist nicht der Staat, der alles regelt, kontrolliert und uns – so die Befürchtung – das Geld abknöpft und gängelt, sondern die Familie. Alle Institutionen werden abgeschafft, was bleibt ist das imaginäre Gebilde einer »Nation«, die jedoch keine Macht über den Bürger ausübt. Hier bekommt Rousseaus »Gesellschaftsvertrag« einen interessanten Bypass gelegt, denn auch bei Pirinçci bekommt der Allgemeinwillen (»volonté générale«) absolute Priorität.
Pirinçci als eine Art pöbelnder Rousseau? Unabhängig davon, ob er jemals überhaupt von Rousseau gehört hat, artikuliert er ein Unbehagen am existierenden »Gesellschaftsvertrag«, der der Politik ein Mandat für die Steuerung des Gemeinwohls erteilt. Dies ist durchaus ein Gedanke, der nicht unbedingt in Deutschland, aber durchaus in anderen europäischen Ländern mit der Zeit attraktiv werden könnte. Der paternalistische Politikstil versprach dem Bürger ökonomischen Wohlstand, wenn man sie, die Politik, nur in Ruhe arbeiten ließe. »Vorteilsaufteilung zwischen Politik und Gesellschaft« nannte Richard von Weizsäcker 1992 diesen alten, informellen »Gesellschaftsvertrag«. Die Komplexität der Welt wurde an die Politik delegiert, die dafür die Infrastruktur für ein politisch und gesellschaftlich weitgehend sorgloses Leben schafft bzw. erhält.
Spätestens mit den politischen und ökonomischen Krisen innerhalb der EU und speziell des Euro-Raums wird dieser Vertrag zusehends befragt. Pirinçci möchte ihn aufkündigen. Der Staat und die Institutionen hemmen den Menschen in seiner Entwicklung, in dem sie ihm Steuern und Abgaben abverlangen, die, so die These, besser von jedem Individuum selber angelegt wären. Die Tea-Party-Bewegung in den USA wie auch ihr deutsch-türkischer Adept Akif Pirinçci pervertieren den liberalistischen Freiheitsgedanken. Der Urzustand des kettenbefreiten Naturmenschen, der seine Dinge besser selber regelt als es anonymen Institutionen zu überlassen, implementiert am Ende ein sozial-darwinistisches System.
Wenn es einerseits in allen Medien heißt, die Steuereinnahmen »sprudelten« und andererseits gleichzeitig die Klage nach fehlenden Milliarden für Infrastrukturmaßnahmen ertönt, so ist dies nicht mehr zu verstehen. Zu den Überforderungen im geopolitischen Bereich kommen die Sorgen des Mittelstands sozial abzusteigen. Pirinçci trifft hier ins Mark; trotz nicht wegen seiner abstoßenden Sprache. Für ihn gibt es nämlich zwei Mittelschichten – die richtige und die »Fake-Mittelschicht«. Das sind diejenigen, die von der Politik als Mittelschicht bezeichnet werden, aber dennoch in dauernder ökonomischer Abhängigkeit verbleiben. Sie können keine Ersparnisse mehr für spätere Zeiten zurücklegen. Sie werden, um im Jargon zu bleiben, »geschröpft« bis ihnen soviel bleibt, dass sie zwar ein gutes Leben führen können, aber eben auch nicht mehr. Das ihnen zugestandene »Mittelschicht«-Attribut verspottet diese Menschen, so die These. Mit der Angst vor dem Abstieg dieser von ihm geringschätzig als »Fake-Mittelschicht« bezeichneten Klasse spielt Pirinçci. Und zwar äußerst geschickt. Es sind diejenigen, die irgendwann nicht mehr an den sozialen Aufstieg (der immer zunächst als finanzieller Aufstieg wahrgenommen wird) glauben.
Alles nur Spinner?
Hierin liegt auch der Unterscheid zu Sarrazin, der den saturierten Häuslebesitzer und Zweitwagenbesitzer anspricht, dessen aktuell einzige Notlage womöglich darin besteht, dass die Festgeldzinsen praktisch auf Null gesunken sind. Pirinçcis Klientel sind die sich zurückgesetzt Fühlenden, die begrenzte Arbeitsverträge haben, Schichtdienst fahren, absolute Mobilität beweisen müssen, zu konsumieren haben und noch eine Familie gründen sollen. Hier fallen seine Ressentiments, die zum Teil lächerliche Lösungen, die noch nicht einmal Sarrazin-Format besitzen, auf fruchtbarem Boden. Und zwar nicht, weil man seine Vorschläge so toll findet, sondern weil dieser Autor Sorgen und Nöte artikuliert.
Nicht alle Käufer dieser Pamphlete sind Rassisten, Neonazis, Schwulenhasser oder einfach nur Ewig-Gestrige, die sogenannten »Populisten« aufsitzen. Letzteres ist eh nur ein Surrogat eines Arguments, welches beleidigt den Schock verarbeiten soll, dass die eigene Leimrute nicht klebrig genug war. Es wäre zu einfach diese unglaubliche Verachtung, die jemand wie Pirinçci dieser politischen und sozialen Kultur dieses Landes entgegenbringt, als Randphänomen von ein paar Spinnern abzutun. Es könnte sein, dass sich viele mit den komplexen Vorgängen, die politische Funktionseliten implementiert und Medien affirmativ begleitet haben, überfordert sind. Da wären beispielsweise die Auswirkungen der Globalisierung, die seit den 1990er Jahren bis in das Privatleben hineinwirkt. Oder die zunehmende Verrechtlichung und Normierung der Gesellschaft (einerseits gewünscht, andererseits verflucht). Die freie Gesellschaft, die wir haben, wird zunehmend als bedrückend empfunden, weil dann doch vieles reguliert bzw. informelle Regeln zu beachten sind, deren Nichtbefolgung sofort »bestraft« wird. Ein »Spielen verboten«-Schild auf einem Rasen gibt nicht mehr. Die neue Spießigkeit zeigt sich daran, ob der Müll richtig getrennt wird, Texte nicht misogyn sind oder böse Worte enthalten, die »richtige« Ernährung praktiziert wird oder ob man auch tolerant genug ist.
Konsens kann nicht auf Dauer oktroyiert werden
Eine Gesellschaft ist auf breiten Konsens angewiesen. Dieser muss herbeigeführt werden, zur Not im politischen Streit. Dies geschah beispielsweise in den 1970er Jahre offen und polarisierend, wenn es um die neue Ostpolitik und die aufgestauten Modernisierungsdefizite der Gesellschaft ging. Diese Politik wurde von Widerständen begleitet. Brandts Spruch, mehr Demokratie wagen zu wollen, führte am Ende zur Akzeptanz seiner Politik. Der politische Gegner akzeptierte dies; der Konflikt wurde ausgetragen unter Beteiligung des Bürgers. Die heutzutage von den sogenannten Populisten oftmals ins Feld geführten »schweigenden Mehrheiten« schwiegen nicht: sie wurden befragt. Die Politik stellte sich dem Ergebnis – mit dem Risiko des Scheiterns.
Zu Beginn der 1980er Jahren änderte sich dieser Stil. Die Politik suchte für seine großen Vorhaben keinen breiten Konsens mehr, sondern praktizierte mehr und mehr einen gut meinenden Paternalismus. Alle grundsätzlichen Entscheidungen über Projekte innerhalb der Europäischen Gemeinschaft bzw. später Europäischen Union wurden nicht im gesellschaftlichen und politischen Diskurs erörtert, sondern dekretiert. Gravierende außenpolitische Vorgänge (Kosovo- und Afghanistan-Einsatz) als auch langfristige und weitreichende innen- und europapolitische Weichenstellungen wurden innerhalb des politischen Apparats entschieden. Eine EU mit 28 Ländern, die als Regulierungsmoloch wahrgenommen wird (abermals auch Enzensberger), ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der mit einer Zwangsabgabe unvermeidbar für alle finanziert wird, die fragile und am Ende offen gebliebene Diskussion um die Integration von muslimischen Migranten – politische Felder, die niemals einem breiten Diskurs ausgesetzt wurden, die niemals »zur Wahl« standen. Allenfalls in Talkshows treffen Krawallschachteln von dieser und jener Seite aufeinander; um Mitternacht ist dann wieder Schluss.
Es wurde Sitte, alle gesellschaftlich und sozial kontroversen Themen aus Wahlkämpfen aus Furcht vor »Instrumentalisierungen« auszuklammern. Gesellschaftlicher Konsens wurde reduziert auf die Übereinstimmung in den Parteigremien. Medien haben dies zumeist affirmativ begleitet und umgesetzt. Am Ende wurde aus der Wahl zwischen zwei Kandidaten um ein Amt in einer Partei eine »Kampfabstimmung«. Das Wort »Streit« ist nur noch pejorativ gemeint, niemals als konstruktiver Prozess.
Die Diskussion um die potentiellen Interessenten dieses Buches (die ja nicht alles Befürworter sein müssen) verläuft in bekannten Bahnen. Sie werden stante pede in das rechte politische Lager überführt (das ist sehr bequem) oder mit Beruhigungsfloskeln abgespeist. Eine interessante Folge formuliert immerhin Ijoma Mangold: »…wer immer sein Wort erhebt gegen die Diskursvorherrschaft von Gender-Mainstreaming, Steuerstaat, Rauchverbot, Konstruktivismus und Adoptionsrecht für Homosexuelle, findet sich jetzt in der Gesellschaft von Akif Pirinçci wieder.« Und sogar resignativ schließt: »Da überlegt man sich dreimal, ob man nicht doch lieber kleinlaut ins Lager der Gleichstellungsbeauftragten überläuft.« Der Einwurf, dass solche Schmähschriften wie die von Pirinçci den weiteren Diskurs um bestimmte konfrontative gesellschaftspolitische Themen hemmt, wäre dann exakt die Reaktion, die Pirinçci et. al. als Status quo ausweisen.
Mangolds Formulierung, das Buch habe der »Meinungsvielfalt…einen Bärendienst erwiesen« wird nur dann zur selbsterfüllenden Prophezeiung, wenn man nicht mehr diskursiv reagiert, sondern nur noch mit sozialen Repressionen. Substantielle, argumentative Kritik an was auch immer muss immer möglich bleiben. Die Furcht des Feuilletonredakteurs vor der Zustimmung von einer vermeintlich »falschen« Seite darf nicht zum vorsätzlichen Beschweigen eines vielleicht unangenehmen Sachverhalts führen. Dann hätten Pirinçci und Konsorten in ihren überzogenen Diagnosen reüssiert.
Sie können nicht anders
Ein beliebter Einwand zum Schluss antizipiert: Soll/muss man einen solchen rhetorischen Amoklauf auch noch durch mehr oder weniger elaborierte Besprechungen adligen? Ein Dilemma, selbst für ein unbedeutendes Medium wie diesen Blog mit vielleicht 100 mehr oder weniger regelmäßigen Lesern hier. Aber was wäre die Alternative? Wenn man alles beschweigen würde, was einem nicht passt, könnte das Genre der »Kritik« und mit ihm der Diskurs einpacken. Wir wären eine Gesellschaft von Rosamunde-Pilcher-hafter Harmlosigkeit. Die dann irgendwann in Muff umschlägt. In diesem Beschwichtigungs- bzw. Beschweigungswunsch liegt aber auch noch etwas anderes: Die Furcht vor Ansteckung. Und mit ihr der nachlassende (oder vielleicht nie wirklich vorhandene) Glaube an das, was man einst ein bisschen selbstherrlich Schwarmintelligenz nannte. Es ist die Furcht, diese Schwarmintelligenz könnte in Schwarmdummheit umschlagen. Daher das von einigen fast institutionalisierte Wegschauen, Weghören von Signalen aus einer brodelnden Gesellschaft. Es ist wie bei Kindern, die sich unsichtbar wähnen, man sie nicht sehen kann.
Die komplexen Analysen, die brillanten Essays über Integration, den Islam in Europa, die Sinnhaftigkeit von Gender-Mainstream oder die Zukunft eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der nicht immer mehr trivialisiert wird – sie dürften alle längst vorliegen. Aber sie haben kein mediales Eskalationspotential. Daher finden sie keine (bzw. nur untergeordnete) Beachtung in Medien, die geradezu lustvoll den Krawall fordern. Er ist der Schmierstoff ihrer Erregungsindustrie. Pirinçcis tumbes und obszönes Buch lässt sich leicht abwehren. An Problemlösungen ist der Autor gar nicht interessiert. Aber auch die Medien, die wohlfeil beklagen, er gelange mit diesem Buch zu Reichtum, haben offensichtlich kein Interesse daran, komplexe Sachverhalte eingehend zu erläutern, ohne dass es nach Bevormundung klingt. Es scheint so, als bräuchten beide Seiten Skandalbücher von Zeit zu Zeit, um sich in ihrer jeweils eigenen Gesinnung zu sonnen. All das ist das Gegenteil von Diskurs. Es ist ein Jammer.
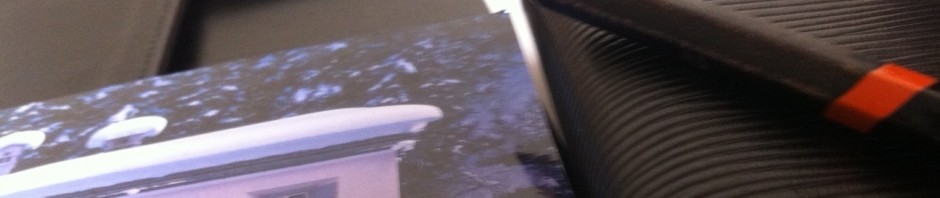


















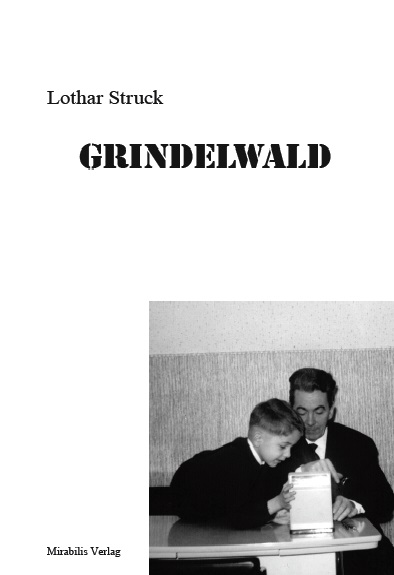
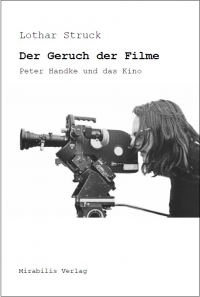
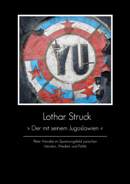
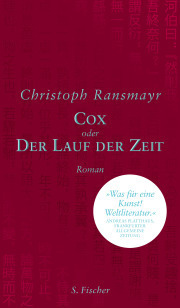
Ich habe mir eine simple Regel auferlegt: alles, was die Menschen freiwillig tun, muss einen guten Grund haben.
D.h. im Falle des Bucherwerbs: es müssen sich »positive Aspekte« mit der Lektüre verbinden.
Fällt mir einiges dazu ein, umso mehr da Gregors Text schon sehr viel Material enthält.
Etwa: ist es nicht eine subversive Freude, Provokationen auszusprechen und zu variieren, wenn die politische Klasse an der Eindämmung (Stichwort: Wahlkampf ohne kontroverse Themen!) und Super-Zivilität ihrer Zeitgenossen arbeitet?! Sabotage macht Spaß. Pirincci lädt dazu ein, jeder darf in seinem Wohnzimmer à la Alfred den Aufstand wagen. Ich möchte dieses Vorhaben unterstützen, da die Disziplinarmächte (Foucault) immer noch gut wirksam sind, siehe p.c.
Desweiteren: Positiv könnte das Angebot auch sein, weil historisch besonders fordernde Perioden (heute?!) eine Abstoßungsreaktion wahrscheinlich machen. Mit vekalen Beschimpfungen können sogar schon Affen (Primaten) aufwarten. Sie nehmen die Scheiße noch in die Hand und schmeißen damit auf das Ärgernis. Wir machen es mit Worten, welche exakt dieselbe »soziale Funktion« erfüllen. Ich würde deshalb nicht allzu schlecht von der Scheiße sprechen, zumal auch die Psychoanalyse vor Abspaltungen des Analen warnt.
#1
Der Vollständigkeit halber: »Der ultraliberale Romantiker«. Alexander Marguier hält dieses Buch scheinbar für ein satisfaktionsfähiges politisches Manifest. Was einiges über sein politisches Verständnis aussagt…
#2
Selten, dass ich beim Lesen eines Textes den Wunsch habe, mich bei dem Autor bedanken zu wollen. In diesem Fall ist das aber so: Danke Gregor. Klug, reflektiert und offenen Auges – leider keine Alltagskost…
#3
»Den in den 70ern kursierenden Spruch »Brandt an die Wand« «
.
Hab ich nie gehört. Und ich war in den »70ern« politisch sehr interessiert; natürlich auf Brandts Seite. Trotzdem: nie gehört, nicht mal von der Springer-Presse oder im »Extra-Dienst« aufgespießt, auch nicht als Spruch unter Kollegen (Hilfsarbeiter in einer Druckerei, damals) oder in der Kneipe… Allerdings kann ich nur für Berlin (damals) sprechen.
#4
Kann man diesen Buchvollschreiber vielleicht mit einem wie »Bushido« vergleichen, dem es auch nur drauf ankommt, mit ahnungsbefreiten (siehe all die Beispiele oben) und gleichzeitig aggressiven Sprüchen (siehe oben) so stark wie möglich aufzufallen (gelungen) und damit viel Geld zu verdienen (auch gelungen)?
Bemerkenswert, dass beide – Bushido wie dieser oben Beschriebene – nicht die typischen »Ekel Alfred«-Figuren sind – sie eher so aussehen und heißen, dass Ekel Alfred sie ganz sicher als »Kameltreiber« bezeichnen & verachten würde.
#5
@Klaus
Ich war in den 70ern Schüler auf einer Realschule in Mönchengladbach, einer CDU-Hochburg. Mindestens zwei Mitschüler kamen mit dem Spruch an. Von einem vergesse ich das Gesicht als er es sagte nie.
Der Vergleich mit Bushido ist gut. Und dass sich Ekel Alfred im Grabe umdrehen würde, dass das »deutsche Wesen« von »Ausländern« hochgehalten wird – das ist klar. Aber auch irgendwie witzig.
#6
Ehrlich gesagt, Herr Keuschnig – irgendwann habe ich aufgehört zu lesen…
Warum verschwenden Sie so viel Zeit und Energie auf den Rotz eines Autors, der erkannt hat, daß seine Pussy-Bücher nicht mehr laufen und es einen Markt für Unflat gibt (von dem übrigens auch ein Henryk Broder, Matthias Matussek sowie der notorische Herr Fleischhauer, das im Körper eines Journalistendarstellers gefangene CDU-Groupie, ganz gut leben)?
Herr P: diskreditiert sich mit seinem Rundumgegeifere doch selbst. Den einen oder anderen diskussionswürdigen Punkt trifft er mit seiner Schrotflinte durch Zufall – aber insgesamt ist das Geschreibsel schlicht indiskutabel; mit jeder Erwähnung verschafft man Herrn P. unverdientermaßen Aufmerksamkeit.
Totschweigen, bitte. Die paar Verwirrten, die auf den Seich abfahren, dürfen sich gern den Namen des Schmonzes verschwörerisch zuraunen. Aber die früher Groschenromane genannte »Literatur« fand aus gutem Grund so gut wie nie Beachtung bei Kritikern – obwohl der Rotz auch läuft wie geschnitten Brot…
Warum sollte man mit Herrn P.s Erbrochenem anders verfahren?
#7
Die Auflösung Ihrer Fragen, @Kurt Mueller, steht in dem Text, den Sie noch nicht gelesen haben. Ich schreib‘ das jetzt nicht noch mal. Im übrigen ist Ihre Sprache der von Herrn Pirinçci fast ebenbürtig.
#8
»Im übrigen ist Ihre Sprache der von Herrn Pirinçci fast ebenbürtig.«
Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.
Im Übrigen: Gut zu wissen – wenn’s mit dem seriösen Schreiben nichts mehr wird, kann ich offensichtlich noch als Gossen-Goethe 2.0 reüssieren… :-)
#9
Da werden Sie warten müssen, bis der »richtige« Gossen-Goethe weg ist…
In Wirklichkeit geht es ja in meinem Text um die Sache mit dem »groben Klotz«. Aber ich interpretiere mein eigenes Zeug natürlich nicht.
#10
»Da werden Sie warten müssen, bis der »richtige« Gossen-Goethe weg ist…«
Nach seinem Äußeren zu urteilen kann das nicht mehr lange dauern.
»In Wirklichkeit geht es ja in meinem Text um die Sache mit dem »groben Klotz«. «
Hab mich zwischenzeitlich bis zum Ende durchgerungen.
Zum Formalen: Hätte man kürzer schreiben können und für einen Online-Beitrag auch sollen.
Inhaltlich: Treffende Analyse der Situation in Medien und Politik – nicht jeder Kommentarschreiber, der sich über »gleichgeschaltete Mainstreammedien« auf Süddeutsche.de oder Tagesspiegel.de ausmährt, ist ein Spinner.
Dennoch hätte man das thematisieren können, ohne Herrn P. und seinen Erguß auch nur zu erwähnen.
#11
Hätte man kürzer schreiben können und für einen Online-Beitrag auch sollen.
Meine Meinung hierzu ist eine dezidiert andere. Wer jemals fünf Minuten in eine Zeitungsredaktion geguckt hat, stellt fest wie sehr dort gekürzt wird, weil der Platz einfach nicht reicht bzw. man glaubt, er reicht nicht (weil meist andere Beiträge und/oder die Werbung wichtiger sind). Online ist reichlich Platz; es gibt keine Begrenzung, Argumente können ausführlich dargelegt werden; die lächerlichen Vereinfachungen und Kürzungen sind nicht mehr notwendig.
Das die gängige Auffassung eine andere ist, mag sein. Die Prägungen durch den Häppchenjournalismus der letzten 20 Jahre ist ja an den Lesern nicht spurlos vorbeigegangen. Ich glaube, dass Online irgendwann durch Tiefe »neu erfunden« wird – um diese Phrase einmal zu bemühen. Dass Sie meinen Text für zu lang halten – damit muss ich leben.
#12
Adolf Pirinçci ist witziger als die meisten seiner Kritiker aus dem Linken Sektor. Natürlich darf Akifs Schmähschrift von niemandem aus dem rotgrünen Feuilleton (das reicht bis zur FAZ) auch nur im geringsten als wohltuend empfunden werden, denn niemand will zum Rechten Sektor gehören, weil das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk (und der »liberalen« Presse) einem Berufsverbot gleich käme.
Dieses Buch sollte man jedem in seinem Bekanntenkreis schenken, der über das rechte Maß an Toleranz und Weltoffenheit verfügt.
#13
»Die komplexen Analysen, die brillanten Essays über Integration, den Islam in Europa, die Sinnhaftigkeit von Gender-Mainstream oder die Zukunft eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der nicht immer mehr trivialisiert wird – sie dürften alle längst vorliegen.« – Was soll man dazu sagen? Überlegen Sie mal, sehr geehrter Herr Keuschnig, wenn die Zukunft noch mehr Integration, noch mehr Islam, noch mehr Gender-Mainstream und noch mehr ÖR bringt – dann sind Sie weg. Wie alle, die noch einen differenzierten Diskurs führen wollen. Ich habe nie verstanden, woher diese gut gemeinte, weil sich emanzipatorisch gerierende Blindheit gegenüber offenkundigen Bedrohungen der Demokratie herkommt. Sie beruht auf einem völligen Mangel jeglicher Ideologiekritik. Aber sagte nicht schon Lenin, dass die Kapitalisten (hier: Essays schreibenden Intellektuellen) den Strick liefern werden, an dem man sie aufhängt?
#14
@Adorján Kovács
Interessanter Spruch von Lenin, der sich ja dann später selber entsprechend betätigte.
Den ÖR habe ich jetzt nicht so direkt als lebensbedrohlich empfunden.
#15
Hass ist das Ergebnis von Angst und Ohnmachtsgefühlen. So viele Menschen, die sich vom Wandel der Zeit existentiell bedroht fühlen. Dabei geht die größte Gefahr vom Hass aus. Vom Hass bis zur Gewalt ist es nur noch 1 kleiner Schritt.
#16
Ich meine dass es auch in den 70ern schon den Verweis auf schweigende Mehrheiten gab.
#17
Herr Keuschnig, Sie sind ja wirklich ein kluger Mann. Treffende, schön formulierte Analyse der Sachlage. Kompliment. Schade, dass sowas nur 100 Leute lesen. Warum? Ich glaube, dass die meisten Großfeuilletonleser gar nichts lernen wollen.
#18
@jokahl
Vor vielen Jahren habe ich mal einen Beitrag verfasst, in dem ich das Bloggen mit der »Do-It-Yourself«-Bewegung vergleichen habe, die in den 70er Jahren aufkam: Leute kauften sich ein Haus oder eine Wohnung und machten so viele handwerklichen Aufgaben wie nur möglich alleine (oder mit Freunden). Die »richtigen« Handwerker, die jahrelang darauf lernten, rümpften die Nase bei diesen »Hobbyhandwerkern«. Sie übersahen zumeist, dass es diese Hobbyhandwerker waren, die besonders präzise arbeiteten. Sie hatten keinen Termindruck durch andere Kunden, arbeiteten für sich selber, wirtschaftliche Erwägungen (Stundenlohn) spielten keine Rolle. Natürlich unterliefen ihnen Fehler, aber das gab es auch beim Profi. – Und so ergeht es heute Bloggern, »Laienkritikern« (schon dieses Wort ist eine Anmaßung), Webseitenbetreibern. Über sie rümpfen die Profis auch die Nase. »Heimlich« lesen sie wohl mal hier und mal dort rein. Und manch einer übernimmt dann auch mal einen Gedanken. Aber sie haben ihr Handwerk gelernt. Sie haben sich jahrelang für eine Position gequält. Und dann kommt da so’n Blogger daher…
Menschlich halt. Oder?
#19
Danke, ich meinte aber i.e.S. nicht mal die Großfeuilletonisten (obwohl ich Ihre Meinung teile) sondern vor allem die entsprechenden Leser.
#20
Ein wunderbarer und kluger Text, Herr Keuschnig!
Bin natürlich anderer Meinung, aber das macht nichts.
Einige Anmerkungen:
1) Alfred Tetzlaff gibt es gar nicht. Er ist eine Propaganda-Figur von Wolfgang Menge, der, als das Linkssein noch nicht mainstream war, auf die – wie Sie richtig schreiben – Selbstdemontage dieses Zerrbildes vertraute. Naja, alte Agitprop-Masche, wem’s gefällt. Der linksrotgrünrosa versiffte WDR sendet es immer und immer wieder, weil auch er natürlich auf Propaganda setzt. Immerhin konnte ich mir’s so ein paar Mal ansehen und muß sagen, daß dieser Alfred eigentlich – sub specie aeternitate – in allem recht behalten hat, ja, was die Sozis angeht, die DDR, die Wiedervereinigung. Nur seine Misogynie ist dämlich. Oder vielleicht doch nicht, wenn man an Hanni Hüsch, Carmen Misoga oder diese andere Zicke mit dem Husky-Blick, die – richtig, Slomka, denkt. Oder an – behold! – Gesine Schwan.
2) »Das seriöse Fernsehen hat sich entschieden, gesellschaftliche Zustände weitgehend in Krimis abzuhandeln.« Nee, nicht als »Zustände«, sondern als Frauenprojekte, in denen Krampfhennen wie Senta Berger oder die Furtquängler
die Welt lila umstricken. (Zum Beispiel gestern in einem totlachhaften Sentabergerfilm mit schwaren Asylanten.)
3) Pirinccis Text richtet sich insofern – wie Sie richtig schreiben – »gegen die zunehmende Verrechtlichung und Normierung der Gesellschaft«. Die geht offenbar nicht nur mir auf die Nerven.
4) Ich empfehle, den Text Pirinccis eher literarisch zu nehmen, als Rollenprosa, als Grobianismus. Portnoys Beschwerden sozusagen. Meinen Sie denn wirklich, diese ganzen Schwanzstellen sind ernstgemeint? Daß jemand wirklich so mit seinem Schwanz wedelt?
5) Sehr seltsam finde ich Ihr Argument, daß »sich viele (Pirincci-Leser) mit den komplexen Vorgängen, die politische Funktionseliten implementiert und Medien affirmativ begleitet haben, überfordert« fühlen könnten. Vielleicht ist es viel einfacher: Sie haben einfach nur von diesem völlig verprantelten Gouvernantenton die Schnauze voll. (Und an welche »Funktionseliten« denken Sie bitteschön: an die Künast, die Roth, die Nahles? Den Schulz, den Trittin, den Kauder?)
6) »An Problemlösungen ist der Autor gar nicht interessiert.« Gott sei’s gepriesen, gepfiffen und getrommelt. Ist auch nicht die Aufgabe des Schriftstellers. Nur im Sozialistischen Realismus. Ja wollen Sie denn wirklich noch ne komplexe Analyse, noch nen brillantinen Kermani-Essay über Integration, den Islam und über die Unsinnhaftigkeit von Gender-Mainstreaming?
Dann ziehen Sie am besten um in den Bitterfelder Weg.
Travis Bickle wohnt da aber nich…
Grüße von Alfred Ben Nemsi
#21
Ach, noch was:
»Brand an die Wand!« Widerlicher Spruch von rechten Bürschchen, die vermutlich später zu RAF-Verehrern wurden und mit Göttinger Mescalero-Gemüt die »klammheimliche Freude« über die Ermordung Schleyers zum Ausdruck brachten. Ihre Enkel sind heute bei der Antifa und gröhlen: »Sarrazin, halt’s Maul!«
#22
Pingback: Ins Blaue | Zurück in Berlin
@Alfred Ben Nemsi
Danke für diesen Kommentar, der perfekt illustriert, wie Pirinçci »arbeitet«: Er stellt eine These auf und sucht dazu die passende Analogie. Man kann das an Ihrem Einwurf zum Spruch gegen Brandt sehen. Diejenigen, die dies sagten, hatten rein gar nichts mit der RAF zu tun. Es war exakt das Gegenteil. Aber das macht Ihnen nichts, Sie konstruieren einfach eine Korrelation.
Damit haben Sie das Prinzip derjenigen übernommen, die Sie so hassen, die sogenannte »linksversiffte Presse«, die zuweilen in ähnlichen verkorksten Analogien daherkommt.
Noch was zum Schriftsteller: Das Buch ist kein fiktionales Werk. Daher ist die Intention des Autors schon relevant. Ob Pirinçci mit seinen Katzenkrimis zum »Schriftsteller« gemacht werden kann – keine Ahnung, ich habe keine Lust, so etwas zu lesen.
Gehen Sie Ihres Weges. Viel Glück dabei.
#23
@ Alfred Ben Nemsi:
»linksrotgrünrosa versiffte WDR«
*Gähn* Es gibt wahrscheinlich wenige Schlafmittel, die besser wirken, als irgendwas mit »linksgrünversifft«…
Liebe Rechte, legt mal ’ne neue Platte auf. Jedes Märchen ist nach dem hundertsten Hören langweilig. Danke.
»Pirinccis Text richtet sich insofern – wie Sie richtig schreiben – ‚gegen die zunehmende Verrechtlichung und Normierung der Gesellschaft'«
Eine sehr gewagte These für jemanden, der sich anscheinend an Homosexualität und Frauenrechten stört. Ein vorgeschriebenes weißes, männliches, christliches und heterosexuelles Deutschland ist ja wohl Normierung par excellance, nicht die Auffassung, seinen Nachbarn einfach nach seiner Facon glücklich werden zu lassen.
»Ich empfehle, den Text Pirinccis eher literarisch zu nehmen, als Rollenprosa, als Grobianismus. Portnoys Beschwerden sozusagen.«
Klar. Ich vertreibe mir die Wartezeit auf den Bus auch gern damit, dass ich den Fahrplanaushang aus literarischer Sicht analysiere – dieser Grobianismus (»[Fußnote] M – Bus fährt nur bis Haltestelle Müllerstraße«) regt mich immer wieder zum Nachdenken an. Über die Gesellschaft zum Beispiel. Was ist, wenn eine arme alte Frau weiter muss als zur Müllerstraße? Muss sie umsteigen? Laufen? Ein Taxi nehmen? Die Realität ist traurig. Zutiefst traurig.
Im Ernst: Jeder Klokabinenspruch ist mehr Literatur als dieses Erbrochene eines frustrierten alten Mannes, der die Trennung von seiner Frau nicht verkraftet und sie auf die bösen Schwulen und die bösen Muslime schiebt.
»Meinen Sie denn wirklich, diese ganzen Schwanzstellen sind ernstgemeint? Daß jemand wirklich so mit seinem Schwanz wedelt?«
Ja.
»Ja wollen Sie denn wirklich noch ne komplexe Analyse, noch nen brillantinen Kermani-Essay über Integration, den Islam und über die Unsinnhaftigkeit von Gender-Mainstreaming?«
Wie wäre es für den Anfang mal mit einem sachlichen Ton, auf dessen Grundlage man diskutieren kann? (Ich weiß, dass mein Ton gegenüber Pidingens – ich setze ihn auf eine Stufe mit einem Dschungelcamp-Gewinner, dessen Namen ich mir auch nicht merke – auch nicht wirklich sachlich war. Bringt bei ihm aber auch nichts.)
#24
Ich möchte noch einen Gedanken zur Aufforderung, Pidingens Text literarisch zu nehmen, ergänzen:
Wie sich die Zeiten doch ändern. Früher waren es mal die Linken, die wirklich jeden Unsinn zu Kunst erklärt haben. Heute stehen die Rechten ihnen in keinster Weise nach.
#25
Okay, jetzt haben sich die jeweiligen Lager mal wieder ausgeko*****.
Es wird Zeit für eine Beruhigung. Ich schließe erst einmal die Kommentare. Kommentare auf anderen Threads zu diesem Thema werden gelöscht. Geht mal spazieren. Hilft gelegentlich.
#26
Pingback: gelblog › Weekly Links Digest May 25, 2014