»Das Versagen der Politik« will Hans Herbert von Arnim in seinem Buch »Volksparteien ohne Volk« – ja, was? – auflisten, entwickeln, enthüllen? Aber außer ein paar Bemerkungen über die Subventionspolitik zur ansonsten eher als Bastion des freien Marktes auftretenden Europäischen Union und einer zweitklassigen Politikerschelte hinsichtlich ihrer Versäumnisse was die aktuelle Finanzkrise angeht, erfährt man über ein potentielles Politikversagen kaum etwas.
Denn so weit kommt von Arnim einfach zu selten, weil er nur zwei große Themen hat: Parteien- und Politikerfinanzierung und das Wahlrecht, welches, so die These, den Volkswillen nicht nur nicht ausdrückt, sondern ignoriert. Auch wenn einem diese Themenbeschränkung als Gründe für eine immer weiter behauptete Politikverdrossenheit ein bisschen eindimensional erscheinen – warum nicht neue Argumente lesen, die dann vielleicht jene Untersuchungen relativieren, die in mangelnder Konsistenz der Politik (beispielsweise durch allzu anbiedernde Ausrichtung der Programmatik an jeweils aktuelle Umfragetrends) als Hauptgrund für eine sich breitmachende Politikmüdigkeit ausmachen?
Aber auch hier versagt von Arnim, der mit markigen, manchmal albernen Sprüchen agi(ti)ert. Dabei übertönt die empörerisch daherkommende Krawallrhetorik leider die Ernst zu nehmenden, wichtigen Einwände, die sich natürlich auch im Buch finden. Weil aber irgendwann alles nur noch verfassungswidrig ist und politisches Handeln allzu pauschal nur noch auf Macht und Geld reduziert werden, finden sich schnell keine adäquaten Begriffe mehr für tatsächlich grenzwertige, wenn nicht gar verfassungsinkompatible Zustände.
Und so nimmt sich von Arnim dann auch das Grundgesetz vor. Es beruhe in Wahrheit…gar nicht auf dem Willen des Volkes, sei dem Volk gar oktroyiert worden. Die Bürger hätten ihm nie zugestimmt, weder direkt durch Volksabstimmung noch indirekt. Es gebe keine demokratische Legitimation des Grundgesetzes. Weder lässt von Arnim die Ratifizierungen durch die einzelnen Länderparlamente 1949 gelten (er erwähnt sie zur Sicherheit erst gar nicht) noch vermag er sich der ansonsten verbreiteten These anzuschliessen, das Grundgesetz sei durch die Wahlbeteiligung an der ersten Bundestagswahl 1949 sozusagen indirekt vom Volk akzeptiert worden. Wenn er tatsächlich dieser Meinung ist, dann fragt man sich allerdings, warum laufend das Grundgesetz zum Maßstab all seiner Betrachtungen gemacht wird.
Neben diesen hanebüchenden Behauptungen, die mit effekthascherischen Attitüden garniert werden, gibt es Ungenauigkeiten en masse bis hin zu Fehlern. Es ist natürlich legitim, dass ein Autor seine Thesen auch pointiert und sogar polemisch setzt. Hierbei darf es jedoch alleine aus Gründen der intellektuellen Redlichkeit nicht zu bewussten Verdrehungen, falschen Tatsachenbehauptungen oder Auslassungen kommen.
So lässt von Arnim nicht davon ab zu behaupten, die politische Klasse (er verwendet diesen Begriff ausschließlich pejorativ) habe sich mit der Zeit das Wahlrecht nach ihrem Gusto anverwandelt. Nach einer Bestätigung sucht man allerdings vergebens – die letzte gravierende Veränderung, die er anspricht, war die Einführung der 5%-Klausel. Das von ihm vehement bekämpfte Verhältniswahlrecht, welches mit Landeslisten operiert, ist dem Geiste nach (im Bund – und hierum geht es hauptsächlich) praktisch nie verändert worden. In einem anderen Sinne mutet die Klage, die Abgeordneten änderten das Grundgesetz fast nach Belieben reichlich merkwürdig an wenn er andererseits laufend Korrekturen und Änderungen anmahnt. Es ist bedauerlich, dass sich von Arnim nicht viel mehr auf die tatsächlich existierenden Fehlkonstruktionen konzentriert und immer auch gleich die »Systemfrage« mitstellt. Er kommt einem manchmal wie ein Feldherr vor, der auf dem Schlachtfeld den Sitz der Uniform höher bewertet als die Ausrüstung seiner Soldaten.
Sein Furor geht so weit, dass er das gesamte Prozedere zur Bundestagswahl als irregulär verwirft, weil (angeblich) Vorgaben des Grundgesetzes (welches ja eigentlich als illegitim angesehen wird) verletzt werden. Wir hätten, so von Arnim, in Wahrheit gar kein demokratisches Wahlrecht. Selbst die Erststimme bei der Bundestagswahl sei keine Personenwahl, wie sie gefordert würde, sondern eine Parteienwahl, da der Bürger bei der Kür des Wahlkreiskandidaten nicht beteiligt war. Von Arnim schlägt hier Vorwahlen im Sinne der USA vor, ohne auszuführen, wie dies ablaufen soll. Muß man sich dann als Wähler für eine Partei registrieren lassen (Datenschutz!) oder dürfen nur Parteimitglieder abstimmen (vieles spricht dafür, dass er die erste Möglichkeit favorisiert)? Wie soll dabei konkret der Einfluß der Parteien reduziert werden, wird es doch nur eine Wahl innerhalb der jeweiligen Parteimitglieder geben? Am Rande sei bemerkt, dass das Vorwahlsystem in den USA politische Figuren wie Reagan oder Bush jr. nicht verhindert hat. Unlogisch, wenn er einerseits vehement für innerparteiliche Demokratie eintritt – andererseits dann Kandidaturen von mehreren Bewerbern als Kampfabstimmung diskreditiert.
Gegen die 5%-Klausel und für das Mehrheitswahlrecht
Auf quälend langen Listen führt von Arnim die heute schon »sicheren« Wahlkreise für die Bundestagswahl im September 2009 auf – Wahlkreise, in denen die Direktkandidaten einer bestimmten Partei teilweise seit Jahrzehnten reüssieren. Sicher sind die Wahlkreise, weil dort die Parteizugehörigkeit des Kandidaten alleine schon ausreicht, um gewählt zu werden (beispielsweise Wahlkreise in Bayern – CSU; im Ruhrgebiet – SPD). Unklar bleibt, wie eine Vorwahl dies ändern soll. Spielt doch, wie von Arnim mehrfach betont, die Person an sich gar keine Rolle, sondern nur die Parteizugehörigkeit. Kein Wort auch dazu, wie bzw. wer den Vorwahlkandidaten ihre »Caucus«-Wahlkämpfe bezahlen sollen. Zu Recht geißelt von Arnim den Status quo, dass die Parteien alteingesessene Kandidaten gegenüber innerparteilichen Herausforderern finanziell und personell stark begünstigen. Aber wie soll dies im Falle von Vorwahlen anders geregelt werden?
Da von Arnim mit großem sprachlichem Furor bereits die Erststimmen als undemokratisches Geschacher verwirft, gibt es dann kaum noch rhetorische Steigerungsmöglichkeiten die Listenwahl per Zweitstimme zu kritisieren. Auch hier erkennt er nichts als Gekungel. Vieles was er hier anführt, ist zwar richtig aber eben längst jedem normal politisch interessierten als Ärgernis bekannt. Vehement wendet sich der Autor gegen die »Absicherung« prominenter Politiker auf Landeslisten. Das Argument, der Wählerwille werde ausgehöhlt, wenn beispielsweise ein im Wahlkreis unterlegener Kandidat über die Liste doch noch in den Bundestag einziehe, wird allerdings nicht konsequent zu Ende gedacht.
Zwar führt er mit großer Akiribie Wahlkreise auf, in denen bei der letzten Bundestagswahl zwei, drei, ja teilweise vier weitere Kandidaten zusätzlich zum Gewinner über die jeweiligen Landeslisten ihrer Parteien in den Bundestag eingezogen waren. Die Listenabsicherung führe meist dazu, dass bestimmte Kandidaten, die von Parteien auf diese Position gehievt worden seien, in jedem Fall in den Bundestag einziehen würden. Zweifellos ist dies kurios. Und fast folgerichtig tritt von Arnim plötzlich mit großer Vehemenz für das (relative) Mehrheitswahlrecht im Bund ein.
Der Leser ist nun allerdings verwirrt: Auf Seite 56 wird festgestellt, dass die Fünfprozentklausel die Grundrechte der freien Wahl und Wählbarkeit der Bürger und der Chancengleichheit der Parteien schwer beeinträchtig[e] (die Gefahr der Zersplitterung des Parlaments sieht er nicht als gegeben) und auf Seite 152 schimpft er nun über die Macht der kleinen Zünglein-an-der-Waage-Parteien, insbesondere natürlich der FDP, die 41 Jahre die Regierung bestimmt habe. Dies laufe auf eine Entmachtung des Gros der Wähler hinaus. Was denn nun – Mehrheitswahlrecht oder Verhältniswahlrecht ohne 5%-Klausel? Von Arnim macht gar keine Anstalten, diesen Widerspruch auch nur irgendwie zu aufzulösen.
Man kann natürlich für ein Mehrheitswahlrecht sein – aber es würde ja die von ihm für mindestens ebenso wichtig erachteten Probleme der Parteien- und Politikerfinanzierung nicht lösen. Zwar würde es beim Mehrheitswahlrecht auf Bundesebene sofort keine Koalitionen mehr geben (die tatsächlich mindestens in einer Grauzone agieren, da der ausgehandelte Koalitionsvertrag selber nicht Gegenstand demokratischer Legitimation ist) – aber wie reagiert man bei konträren Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat (eine Problematik, die von Arnim dem Verhältniswahlrecht anlastet, was ziemlich ungenau ist)? Die demokratische Legitimation des Vermittlungsausschusses zwischen Bundestag und Bundesrat kommt erstaunlicherweise beim ihm nicht vor.
Einerseits beklagt von Arnim eine zu starke Dominanz von CDU/CSU und SPD – andererseits will er das Mehrheitswahlrecht. Hier geht er nur undeutlich auf Strohmeiers und gar nicht zum Beispiel auf Poiers Kompromissvorschläge ein. Beide versuchen Mischformen zwischen Mehrheits- und Verhältniswahlrecht zu entwickeln, um kleineren Parteien zumindest teilweise Teilnahme zuzugestehen, ohne ihnen – wie bisher – die Position des »Königsmachers« zu verschaffen.
Es ist überraschend, dass von Arnims Bild des Wählers offensichtlich nicht das Beste zu sein scheint, obwohl er doch so vehement für dessen Rechte eintritt. Er zitiert das Spötterwort von der »Besenstiel-Theorie«, die zynisch feststellt, in bestimmten Wahlkreisen würde selbst ein Besenstiel gewählt, vorausgesetzt er habe die richtige Parteizugehörigkeit. Hier nimmt er das Urteil des Wählers schon vorweg, weil er das aktuelle Wahlverhalten einfach aus der Vergangenheit ableitet; die Möglichkeit einer Änderung des Stimmverhaltens zieht er gar nicht ins Kalkül. Wenn er den politischen Parteien unterstellt, die behandelten die Wähler wie Stimmvieh, so betreibt er in diesem Moment nichts anderes.
Kumulieren und panaschieren und die Direktwahl des Ministerpräsidenten
Desweiteren wird behauptet, die Feinheiten des Verhältniswahlrechts (bspw. die Problematik der Überhangmandate) seien dem Wähler nicht vermittelbar. Gleichzeitig wird jedoch für flexible Listen plädiert, in denen man panaschieren und kumulieren kann (die unterschiedlichen Möglichkeiten werden leider nur sehr oberflächlich erörtert; es ist natürlich einfacher, Parolen zu dreschen statt Aufklärung zu versuchen). Er feiert diese flexiblen Listen, die in vielen Bundesländern auf kommunaler Ebene eingeführt sind (insbesondere Baden Württemberg kommt hier eine Vorbildrolle zu), erklärt aber weder warum die Wahlbeteiligungen auf kommunaler Ebene deutlich unter denen der Bundestagswahl liegen noch wie viele Wähler von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben oder einfach nur (wie gehabt) das »Listenkreuz« abgaben. Kann es sein, dass von Arnim die Anstrengungen für den Wähler unterschätzt, die darin bestehen, sich mit allen Personen auf der Liste auseinanderzusetzen (am siehe am Beispiel von Hessen, wie komplex dieses Wahlsystem ist)? (Über die Spottnamen für die ellenlangen Wahlzettel liest man auch nichts.)
Seltsam, dass es von Arnim nicht in den Sinn kommt an das passive Wahlrecht des Bürgers zu erinnern bzw. die Möglichkeit der Partizipation des Bürgers über die Parteien darzustellen. Zwar erläutert er die Problematik von sogenannten Ochsentour[en] und die vielleicht demotivierenden Erfahrungen innerhalb von Parteistrukturen. Dennoch bleibt zu fragen, warum er diese Möglichkeiten ausschließlich negativ konnotiert. Oder ob hier ein Feindbild zu dominant ausgeprägt ist?
Den auf den ersten Blick interessanten Gedanken, in den Bundesländern den Ministerpräsidenten direkt wählen zu lassen, entwickelt von Arnim leider auch nicht weiter. Der Rekurs auf die Direktwahlen zum Bürgermeister in den Kommunen verkennt ja die Tatsache, dass Länderregierungen über den Bundesrat direkte Einflussmöglichkeiten im Bund haben. Was, wenn der direktgewählte Ministerpräsident einem mehrheitlich oppositionellen Landesparlament gegenüber steht? Wie wird dann das Landeskabinett gebildet und wie wird diese Form der »Cohabitation« im Bundesrat zu Buche schlagen? Wie verträgt sich dieser Vorschlag mit der Aussage, Ministerpräsident in einem deutschen Bundesland…[sei] einer der schönsten Jobs der Welt, da man »Herrscher aller Reussen« sei und wie ein König regieren könne. Würde dieses Verhalten nicht durch eine Direktwahl noch gefördert? Man vermisst auch die Erläuterung, warum diese einzelne Maßnahme den degeneriert[en] Föderalismus, jenes unselige Erbe der Besatzungsmächte (wie geschichtsvergessen von Arnim doch zu sein scheint), revitalisieren soll. Denn – so führt er an anderer Stelle im Buch schlüssig aus: die Länderparlamente haben immer weniger zu entscheiden. Auch hier also Inkonsistenzen, Unklarheiten, Unausgegorenes.
Natürlich wird auch die inzwischen in den Mainstreammedien angekommene Problematik der sogenannten Überhangmandate erörtert. Zunächst wird erläutert, warum Überhangmandate verfassungswidrig sein sollen (diese Meinung hat keinen Bestand beim Verfassungsgericht) und dann widmet sich der Autor der tatsächlichen Entscheidung des Gerichts bezüglich des »negativen Stimmgewichts«, d. h. des Paradoxons, dass bei bestimmten Konstellationen ein Stimmenzugewinn einer Partei schadet.
Das Kneifen des Autors vor der Komplexität
Vorgeschlagen wird, die Überhangmandate durch ein sogenanntes Grabenwahlsystem abzuschaffen, welches Wahlkreis- und Listenwahl trennt und damit das negative Stimmgewicht verunmöglicht. Wie sich das dann allerdings mit der Klage über die aufgeblähten Parlamente verträgt, bleibt unklar. Von Arnim argumentiert hier allerdings auch wieder ungenau. So wird suggeriert, Überhangmandate und das Paradoxon des negativen Stimmgewichts seien identisch. Dass jedoch nicht jedes Überhangmandat automatisch den Effekt des negativen Stimmgewichtes nach sich zieht, ist schwer zu entdecken. Wer genaue Details haben will, wird hier alleingelassen und muss auf Wikipedia ausweichen. Wenn’s ein bisschen komplex wird, kneift der Autor.
Die Kritik am Bundesverfassungsgericht ob des Urteils, mit der Beseitigung der Problematik des negativen Stimmgewichts dem Gesetzgeber bis 2011 Zeit zu lassen nutzt von Arnim zu einer Suada wider die Besetzungsmodalitäten des Gerichts. Seinen diesbezüglichen Änderungsvorschlag findet man ausgerechnet im Kapitel über den Bundespräsidenten (den er vom Volk wählen lassen möchte): Dieser solle doch die Richter ernennen. Man kennt dies ja aus den USA – dort besetzt der Präsident die Richter des Supreme Court (und zementiert oft auf Jahrzehnte seine politische Richtung); die Senatsanhörung ist meist nur eine Formsache. Vom wem soll die bundespräsidiale Entscheidung angehört werden? Oder eine Prise Absolutismus nach Deutschland? Nein, danke.
Das zweite Spezialthema von Arnims ist die Vergütung der Politiker (inklusive Ruhegelder), deren Ämterhäufung und die Parteienfinanzierung. Dass hier trotz einiger kleiner Fortschritte der letzten Jahre einiges im Argen liegt, ist bekannt. Es liegen allerdings hierzu genug Vorschläge auf dem Tisch. Bei von Arnim erfährt man dazu leider wenig. Stattdessen wird der Leser mit allen möglichen Zahlen bombardiert. Diese werden auch noch gebetsmühlenhaft wiederholt. So erfährt man beispielsweise auf den Seiten 336, 337 und 353 das Europaparlamentarier im Monat 17.540 Euro für Mitarbeiter ausgeben dürfen. Und es gibt mindestens fünf Stellen im Buch, die die äquivalente Summe für deutsche Bundestagsabgeordnete ausweisen.
Die Sprache ist bei diesem Thema besonders deftig. So wird der Betrag, den ein Minister als Abgeordneter zusätzlich zu seinem Ministergehalt bezieht laufend als Schwarzgeld apostrophiert. Parteispenden werden immer mit Korruption gleichgesetzt. Frontal wird das System der staatlichen Parteienfinanzierung der Bundesrepublik angegriffen – um ausgerechnet das britische System als vorbildhaft darzustellen: Der intensive politische Wettbewerb, den das Mehrheitswahlrecht begünstigt, hat mit dazu beigetragen, dass dort praktisch keine staatliche Parteienfinanzierung existiert. Von Arnim verwechselt in der Eile staatliche Parteienfinanzierung, die auf festgesetzten, pauschalen Zuwendungen beruht (bspw. Wahlkampfkostenerstatzung und Aufwandspauschale der Abgeordneten, deren Höhe man ja durchaus diskutieren kann) mit einem Spesensystem, welches derzeit in Großbritannien die Regierung ob seines Missbrauchspotentials erschüttert. Widersprüchlich ist seine Haltung auch dahingehend, wenn einerseits (berechtigterweise) heftig gegen Lobbyismus von Wirtschaft und Verbänden gewettert wird, andererseits die angelsächsischen Finanzierungsmodelle, die hierauf im wesentlichen basieren, goutiert werden. Eine seriöse Behandlung dieser Thematik sieht anders aus.
Jeden gefundenen Fehler hysterisiert von Arnim sofort. Vokabeln wie Ämterpatronage oder Kartell-Parteien oder legalisierte Vetternwirtschaft sind an der Tagesordnung. Korruption von Abgeordneten sei straflos, wird ernsthaft behauptet. Vehement wird die EU angegriffen, die mit der neuen Wahlperiode die Vergütungen der EU-Parlamentarier vereinheitlicht hat (7.500 Euro/Monat). Man erfährt, dass ein bulgarischer Abgeordneter nun rd. 605% mehr verdient als vorher. Von Arnim tritt für eine kaufkraftgemässe Vergütung ein, d. h. der Bulgare sei mit seinen bisherigen 1.036 Euro angemessen bezahlt.
Peinlichkeiten, Auslassungen, Manipulationen
Desweiteren werden Rechnungen aufgeführt, in denen ein luxemburgischer Abgeordneter etwa 75.000 Einwohner repräsentiert, ein deutscher jedoch 830.000. In überbordender Polemik heisst es, dass die Stimme eines Luxemburgers elfmal mehr Wert sei als die Stimme eines Deutschen. Deutschland sei im EU-Parlament unterrepräsentiert. Auch hier ist von Arnims Widersprüchlichkeit überdeutlich: Einerseits beklagt er eine zu aufgeblähte EU-Administration, andererseits würde eine einwohnergemässe Besetzung des EU-Parlaments genau dazu führen. Desweiteren vergisst er, dass die prozentual etwas grosszügigere Berücksichtigung gerade der kleinen Länder politisch gewollt ist. Die tatsächlichen demokratischen Defizite in der EU-Administration spielen leider nur eine untergeordnete Rolle.
Einiges ist geradezu peinlich. Etwa wenn er schreibt, dass das Europäische Parlament kein einheitliches europäisches Volk vertritt. Als Beleg führt er Artikel 189 EG-Gesetz an, in dem es heißt: »Das Europäische Parlament besteht aus Vertretern der Völker der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten…« Von Arnims Schluß: Deutsche EU-Abgeordnete vertreten also das deutsche Volk, französische Abgeordnete das französische, und polnische EU-Abgeordnete vertreten das polnische Volk. Das bedeutet aber, dass die Abgeordneten sich…nach dem Referenzrahmen ihres jeweiligen Herkunftslandes richten sollten und nicht nach einheitlichen gesamteuropäischen Maßstäben, die es ebenso wenig gibt wie ein einheitliches europäisches Volk. Abgesehen davon, dass im Gesetz gar keine Rede von einem europäische[n] Volk ist: Gravierender ist die gewollte Fehldeutung des Gesetzestextes, dass das Parlament aus Vertretern der Völker bestehe und die Schlußfolgerung hieraus, dass diese Vertreter dann die Interessen der Nation zu vertreten hätten. Dabei ist exakt das Gegenteil intendiert, was sich ja u. a. in der von ihm ebenfalls heftig kritisierten Fraktionsbildung innerhalb des Europäischen Parlaments zeigt (wenn auch in der Praxis die nationalen Egoismen auch im Europaparlament immer wieder aufscheinen).
Zwanghaft seine Versuche, Richard von Weizsäcker, einen Kritiker des Parteien- und Parteienfinanzierungssystems der Bundesrepublik, als Kronzeugen für seine Thesen zu instrumentalisieren. Weizsäcker habe, so suggeriert von Arnim, davon gesprochen, dass die Parteien den Staat als Beute betrachten würden. Tatsächlich stammt diese Formulierung aus einem Interview in der »Zeit«, in dem von Weizsäcker diese Formulierung jedoch für das Vorgehen der Parteien (präziser: der SPD) im Berliner Finanzskandal Anfang der 80er Jahre verstanden wissen wollte (»In Berlin haben wir stärker als anderwärts in den letzten Jahren eine Parteienkoalition und vor allem eine führende Regierungspartei erlebt, die sich den Staat zur Beute gemacht hat. Die Ämterpatronage hat nirgends den hiesigen Umfang angenommen.« Von Weizsäckers Einschätzung war damals allerdings nicht ganz uneigennützig – er wurde 1981 bei Neuwahlen zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt.) Und von Weizsäckers Vorwurf der »Machtversessenheit« aus dem Jahr 1992 ist zwar pro forma an alle Parteien gerichtet (Stichwort: Überparteilichkeit des Bundespräsidenten) – hatte jedoch in Wirklichkeit das »Prinzip Kohl« im Auge (obwohl von Weizsäcker dies heute relativiert). Von Arnim verschweigt einfach den Kontext, in dem beide Bemerkungen stehen und vereinnahmt den ehemaligen Bundespräsidenten auf diese plumpe Weise.
Mit anderen Sachverhalten nimmt er es auch nicht so genau. Ein kleiner Fehler nur, wenn in der Betrachtung der Grundmandatsklausel auf Seite 58 der PDS nach der Wahl 2002 nur ein Mandat zugeschrieben wird, auf Seite 65 dann die korrekte Zahl (zwei) erscheint. Größer schon der Irrtum, Regierungswechsel im Bund seien in der Vergangenheit meist nicht durch Wahlen, sondern durch Bildung neuer Koalitionen erfolgt. Das stimmt für 1966 und 1982, aber nicht für 1969, 1998 und 2005. Allerdings ist von Arnim bei 1969 anderer Meinung: er führt zwar aus, dass mit der Wahl Gustav Heinemanns zum Bundespräsidenten im Mai 1969 die FDP signalhaft zur SPD umgeschwenkt wäre und daraufhin die SPD von der fast schon sicheren Einigung mit CDU/CSU das Mehrheitswahlrecht einzuführen, abgerückt sei um eine mögliche Koalition mit der FDP nicht zu gefährden (diesen Sachverhalt erwähnt er mindestens vier Mal) – dann jedoch setzt er das Märchen von der Ignoranz des Wählerwillens in die Welt, weil die SPD sich als zweitstärkste Partei mit der FDP gegen den ehemaligen Koalitionspartner zusammengetan habe – und dies obwohl durchaus Minderheitenregierungen akzeptiert würden.
Wesentlich elementarer als diese Kleinigkeiten ist es da, wenn akribisch die Vergütungen der Landtagsabgeordneten der Länder, in denen 2009 gewählt wird aufgeführt werden und exemplarisch für alle anderen Bundesländer erscheinen, aber ein Gegenbeispiel vorenthalten wird. Denn immerhin gibt es mit der seit 2005 in Nordrhein-Westfalen gültigen Vergütungsverordnung der Landtagsabgeordneten auch ein positives Modell. Dort wurden die Diäten zwar drastisch erhöht. Aber im Gegenzug fielen alle steuerfreien Pauschalen weg und die Abgeordneten müssen selbst für ihre Altersversorgung und ihre Krankenversicherung sorgen. Das Modell fand sogar die Zustimmung des Bundes der Steuerzahler. Hiervon findet sich kein Wort in diesem Buch.
Schäumende Empörungsrhetorik
Man erschrickt, dass von Arnim offenbar auf verfassungstheoretischem Gebiet Wissenslücken zu besitzen scheint – oder eine gespielte Naivität zur Schau stellt. Abgesehen von der ökonomischen Komponente (die Doppelalimentierung ist in der Tat ein Ärgernis) suggeriert der Autor, dass ein Minister, der zugleich auch Abgeordneter im Parlament ist, das Prinzip der Gewaltenteilung verletzt. Die Kontrollfunktion des Parlaments sei ad absurdum geführt, wenn ein Minister über seinen »eigenen« Gesetzentwurf abstimmen würde. Vordergründig hat von Arnim hier recht. Er erwähnt jedoch nicht, dass diese Gewaltentrennung, die er hier verfechtet, mit dem Prinzip der Gewaltenteilung gar nicht gemeint ist. Ein Anfängerfehler – oder vorsätzliche Täuschung des Lesers?
Moderne Staatsrechtler sprechen längst von einer Gewaltenverschränkung und wollen die Legislative eher in der Funktion der (parlamentarischen) Opposition verorten, da der Parlamentarier der Regierungsfraktion(en) in der Regel mindestens befangen ist (über die problematische Gepflogenheit des »Fraktionszwangs« finden sich in dem Buch nur wenige, erstaunlicherweise eher beschwichtigende Bemerkungen). Natürlich könnte in der Bundesrepublik die Trennung von Ministeramt und Mandat festgeschrieben werden (was sicherlich ein Vorteil wäre), dennoch ist es völlig unangemessen, diese Frage derart zu skandalisieren.
Das Buch ist durchsetzt von logischen Fehlschlüssen des Autors; meist verunglückte Versuche, polemisch-scharf zu sein. So mag man ja den Chefvolkswirt der Deutschen Bank für eine fragwürdige Figur halten, aber warum seine Prognose von Ende Februar 2009, die Wirtschaft breche um 5% im laufenden Jahr ein mit der Bemerkung kommentiert wird, dass Walter dabei ausblendete, dass es die Banken selbst waren, die Derartiges verursacht haben und weiter verursachen, bleibt ein Rätsel. Walters Wirtschaftsprognose ist eine Erwartung an die Zukunft – die Ursachenforschung ist natürlich (erst einmal) ein anderes Feld.
Was bei Walter noch wie eine Episode erscheint, wird in der Argumentation um den Föderalismus heikel. Ein Grundproblem des deutschen Föderalismus sieht von Arnim im unangemesse[n] Zuschnitt der Länder, der auf der Willkür der früheren westlichen Besatzungsmächte beruht. Hieraus ergebe sich als fatale Folge des Ausbleibens einer durchgreifende[n] Gebietsreform der sogenannte Finanzausgleich, der wirtschaftlich stärkere Länder zu Ausgleichzahlungen an schwächere verpflichte. Auch diese Konklusion bleibt geheimnisvoll: Meint von Arnim, dass Bundesländer neu konzipiert gehören (die Reduzierung auf neun oder gar sechs ist immer wieder im Gespräch)? Wenn ja, wie? Sollen sich wirtschaftlich schwächere Länder zusammenschließen oder soll es ein »Patenschaftsmodell« geben? Was, wenn sich die Wirtschaftsleistung in den einzelnen Ländern ändert? Oder, ein bisschen weiter gefasst: Wie sieht seine Vorstellung eines besseren Föderalismus aus? Will er überhaupt einen? Oder will er den Föderalismus abschaffen? Wenn ja, was kommt stattdessen?
Detaillierte Vorschläge zur besseren Parteienfinanzierung bleibt er ebenso schuldig wie eine Ausdifferenzierung des von ihm favorisierten Mehrheitswahlrechts. Sein emphatisch vorgetragenes Plädoyer für mehr Bürgerbeteiligung erschöpft sich in symbolische Kandidatenwahlen, die ansonsten konturlos bleiben. Warum wird der Leser mit wohlfeilen Phrasen abgespeist, statt ihm ausgearbeitete Modelle und Entwürfe vorzulegen?
Schäumende Empörungsrhetorik versperrt mehr als nur gelegentlich den Blick aufs Wesentliche. Als ein dröhnendes Sprachrohr wird Oskar Lafontaine apostrophiert – man ist geneigt, dieses Attribut als gelungene Charakterisierung auf den Autor selber anzuwenden. Er bereitet einen Eintopf zu, dessen zweifellos vorhandenen guten Zutaten in der Masse der verdorbenen Beigaben nahezu verschwinden. Die Lektüre dieser zähen, redundanten und teilweise gehirnwäscherischen 370-Seiten-Schrift ist für den auch nur rudimentär politisch vorgebildeten Leser reine Zeitverschwendung.
Hans Herbert von Arnims Verdienste in der Vergangenheit sind unbestreitbar, aber mit solchen nichtssagenden Pamphleten entwickelt er sich leider zum Dieter Bohlen der Parteienforscher. Das schmerzt doppelt. Denn es geht ja um mehr als Herrn von Arnim.
Die kursiv gedruckten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
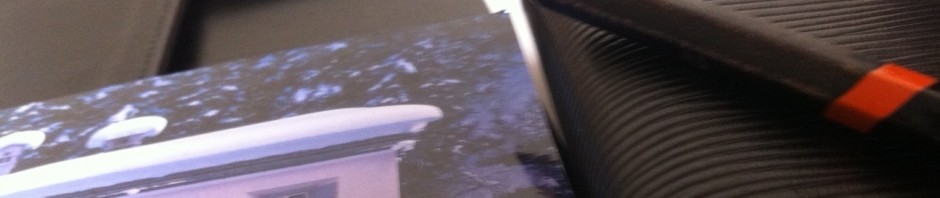
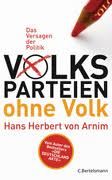


















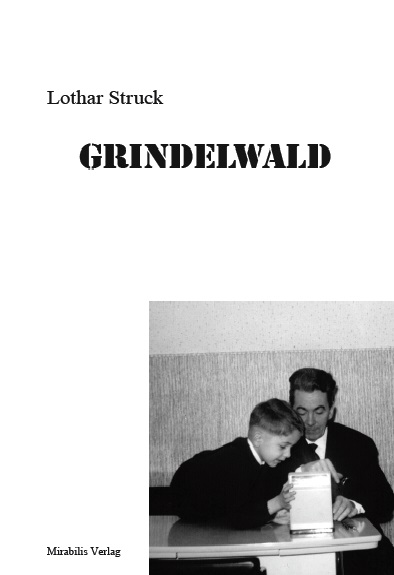
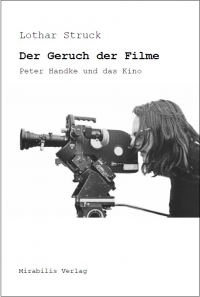
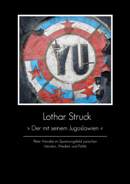
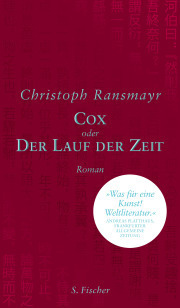
Anscheinend ein typischer Schnellschuss …
… den ich Herbert von Arnim nicht zugetraut hätte. Wenn man sich die derzeitige schwere Vertrauenskrise vor allem der (ehemaligen) Volksparteien ansieht, dann spielen Parteien- und Politikerfinanzierung und das Wahlrecht sicherlich auch eine Rolle. Allerdings lässt sich z. B. die Frage nach der Verfilzung zwischen privatwirtschaftlichen Großunternehmen und staatlichen Organen, die sich z. B. im »Ausleihen« von Experten an Ministerien zeigt, nicht allein auf finanzielle Aspekte herunterbrechen. Auch erstaunt es mich, wenn er offenbar glaubt, es gäbe noch so etwas wie »sichere Wahlkreise«.
Für wirklich gefährlich halte ich seine Aussage, das Grundgesetz beruhe in Wahrheit gar nicht auf dem Willen des Volkes, es sei dem Volk oktroyiert worden. Das entspricht bekanntlich der Argumentation der Neonazis, die sich freudig darauf stürzen werden, dass »sogar ein Arnim« ihnen recht gibt. Ich fürchte, dass es noch weitere Stellen in dem Buch gibt, die sich aus dem Zusammenhang reißen und als Propaganda für ein autoritäres Staatsmodell missbrauchen lassen.
#1
»Kopf ab!«
Ich kenne nicht den gesamten Argumentationszusammenhang, aber was die »Meinung« des Volkes angeht, möchte ich doch mal kurz meine starken Zweifel anmelden. Und das, auch was die vermeintlich aufgeklärteren (oft nur gleiochgültigeren) Stadtmenschen angeht, die jüngeren, gutverdienenden, die »im Leben stehen«… (Gerade die haben oft gar keine Zeit nachzudenken – vielleicht deshalb diese alten Reflexe?)
Siehe Europa-Verdruss. Siehe die Verklärung weiter, auch jüngerer Bevölkerungsteile zur Geschichte ihrer DDR. Siehe die Vorbehalte gegen die »Überfremdung«. (Der »Bahnhof in Türkenhand«, im Zug kassieren Russlanddeutsche ab – und die sind sowieso oft Schuld… jetzt sogar für unseren miesen Ruf in Ägypten – steht ja auch in BILD.)
Zwar nur anekdotisch, aber auch ich tendiere (wieder, mehr und mehr) dazu, die realen Erlebnisse über die abstrakten, oft vom Wunschdenken geleiteten Ideale zu stellen: Im Supermarkt neulich eine Story, die ein paar (gar nicht so ältere) Leute einander erzählten über einen (wg. Lahmarschigkeit und Widersprüche innerhalb der Justiz) frei gelassenen Kinderschänder irgendwo in der Nähe. (Wo, hatte ich leider nicht mitbekommen.)
Die bewusste Urteile mögen bei dem Thema besonders irrational sein (oder vorrational?, als Teil von unreflektierten, »gesunden« Reflexen?).
Ob das Volk teils doch ohne Kopf ist bzw. das Grundgesetz nicht doch ein Teil eines aufoktroyierten Vernunftzusammenhangs – wenn er auch weitgehend eingesehen wird – kann da durchaus von jemanden, der darüber nachdenkt mal in Zweifel gezogen werden. Und das hat massiv zu tun mit dem »Kopf«, also der Politik in einer überkomplexen Welt. Ein Gesetz oder eine allgemeine Konsens- & Verhaltensratio a la Habermas kann große Teile menschlicher Verhaltenslogiken eben doch nicht abbilden. Das Nicht-Diskutierte, das Verfemte aber gärt.
Das ist kein Fürspruch für »Kopf ab!« – Sprüche u.ä. Aber wegdiskutieren kann man dieses »Unbehagen in der Kultur« eben auch nicht. Ich glaube, das Problem ist eher das auszublenden, ganz ähnlich wie Antisemitismus und Nazismus – ich vermute, die sind lebendiger als wir uns zugestehen wollen. Die Barbarei ist immer ganz nah.
#2
@MMarheinecke
Die »sicheren Wahlkreise« listet er seitenweise auf; es sind (natürlich) alle bayerischen und auch sowas wie Cloppenburg für CSU bzw. CDU und auch einige im Ruhrgebiet für die SPD. Seine Aussage geht dahin, dass die Besetzung des Bundestages zu 75% bereits feststeht – entweder über die ‚Besenstiel-Wahlkreise‘ oder über sichere Listenplätze. Ganz von der Hand zu weisen ist diese Feststellung nicht – aber sie würde durch seine Vorschläge nicht unbedingt verändert (sondern vielleicht eher noch zementiert). Ideen wir Begrenzung der Legislaturperioden auf maximal zwei (à fünf Jahre dann vielleicht) oder/und Quoten für offene Listenkandidaten fehlen gänzlich.
@en-passant
Naja, ganz so schwarz sehe ich nicht. Mieser Ruf in Ägypten weil eine Distanzierung oder Verurteilung nicht stante pede erfolgte? Ich finde das lächerlich. Und Frau Merkel besucht die Erdbebenopfer in Italien und verknüpft ihre finanzielle Hilfe mit den Wehrmachtsverbrechen von 1944. Wieviel Ablaß darf es denn sein?
Und dann wieder d’accord, was das Gären des Nicht-Diskutierten angeht. Natürlich ist Europa sozusagen oktroyiert, d. h. es ist ohne Diskurs der Bevölkerung als Heilmittel verkauft worden und sie glauben feststellen zu können, dass es das Gegenteil ist. Und jemand wie von Arnim listet das Geld auf, was die EU-Abgeordneten kosten – ohne aufzulisten, was an sinnlosen EU-Subventionen aufgebracht wird (das nur mit zwei Zeilen). Aber das »Unbehagen an der Kultur« geht nicht weg, nur weil man es leugnet. Es geht aber auch nicht weg, wenn jemand wie von Arnim in rasender Rhetorik je nach Lage für und dann wieder gegen etwas ist – und das in einem Buch. Das ist pure Erzeugung von Unbehagen; das Gegenteil eines Diskurses: Krawallrhetorik.
#3
Es gibt in der Gesellschaft ja durchaus ein Unbehagen angesichts der parlamentarischen Demokratie. Daß die Legitimität der Verfassung infrage gestellt würde, hab ich allerdings noch nicht erfahren müssen. Rein subjektiv möchte ich aber auch nicht wirklich, daß ein Verfassungsentwurf einer gerade ansatzweise entnazifizierten Bevölkerung zur Abstimmung gestellt worden wäre. Die mir bekannten Bedenken richten sich eher gegen die ständigen Korrekturen und Aufweichungen gerade der Grundrechte einerseits und dem Ausbleiben eines gesamtdeutschen Verfassungsprozesses nach der Wende andererseits. von Arnim steckt wohl im Dilemma jedes Autors : er muß – in einem bestimmten Zeitrahmen – nachliefern. Und da schien es schlicht Schlagworte zu geben, die ein neues Buch rechtfertigen, einen Aufhänger also. Und in der Tat gibt es sie ja auch. Europa ist ein unübersichtliches, rechtlich immer noch vieldeutiges Gebilde, und das Spannungsfeld nationaler Souveränität gegen politischer Vereinigung wird uns noch jahrzehntelang erhalten bleiben, auf der gesellschaftlichen Ebene sehe ich wohl noch länger keine wirkliche Akzeptanz der EU und leider auch keine tragenden Versuche, dem seitens der EU, aber auch der Bundesregierung, entgegenzuwirken. Die Frage nach der Legintinität von Koalitionen – und damit von Korrekturen am Wahlprogramm – stellt sich mir überhaupt nicht : Die Wähler wissen um das Wahlsystem und darum, daß dieses meist Kompromisse erforderlich macht, bewußtere Wähler lassen das sogar in ihre Wahlentscheidung einfließen und versuchen, Korrektive zu setzen…. Eine absolute Mehrheit einer im Bundestag vertretenen Partei wäre mir ein Graus….
#4
Einspruch
gerade ansatzweise entnazifizierten Bevölkerung
Das ist – mit Verlaub – natürlich Unsinn. Und worin läge denn die Alternative? Warum hat man in Deutschland Angst vor institutionalisierten Mehrheiten in Deutschland und nicht in den USA oder Frankreich? Als wären hier Weimarer Verhältnisse. (Im Obama-Hype entdecke ich in Wirklichkeit tatsächlich eine Hoffnung auf die »gute Diktatur« – sie trügt.)
Und was ist eine Große Koalition anderes als eine absolute Mehrheit? Eine, die wie man in Österreich sieht, auf Dauer schädlicher für eine Demokratie ist, als Mehrheitsregierungen oder Koalitionen zwischen disparitärischen Partnern.
Anfang der 80er Jahre schien schon einmal die Welt unterzugehen als die Volkszählung anstand – und was haben die Auguren für Szenarien gemalt, die alle nicht eingetreten sind (u. a. weil es ein funktionierendes BVerfG gab).
Interessant, dass man einerseits dem Volk nichts zutraut, andererseits auf Grundrechte rekurriert. Wo ist das Vertrauen – ein grosses Wort – in die Kraft des Arguments, des Diskurses?
Über die Legitimation von Koalitionen gibt es interessante Überlegungen bei Möllers; wobei dieses Buch überhaupt sehr empfehlenswert ist (auch wenn es mir dann manchmal zu optimistisch daherkommt).
#5
Ich meinte, um das klarzustellen, die deutsche Bevölkerung von 1949, nicht die heutige, auch wenn ich Volksentscheide generell skeptisch sehe. Eine jetzt neugefasste Verfassung wäre auch in meinen Augen ohne Bürgerbeteiligung mindestens problematisch – vielleicht hat man deshalb ganz darauf verzichtet.
Eine Große Koalition ist natürlich eine absolute Mehrheit, aber eben auch eine Koalition, die den Durchmarsch eines ungehemmten Parteiprogrammes durchaus verhindern könnte. Daß sie nicht der Idealfall ist, bestreite ich nicht, daß sie bei einer sowieso vorhandenen Annäherung der beiden Volksparteien eher Probleme aufwirft als löst, sei ebenfalls zugegeben. Und eine Dauereinrichtung kann und darf so etwas selbstverständlich nicht sein, weil dann die parlamentarische Demokratie vermutlich erodiert. Verpflichten müßte man aber beide Parteien auf Entscheidungen generell, auf haltbare Kompromisse, die auch danach nur dann geändert werden dürften, wenn es neue Fakten gibt, im besonderen. Derzeit werden Entscheidungen so getroffen, daß sie mit der Wahl einer anderen Koalition eh revidiert werden, um dann eigene Ideologie zu vertreten – siehe Pflege und Krankheit – oder sie werden ganz ausgesetzt, weil man sich nicht einigen will oder kann, oder weil gerade Wahlkampf ansteht. Was diese Große Koalition dauerhaft bewirkt hat, kann man wohl erst geraume Zeit nach deren Ende bewerten. Sollte durch die Wahl im Herbst erneut eine Große Koalition zustande kommen, wäre sie vermutlich instabiler als die jetzt agierende, da die SPD in ihr wohl kein Land gewinnen kann – wie auch jetzt nicht….
#6
Okay,
Du meintest eine Volksabstimmung über das GG 1949. Sorry, das hatte ich anders verstanden.
Von Arnim moniert (natürlich) auch, dass 1990 nicht über eine neue, gemeinsame Verfassung abgestimmt wurde und meldet auch hier verfassungsrechtliche Bedenken an. Auch das halte ich nicht für einen Einwand gegen das Grundgesetz.
—
Ich bin sehr für ein relatives Mehrheitswahlrecht im Bund (und auch in den Ländern), weil die Erfahrung eh zeigt, dass Bundestag und Bundesrat fast immer konträre Mehrheitsverhältnisse aufweisen. Das Verhältniswahlrecht halte ich aus vielen Gründen für schlecht; hauptsächlich deshalb, weil kleine Parteien in Positionen kommen, in denen sie aufgrund ihres Wahlergebnisses nicht gehören.
Sollte es im Herbst zu einer Fortsetzung der GK kommen, so gäbe es im Bundesrat für die FDP eine Vetomöglichkeit – de facto hätten wir eine CDU/CSU/SPD/FDP-Regierung, die irgendwann nichts mehr bewegen kann.
Bedauerlich bei den Koalitionsverhandlungen 2005 war, dass über alle Politikfelder jeweils ein Kompromiss gefunden werden musste und nicht bestimmte Punkte einem Lager sozusagen exklusiv zugeordnet wurde. Das Ergebnis sieht man bspw. in der Gesundheitspolitik – den Gesundheitsfonds will niemand, ist aber das einzige, worauf man sich einigen konnte.
Stimmen die Vorhersagen und rechnet man die österreichischen Verhältnisse mit hinein erodiert die Mehrheit der GK sukzessive je länger sie anhält. in Deutschland wird man 2009 vielleicht noch 63-64% bekommen (statt > 70%); irgendwann nur noch knapp über 50%, usw.
#7
Na, das wäre dann doch heftig, der jetzigen Bevölkerung ein »ansatzweise entnazifiziert« zu bescheinigen. Nee, so bösartig / pessimistisch bin ich denn doch nicht. ;) Und aus meiner Sicht muß es keine neue Verfassung geben, auch wenn ich mir durch den Einfluß der Bedürfnisse Ostdeutschlands eine etwas deutlichere soziale Ausrichtung versprochen hätte. Ich fand das GG vor allem in den 20 ersten Artikeln immer gut, sofern sie durch nachträgliche Änderungen nicht sukzessive beschnitten wurden… (Ich bin allerdings aus dem Westen der Republik, Ostdeutsche haben da vermutlich ein etwas größeres Bedürfnis…)
#8
Das wundert mich kaum, dass:
…« Er kommt einem manchmal wie ein Feldherr vor, der auf dem Schlachtfeld den Sitz der Uniform höher bewertet als die Ausrüstung seiner Soldaten«…. da der auch aus einer Familie stammt die fuer jede hundert Generäle dem Preussenland nur einen Dichter lieferte! Man schau nur nach wie viele von Arnim’s da im dritten Reich noch im Militär waren. Dass das noch bisschen anhält ist zu erwarten. Verwandter 2ten oder 3ten Grades von mir. Einer, der Gerd von, wurde glaub ich Inspecteur der Bundeswehr, er der jüngste und seine drei älteren Brüder -Dedo, Ditloff + Bernd – kamen bei uns ausserhalb Bremen im Herbst 1944 an, per Pferdewagen, aus Mecklenburg,
Anfang meiner »Idyllischen Jahre« die so bis 1947 dauerten. Da waren die Grossmütter, geborene von Einsiedel, Schwestern. Ein von Einsiedel, ein Onkel war dann eine zeitlang der älteste Bundestag Abgeordete und glaub ich eröffnete das Parliament, und gehörte der PDS an!
Ich werde mich später auch über das geringste, oder geringere all der Uebel, der Demokratie, noch auslassen.
#9
Vielen Dank!
Aufgrund Ihrer Rezension bin ich mir nun sicher, dass ich mir dieses Buch nicht zu kaufen brauche.
#10
Tja, wenn man also so viel Geld spart
in dem man von Keuschnig ne gute Rezension liest,
sollte man dann vielleicht ein viertel oder wenigstens ’nen
Zehntel an den Rezenzenten Schicken, man tut’s doch dem
Steuer Berater und anderen Priestern??? Ich denke nur. m.r.
#11
Er erwähnt jedoch nicht, dass diese Gewaltentrennung, die er hier verfechtet, mit dem Prinzip der Gewaltenteilung gar nicht gemeint ist. Ein Anfängerfehler – oder vorsätzliche Täuschung des Lesers?
Vielleicht trübt meine Müdigkeit den Blick, aber im Prinzip ist es doch richtig, dass ein Minister der über sein Gesetzt abstimmt die Gewaltenteilung (teilweise) außer Kraft setzt (selbst wenn es natürlich richtig ist, dass die Abgeordneten der eigenen Partei »befangen« sind), denn es geschieht doch genau das, was man verhindern will, nämlich dass sich zuviel Macht einer Hand sammelt (wenn man das eine Mandat als Anfang sieht).
#12
Gewaltenteilung heisst nicht Gewaltentrennung. Natürlich darf das Gremium, welches die Gesetze formuliert nicht alleine über sie beschliessen. Aber als Bestandteil des Parlaments können sie durchaus zustimmen. Wo setzt man denn den Hebel an? Beim Vorsitzenden eines Ausschusses, der mit dem Minister und dessen Stab das Gesetz erarbeitet hat? Darf der als Abgeordneter auch nicht abstimmen? Wenn Gewaltentrennung das Prinzip wäre, dürften ja tatsächlich die Abgeordneten der Regierungspartei(en) nicht abstimmen. Umgekehrt müsste ja dann ein Abgeordneter, der zum Minister ernannt wird, sein Mandat niederlegen.
Ich sehe die Problematik im Arbeitsaufwand und in der Vergütung durchaus – aber das hier Rechtsstaatsürinzipien verletzt werden, halte ich für reinen Alarmismus.
Moderne Staatstheoretiker gehen heute eher davon aus, dass die Gewalten über die Positionen Opposition und Regierung geteilt und auch getrennt werden.
#13
Vielleicht liegt es an den Begrifflichkeiten (eine Teilung kann ja durchaus Trennung bedeuten).
Parlamentarismus kann anders eigentlich nicht funktionieren, denn sonst müsste die Opposition Gesetze beschließen.
Moderne Staatstheoretiker gehen heute eher davon aus, dass die Gewalten über die Positionen Opposition und Regierung geteilt und auch getrennt werden.
Das überzeugt mich nicht recht. Theoretisch vielleicht, aber da bis zur nächsten Wahl mitunter viel Zeit ist, kann die Opposition nicht allzu viel machen, außer Kritik üben und Missstände aufzeigen. Aber was dann? Einen Misstrauensantrag stellen? Um für den eine Mehrheit zu bekommen, ist das Gewissen der Abgeordneten (der Regierungsfraktion) entscheidend.
#14
@Metepsilonema
Ich habe im Beitrag einen Aufsatz verlinkt, der die These ein bisschen illustriert.
Wie funktioniert denn die Gewaltenteilung zwischen Parlament und Regierung? Das Parlament ist doch in der Praxis auch nicht »neutral«, weil es doch aus Abgeordneten auch der Regierungspartei(en) zusammengesetzt ist. Zwar gibt es kein imperatives Mandat, aber wie sieht es denn tatsächlich mit der Gewissensfreiheit des Abgeordneten aus? Was, wenn entscheidende Abstimmungen inzwischen namentlich stattfinden? Beispielsweise gestern, als in Schleswig Holstein über die Auflösung des Landtags abgestimmt wurde. SPD-»Abweichler« hatten aufgrund des Abstimmungsverfahrens (per Handheben) keine »Chance«; dieser kampfhundähnliche SPD-Chef dort hätte die gleich exekutiert.
Du hast recht wenn Du sagst, dass eine Kontrolle durch die Opposition dahingehend nicht konsequent funktionieren kann, weil diese ja immer in der Minderheit ist. Dennoch nicht ausgesagt, dass die Regierunsgabgeordneten »Stimmvieh« sind. Opposition bedeutet ja auch: Auf einer anderen parlamentarischen Ebene (in Deutschland durch den Bundesrat) Kontrolle auszuüben.
Was ist mit der Gewaltenteilung wenn es um die Ernennung von Justizbeamten oder Richtern geht? Werden hier nicht auch Grauzonen betreten, die der »reinen Lehre« widersprechen?
Die Idee der Gewaltentrennung stammt aus einer Zeit, da es keine Kontrolle für die Regierung (die meist autokratisch agierte) gab. Das Prinzip ist immer noch richtig und wichtig. Ich sehe nur nicht dadurch gefährdet, dass vier oder sechs Minister auch gleichzeitig Abgeordnete sind und über ihre eigenen Gesetzentwürfe mit abstimmen. Ich sehe es eher durch das stillschweigende Voraussetzen eines imperativen Mandats gefährdet – was von Arnim nur in zwei Nebensätzen innerhalb von fast 400 Seiten anklingen lässt.
Die Kontrolle der Regierung durch des Parlament bedarf anderer Überlegungen als sie in dem Buch geäussert werden. Daher sprach ich polemisch von einem »Anfängerfehler« von Arnims, der eine Formalie kristisiert statt das Problem in der Breite zu erfassen.
#15
Ja, den habe ich gelesen (den verlinkten Abschnitt). Mein Problem damit ist, dass er kantig und umständlich geschrieben ist: Ich verstehe den Autor nicht in jeder Hinsicht.
Den Bundesrat habe ich vergessen, richtig. Trotzdem – aber da sind wir einer Meinung -, wäre mehr Abstimmungsfreiheit für Abgeordnete wünschenswert, und zugleich müsste man den Einfluss aller Parteimitglieder (»der Basis«) stärken, und ihnen maßgeblichen Einfluss auf die Reihung und Aufstellung der Abgeordneten zu ermöglichen. Denn nur dann ist die größte Schwierigkeit (die Nichtberücksichtigung für die nächste Wahl, wobei die Bekanntheit eines Abgeordneten ihr entgegensteht) seine abweichende Meinung auch zu vertreten abgeschwächt, bzw. ausgeräumt.
Sonst hast du natürlich recht, von Arnim macht aus einer Maus einen Elefanten.
#16
Wie kann man die Abstimmungsfreiheit stärken?
Mein erster Reflex: Alle Abstimmungen geheim zu machen. Dann habe ich gelesen: Man will mehr Transparenz und wissen, wie »mein« Abgeordneter abgestimmt hat. Auch wieder nachvollziehbar. Dann aber muss an überlegen: Es ist nicht »mein« Abgeordneter – er hat kein imperatives Mandat vom Wähler, sondern ist nur seinem Gewissen verantwortlich. Diese Gewissensentscheidung kann jedoch durch die geheime Abstimmung pervertiert werden (»Rache«).
Meines Erachtens kommt nur eine Mischung aus mehren Punkten infrage:
– Über essentielle Entscheidungen ist geheim abzustimmen.
– Abgeordnete sind nur für maximal drei Wahlperioden à je 4 Jahre wählbar.
– Es darf nach dem Mandat fünf Jahre keine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt werden, die mit dem vorangegangenen politischen Mandat in Verbindung zu bringen ist.
– Das Wahlrecht wird verändert (ich bleibe mal dabei; trotz aller Einwände, die ich durchaus sehe).
– Es wird ein Quorum für parteilose Kandidaten eingeführt.
– Abgeordneten sind alle anderen Tätigkeiten untersagt. Also keine Aufsichtsrat- oder sonstigen Posten. Dafür erhalten sie eine hohe Vergütung – allerdings ohne Pensionsansprüche.
#17
Welche Abstimmungsfreiheit?
Im Prinzip würde ich dies auch bevorzugen. Die Praxis sieht aber heute meistens anders aus, da die Komplexität der Fragen häufig so hoch ist, dass nur ausgewiesene Fachleute in der Lage sind, relevante Aussagen zu machen. In den seltensten Fällen wird dies ein Abgeordneter können, so dass Fremdinteressen in Form von Beratern auf diesem Wege immanent beteiligt sind. Bei verwaltungsrechtlichen Fragen könnte dies meist noch von Mitarbeitern der Ministerien bewerkstelligt werden. Bei den zukunftsweisenden Entscheidungen handelt es sich aber selten um rein politische oder verwaltungstechnische Fragen wie noch zu Zeiten Adenauers oder Brandts. Vielleicht ist es das, was einen Mißfelder produziert.
Und wie viel kommt davon noch beim Wähler an? Bei welchen Fragen kann sich der 08/15-Wähler noch eine eigene Meinung bilden, wie z.B. bei der Ostpolitik? Eigentlich bei den wenigsten, was natürlich direkt zu Politikverdrossenheit führen muss, wenn keine Kausalzusammenhänge von Politik und Realität mehr erkannt werden können. Ich hatte ja gelegentlich angedeutet, dass ich auf Grund des geringen Kenntnisstandes des Wahlvolkes die Demokratie im wesentlichen für Augenwischerei halte, die nur das Abgeleiten in die Extreme verhindern kann. Ich behaupte, dass nicht mal ein Promille der Wähler bei den relevanten Themen wie Energie, Gesundheit/Pflege, Rente, Finanzen und Außenpolitik auch nur oberflächliches Wissen hat.
#18
@Peter42
Die Landtagsabgeordneten von NRW erhalten ja bereits relativ hohe Diäten – und müssen dabei ihre Altersversorgung selber vornehmen.
Das Problem des Expertentums existiert zweifellos – was ja noch eher dafür spricht, dass Abgeordnete sich nicht noch in Aufsichtsräten tummeln sollen. Der Grad einem gewissen Lobbyismus nicht zu erliegen ist sicherlich schmal; im Zweifel ist es einfacher, den sich anbietenden »Experten« zu nehmen statt nach einem unabhängigen zu suchen. Das Problem dürfte inzwischen sein, dass der Begriff des »Experten« nicht geschützt ist – man sieht ja in der Banken- und Finanzwelt, was diese Leute für Einschätzungen abgegeben hatten.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Komplexität, die man immer so proklamiert nicht auch ein bisschen Flucht vor dem einfachen Handeln darstellt. Natürlich ist Atomkraft bzw. Atomenergie ein komplexes Thema. Aber es lässt sich, wenn man es möchte, »herunterbrechen« auf entscheidende und auch einfache Fragen – die der Entsorgung bspw. und der Behandlung der zu entsorgenden Produkte. Keine Imbißbude in Deutschland darf ihr abgelaufenes Öl einfach in den Ausguss kippen – insofern sind bestimmte Sachen meines Erachtens in der Konsequenz recht einfach.
#19
Das Für und Wider der Atomkraft wäre mir gar nicht eingefallen, da alle wesentlichen Argumente seit Jahren auf dem Tisch liegen.
Was ist aber mit der langfristigen Energiestrategie? Die schwierige Integration der alternativen Energien in einem Industrieland, die Anteilnahme am kleiner werdenden Kuchen der fossilen Energieträger mit all seinen Folgen für die Außenpolitik, der Konflikt zwischen Klimapolitik und Energieverbrauch und schlussendlich auch der Konflikt zwischen Energieeinsparung und Bruttosozialprodukt. All das unter einen Hut zu bekommen, ist eine Herkulesaufgabe die sowohl enormes Wissen aus vielen Kategorien, als auch strategisches Denken verlangt. Und das verlangt von den Politikern auch Fähigkeiten die allgemein dramatisch besser bezahlt werden (so fühlt sich wahrscheinlich momentan ein bulgarischer Europaabgeordneter).
Das hilflose Rumgekrümmel Steinmeiers z.B. ist da eher peinlich. Es ist eben die Kunst der Politik, das Thema zu erkennen, das man aus den vielen herausgreift und dem Wähler präsentiert. So wie die FDP das monothematische Steuersenken noch als hilfreich gegen Läuse propagiert, sehen wir bei der SPD gerade das Themenhopping. Da sind deine Forderungen schon sehr viel weiter.
#20
@Gregor
Grundsätzlich kann man nicht erwarten, dass man einen Rahmen schaffen kann, der Missbrauch oder Unzulänglichkeiten völlig abschafft – was man aber tun kann, ist ihn zu verbessern und sie weniger wahrscheinlich machen. Deinen Vorschlägen stimme ich zu, wobei ich Wahlrechtsfragen davon unabhängig diskutieren würde. Bei der zeitlichen Einschränkung der Abgeordnetentätigkeit gebe ich zu bedenken, dass 12 bzw. 15 Jahre zwar einen langen Zeitraum darstellen, der aber auch ein Hemmschuh sein kann: Für jemanden der sich dazu berufen fühlt, der länger bleiben möchte, der seine Sache tatsächlich gut macht – und: Wer weiß, dass er bald wieder »raus« ist, beginnt erst recht Kontakte zu knüpfen, und nebenbei tätig zu werden. Andererseits kann er in andere Gremien, an andere Posten gelangen oder ins Europaparlament wechseln.
Für sehr wichtig halt ich (was Du mit dem Quorum auch indirekt ansprichst), dass das Nachrücken von neuen Kandidaten bzw. der Wettbewerb erleichtert wird (man erhält auf die Frage nach dem politischen Tätigwerden immer wieder Antworten, dass man sich Parteistrukturen beugen muss, und keine Chance hat in die Listen zu gelangen). Das spräche dann wieder dafür die Abgeordnetenzeit zu beschränken.
@Peter42
Demokratie braucht Zeit (um etwas Werbung in eigener Sache zu machen).
Grundsätzlich gilt: Je genauer man sich mit einem Problem beschäftigt, desto komplizierter wird es, und desto mehr Zeit muss man investieren.
Demokratie ist (auch) eine Bringschuld. Der Bürger sollte sich mit Politik befassen, und zwar in dem zeitlichen Rahmen der ihm zur Verfügung steht. Er muss nicht über alles bescheid wissen (er ist ja nicht alleine), und nicht alle Details kennen: Man kann Probleme herunter brechen (wie Gregor schon festgestellt hat), es gibt Medien über die man sich informieren kann, und politische Programme zu lesen – das ist m.E. mehr eine Frage des Wollens denn des Könnens (wenn wir vom Zeitaufwand einmal absehen). Das Bilden einer eigenen Meinung ist durch die viel größere Verfügbarkeit an Quellen heute leichter denn je (was schwieriger wurde ist die Verlässlichkeitsprüfung von Quellen).
Was die Problematik der externen Experten und Berater angeht: Politik stellt ja auch etwas wie einen Interessensausgleich dar: Man darf sich nicht immer auf nur einen Experten verlassen bzw. kann man jemand der eine gegenteilige Meinung vertritt hinzuziehen. Schlecht ist nicht die Präsenz von Interessen, sondern deren ungleiche Gewichtung.
#21
@Metepsilonema
Ich finde, 12 Jahre sind eine lange Zeit (15 wäre mir schon zuviel), wobei eine »Verschiebung« hin zu einem anderen Parlament ausgeschlossen sein müsste.
Den Zeitraum noch enger zu begrenzen halte ich für problematisch. Wir verlangen auf der einen Seite, dass sich Politiker in ihre Ämter einarbeiten – andererseits sollen sie aber keine »Berufspolitiker« sein. Damit der Effekt der Postenbeschaffnung nicht zu früh eintritt, sollte eine gewisse »Sicherheit« gegeben werden.
Das Thema »Bringschuld« des Bürgers halte ich für einen sehr wichtige Komponente, die leider sehr oft vernachlässigt wird. Deine These, dass Demokratie Zeit braucht, stimmt zwar, aber ich würde sie gerne ein bisschen abgewandelt sehen: Demokratie braucht Priorität! Wobei ich nichts dagegen habe, wenn eienr sagt, er hat kein Interesse an Politik bzw. kein Interesse, sich mit Politik zu beschäftigen. Dann sollte er jedoch m. E: gleichzeitig das Jammern und lagen über »die« Politker bleiben lassen. Entweder – oder. (Wobei ich noch nicht einmal über die Bereitschaft rede, sich in die »Ochsentour« der Parteien einbinden zu lassen – das ist in der Tat sehr bedenklich und dass man hiervor zurückschreckt, kann ich sehr gut verstehen.)
@Peter42
Metepsilonemas letzter Satz »Schlecht ist nicht die Präsenz von Interessen, sondern deren ungleiche Gewichtung.« finde ich sehr wichtig. Er ist in der Konsequenz sehr nah an Möllers‘ Thesen. Ich halte Lobbyismus per se nicht für schlimm – normalerweise müsste es reichen, ihn als solchen zu erkennen und dann richtig gewichten zu können. Auch Greenpeace betreibt Lobbyismus – es ist nur sehr geschickt, wie dieser in der Öffentlichkeit (1.) gar nicht als solcher wahrgenommen wird und (2.) als »gut« gilt.
#22
@Gregor
Es geht mir nicht um Lobbyismus, der neben seinen hässlichen Seiten ja auch einfach Informationsgewinn bedeuten kann. Die Anforderungen an den Abgeordneten dies nur in diesem Sinne zu nutzen, sind aber fast schon übermenschlich. Es geht mir um die Fälle, bei denen die Gesetzestexte direkt von Mitarbeitern der betroffenen Firmen geschrieben wurden, da die Kompetenz in der Politik einfach nicht mehr vorhanden war (und damit erst recht nicht beim Wähler). Das ist nicht mehr gesund und wird in Zukunft auf Grund der komplexer werdenden Welt vermutlich öfter der Fall sein.
@Metepsilonema
Danke für den Link. Mein Menschenbild sieht jedoch deutlich düsterer aus, da du davon ausgehst, dass eine Zumutung prinzipiell akzeptiert wird. Ich glaube aber große Teile der Bevölkerung erhalten nur eine Informationmenge, wie man sie gerade nicht vermeiden kann.
Könnte man die Sprünge der Aufmerksamkeit messen, die Leistungen der Augenmuskeln, die Pendelbewegungen der Seele und alle die Anstrengungen, die ein Mensch vollbringen muß, um sich im Fluß einer Straße aufrecht zu halten, es käme vermutlich … eine Größe heraus, mit der verglichen die Kraft, die Atlas braucht, um die Welt zu stemmen, gering ist, und man könnte ermessen, welch ungeheure Leistung heute schon ein Mensch vollbringt, der gar nichts tut. Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften
In einer Gruppe von ca. vierzig Menschen meist höherer Bildung z.B. wurde eine Woche vor der Europawahl gefragt, welche Währung in Kroatien gilt. Keiner wusste es, was nicht schlimm ist. Es wusste aber auch keiner, ob Kroatien Mitglied der EU ist. Man war der Meinung, dass auch Länder außerhalb der EU den Euro eingeführt haben. Die abenteuerlichsten Thesen mal ganz außen vor gelassen. Pars pro toto.
Noch ein kleines Beispiel meiner Demokratiemüdigkeit: In meiner Heimatstadt wollte die Stadt Versorger privatisieren. Der Widerstand war groß und ein Bürgerentscheid schmetterte dies ab. Zwei Jahre später meinte die Stadt es wäre an der Zeit eine erneuten Versuch zu wagen, was aber wieder mit diesmal knapper Mehrheit nicht gelang. Weitere zwei Jahre später war die Wahlbeteiligung so gering, dass Wasserwerk etc. verkloppt werden konnten. Mittlerweile ist klar (wie zu erwarten), dass es sich nur um ein Strohfeuer im Haushalt handelte und die Folgekosten für die Bürger groß sind. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass weitere zwei Jahre später nicht abgestimmt wurde, ob die Versorger wieder von der Stadt übernommen werden sollten. Das war im Kleinen. Im Großen ist es dann die Abstimmung der Iren die nicht passt und einfach nach Schamfrist wiederholt wird (als Frankreich so abstimmte, ging das nicht). Auch eine gewählte Hamas oder ein gewählter Ahmadinedschad darf getrost als illegitim behandelt werden. Nicht das diese Wahlsieger angenehm wären. Aber wenn man schon Wahlen fordert, sollte man auch mit den Ergebnissen leben können.
#23
@Gregor
Demokratie braucht Priorität! Selbstverständlich, aber ich wüsste nicht wie man sich ihr anders als über die Zeitproblematik nähern sollte. Hast Du eine andere Idee bzw. einen anderen Zugang?
@Peter
Demokratie verkraftet, dass sich nicht jeder um Politik kümmert, allerdings sollte das schon eine deutliche Mehrheit tun (Information muss auch immer so dosiert sein, dass sie den Empfänger nicht lahmlegt, d.h. kleine Dosen sind eventuell besser als zu große – schönes Zitat!). Ich glaube schon, dass Menschen Zumutungen akzeptieren können, wenn sie diese als Notwendigkeit einsehen (außerdem ist Demokratie ja nicht nur Zumutung). Falls dem nicht so ist, dann ist in der Tat fraglich, ob Demokratie funktionieren kann, und damit sind wir auch schon bei der Systemfrage: Was kann eine brauchbare Alternative sein? Ich stehe da ziemlich ratlos da (was aber durchaus nichts bedeuten muss). Ich verstehe auch gut, dass man demokratiemüde sein kann, und ich selbst sehe immer wieder, dass mein Wissen und meine Bemühungen nicht ausreichen. Aber wofür reichen sie nicht? Um ein Ideal zu erfüllen? Dann sollte uns das vielleicht sogar ein wenig positiv stimmen. Oder man fragt anders herum: Welches System bietet die geringsten Nachteile?
Richtig ist, dass Abstimmungen zu Farce werden, wenn man so oft abstimmen lässt bist das Ergebnis passt, da darf sich kein Mensch wundern, dass viele europamüde sind. Gab es bei der Abstimmung in Deiner Heimatstadt keine Verbindlichkeit (das wundert mich, zwei Jahre sind kein Zeitraum der eine neue Abstimmung rechtfertigen würde)?
Es geht mir um die Fälle, bei denen die Gesetzestexte direkt von Mitarbeitern der betroffenen Firmen geschrieben wurden, da die Kompetenz in der Politik einfach nicht mehr vorhanden war (und damit erst recht nicht beim Wähler).
Es wäre wichtig zu wissen, ob das den Abgeordneten tatsächlich nicht bewusst war, oder ob sie den Lobbyismus gebilligt haben (z.B. weil er ihren eigenen Interessen und Ansichten entsprach oder sie sich Vorteile bei Wahlen erhofften; hier ein schönes Beispiel).
#24
@Metepsilonema – Priorität und Zeit
Zeit ist zu ungenau. Man kann sicherlich ganz schnell nachweisen, dass der »normale« Bürger viel mehr »freie« Zeit (= Zeit, in der er nicht mittel- oder unmittelbar für seinen Lebensunterhalt zu sorgen hat) zur Verfügung hat als bspw. noch in den 1950er Jahren. Diese freie Zeit führt jedoch nicht zwangsläufig zu einem Mehr an bspw. kultureller oder politischer Beschäftigung. Stattdessen hat eine Freizeitindustrie die »Verwaltung« dieser freien Zeit übernommen – Stichwort Eventkultur. Das Fernsehen, anfangs als Bildungsmedium gedacht (nicht Erziehungsmedium übrigens; das wird gerne verwechselt), hat hier kläglich versagt (was teilweise Schuld der Politik ist).
Die Leute haben mehr freie Zeit, verbringen diese jedoch mitnichten mit dem Lesen politischer Hintergründe oder hochgeistiger Literatur. Das Problem ist natürlich bekannt. Die Verlockungen de Freizeitindustrie sind einfach zu gross. Die Beschäftigung mit Politik hat keine Priorität.
Dein Diktum: Demokratie braucht Zeit bleibt natürlich richtig. Aber alle »Einrichtungen« von Zeit sind dahingehend gescheitert, dass man eben nicht die Parteiprogramme liest oder sich über alternative Energien informiert, sondern lieber auf die Kirmes geht oder ein Fussballspiel konsumiert.
Ich glaube, dass das Zeitargument letztlich eine Ausrede derjenigen ist, die ihr Desinteresse damit verbrämen.
Peter42 antworte ich noch separat
#25
Die Frage ist immer wer mit dem »normalen Bürger« gemeint ist: Ein Student? Ein Pensionist? Eine allein stehende Mutter? Eigentlich habe ich dazu vor einiger Zeit einen Artikel angedacht. Mal sehen…
Aber ich verstehe Dich schon, ich saß z.B. Freitag abends mit Freunden zusammen: Die ganzen drei Stunden fiel kein einziges Wort über Politik.
#26
Die ganzen drei Stunden fiel kein einziges Wort über Politik.
Das finde ich in der Konsequenz gar nicht so schlimm. D. h. wenn es eine Entscheidung bewusst gegen Politik ist. Was mir missfällt ist diese Anspruchshaltung, die Leute an die Politik hegen, aber selber nicht bereit sind, hierfür auch etwas einzubringen (= Bringschuld!).
#27
Ja und nein.
Existiert die Bringschuld streng genommen nicht generell und für jeden (Bürger)?
#28
@Peter42
Es gibt zwei Probleme, die Du ansprichst.
Zunächst sagst Du: Ich glaube aber große Teile der Bevölkerung erhalten nur eine Informationmenge, wie man sie gerade nicht vermeiden kann.
Das mag ja sein, aber verantwortlich hierfür ist der Bürger selber. Er hat nämlich tatsächlich (in den meisten Fällen) die Möglichkeit seine Informationen zu vervollständigen, zu aktualisieren, zu diversifizieren und zu klassifizieren. Dies jedoch setzt ein irgendwie geartetes Engagement oder auch nur ein Interesse voraus. Wenn dies fehlt (siehe unten zum Thema Demokratie und Zeit) ist das gar nicht schlimm – aber dann sollte man weder das grosse Klagen beginnen, noch – und ich weiss, was ich sage – sich an Wahlen beteiligen. Ich halte es tatsächlich für sinnvoller, wenn bei einer Wahl nur die Leute abstimmen, die ein Interesse an politischen Ereignissen haben. Der Appell, doch bitte zur Wahl zu gehen, nur um dann »zur Wahl zu gehen«, geht mir nicht von den Lippen; ich halte ihn für falsch. (So ganz würde ich eine Art »Wahlqualifikation« nicht ablehnen, in der der Stimmberechtigte einige elementare Fragen zu beantworten hat, bevor seine Stimme gewertet gibt – dies ist jedoch mit dem Gleichheitsgrundsatz unter den heutigen Gesichtspunkten, wie dies interpretiert wird, nicht zu machen.)
Zum Thema Volksabstimmungen und die »unbequemen Mehrheiten« liesse sich viel sagen. Nur soviel: Das Thema ist ja nicht neu. In der Schweiz wurde relativ oft der Beitritt der Schweiz zur UNO diskutiert. Dann gab es eine Abstimmung – sie ging negativ aus. Ein paar Jahre später wurde wieder darüber abgestimmt und siehe, plötzlich gab es (wenn ich mich recht erinnere eine knappe) Mehrheit dafür. Merkwürdigerweise kommt jetzt niemand mehr auf Idee für ein Referendum, den Austritt aus der UNO zu fordern.
Gar kein Zweifel daran, dass die Demokratie Schaden nimmt, wenn die Wahl der Bürger ignoriert wird bzw. so lange gewählt wird, bis die Gegner kapitulieren und das Ergebnis »stimmt«. Es kann natürlich sein, dass sich zwischenzeitlich andere Argumente ergeben haben, die eine erneute Abstimmung rechtfertigen könnten. Das Problem wäre evtl. zu lösen, wenn die Sachverhalte, über die abgestimmt würde, in gleichem Maße zeitlich fixiert wären, wie beispielsweise die Legislaturperiode. Wenn es also eine Abstimmung für oder wider den verkauf des Wasserwerks gibt, dann ist die Entscheidung – egal wie sie ausfällt – für vier Jahre bindend.
@metepsilonema – Bringschuld
Sie existiert, aber sie kann höchstens moralisch eingefordert werden. Mein Vorschlag oben (Stichwort »Wahlqualifikation«) widerspräche dem Gleichheitsgedanken, den wir derzeit konsensuell pflegen. Langfristig kommen wir aber nicht drumherum, Leuten, die diese Bringschuld nicht in irgendeiner Form erbringen und nachweisen können, von grundlegenden Entscheidungen zunächst einmal auszunehmen. Aber dieses Thema ist heikel.
#29
@Gregor
Ich fürchte fast, dass alle Versuche diese Bringschuld »einzufordern« scheitern müssen, bzw. eher das Gegenteil bewirken, denn so bald man beim Test durchfällt, wird man antworten: »Wenn man mich nicht haben will dann eben nicht…« – oder ohnehin über die Eignungsprüfung erbost sein.
#30
@metepsilonema
Ich glaube nicht, dass sich die Systemfrage stellt. Durch die Globalisierung hat sich aber bei uns eine Schieflage ergeben, auf die reagiert werden muss. Solange noch jedes Jahr mehr zu verteilen war, wurde die systemimmanente Ungerechtigkeit nivelliert. In der heutigen multiplen Mangelwirtschaft tritt dies viel deutlicher zu Tage und erfordert eine Lösung. Man ersetze schon mal in den Kampfliedern Arbeiter durch Dienstleister.
@Gregor
Schwierig. Es ist ja kein neues Problem, dass gerade die gemäßigt linken Parteien ein Mobilisierungsproblem haben. Das Ergebnis einer Wahl wird unter der Annahme der fehlenden Wichtigkeit für Teile der Bevölkerung immer nicht repräsentativ sein. Die Schuldfrage kann meiner Meinung nach dabei nicht nonchalant den Menschen selber geben werden, wenn sie nie in der Lage waren diese Schuld so zu erkennen. Das erinnert mich an diese fantastische Öffnung des Telekommunikationsmarktes, bei der man Oma Kawupke an den Kopf schmeisst, dass sie doch hätte erkennen müssen, dass sie zwischen 20:00 und 21:00 Uhr an Werktagen mehr telefoniert als Sonntagsmorgens in Entfernungen zwischen 100 und 150 km. Wenn man durch ein Handicap noch benachteiligt wird und damit einen sich selbstverstärkenden Prozess hat, wird die Schuldfrage problematisch.
#31