Ja. Und Nein. Jörg Magenau gelingt mit seinem Buch »Princeton 66« das Kunststück, aus leidlich bekannten Quellen eine packende und konzise Zeitreise zu komponieren, die sowohl die Stimmung der Tagung präzise rekonstruiert, als auch historische Einordnungen vornimmt. Dabei geht er chronologisch vor, auch wenn es gelegentliche zeitgeschichtliche Einschübe gibt, die, wie sich zeigt, notwendig sind.
Praktisch von der ersten Seite an wird der Leser hineingesaugt. Man spürt die Lust und die Akribie des Autors sich durch die Aufzeichnungen der insgesamt 31 Lesungen (nebst Diskussionen), die allesamt auf der Webseite der Princeton-Universität im Original gespeichert sind, durchgehört zu haben. So erscheinen einige dieser 50 Jahre alten Texte plötzlich in erstaunlicher Frische. Magenau erzählt beispielsweise über das (eher steife) Drama von Walter Jens, betont die Brisanz des erotisch-deftigen Grass-Gedichts und begeistert sich für die Militär-Satire »Feinde« von Reinhard Lettau, die die gesamte Struktur des militärischen Denkens für immer ad absurdum führe. Man scheint förmlich die Erzählung des grundsympathischen Peter Bichsel, das mühsame Lesen von Helga M. Novak oder Handkes Hauptsatzaneinanderreihung zu hören. Ähnliches mit den Reaktionen der Kritik: Der gut geölte Joachim Kaiser; Walter Jens, dem Wortzerteiler aus Tübingen, der nach seinem Vortrag ganz schnell wieder die Rolle des Kritikers übernahm. Hans Mayers geschliffene Formulierungen. Dann Marcel Reich-Ranicki, ein Grobmotoriker des Urteilens, stets für Heiterkeit und gute Laune sorgend, nicht zuletzt weil er allen Rednern recht gab, um allen zu widersprechen. Und der junge Hellmuth Karasek, der sich Mühe gab, immer ein wenig klüger zu wirken als er war – wogegen nichts zu sagen wäre, denn das trifft ja auf alle zu, bei ihm merkte man es aber.
Natürlich blickt Magenau auch auf die Anfänge zurück. Ein paar (angehende) Schriftsteller hatten sich kurz nach der Ur-Katastrophe des Zweiten Weltkriegs zusammengefunden. Sie lasen sich ihre Texte vor, über die dann geredet wurde. Sie wussten nicht so genau, was sie wollten, nur was sie nicht wollten. Die Gruppe, das war vor allem Hans Werner Richter, der aufgeklärte Despot, der seine Einladungskarten schrieb und die wenigen ungeschriebenen Regeln verordnete: Einer las und hatte danach schweigend die Kritik zu ertragen. Nichts Grundsätzliches sollte diskutiert werden, nie ad hominem. Es sollte immer um den Text gehen. Richter war Diskussions- und Veranstaltungsleiter. Als die Gruppe zerbrach konnten alle Fehler und Versäumnisse an ihm festgemacht werden. Und die anderen strichen den Ruhm ein, den sie durch die Gruppe erreicht hatten.
1966 war die informelle Gruppe in der Öffentlichkeit längst zu einer Institution verklärt worden, aber, wie Magenau richtig anmerkt, es war nicht die Gruppe 47, die sich ins Bedeutungshafte hinaufstilisierte, das besorgten vielmehr und viel gründlicher ihre politischen Gegner, die den Schriftstellern die Gelegenheit boten, sich für unverzichtbar zu halten. Wobei man ergänzen könnte: Dies galt nicht nur für die politischen Gegner, sondern auch für diejenigen Schriftsteller, die nicht die »Gnade« Richters spürten und eingeladen wurden. Sie arbeiteten sich an der Gruppe ab. Auch heute noch äußern Schriftsteller und solche, die sich dafür halten, wohlfeile Kritik. Sie suchen und finden zum Beispiel Antisemitismus oder thematisieren Richters Abneigung, Exilanten in die Gruppe aufzunehmen. Auf beides geht Magenau ein; das erste verwirft er schlüssig, dem zweiten stimmt er zu, erklärt es als Generationen- und Ästhetikproblem und benennt die Ausnahmen, in denen Richter sehr wohl um Exilanten geworben und diese auch eingeladen hatte (Hermann Kesten, Walter Mehring).
Klar war: Was sich in der Gruppe 47 versammelte, war das andere, bessere Deutschland, davon waren sie insgeheim überzeugt. Von Jens‘ NSDAP-Mitgliedschaft und Grass‘ Waffen-SS-Abenteuer wusste man nichts (oder wollte es nicht wissen). Und niemand wusste etwas von politischer Korrektheit, aber man verhielt sich schon so, als würde man sie kennen. Es gab Proteste wegen des Austragungsortes Princeton. Schließlich führten die USA einen Aggressionskrieg in Vietnam. Aber Richter blieb dabei, nahm die Einladung der Universität an. Daraufhin fehlten einige wichtige Gruppenmitglieder: Alfred Andersch, der mit Richter zusammen die Gruppe aufgebaut hatte, Heinrich Böll und Martin Walser. Auch Günter Eich war nicht dabei, was Richter besonders schmerzte. Ingeborg Bachmanns Absenz hatte vermutlich keine politischen Gründe. Die eingeladenen DDR-Autoren bekamen keine Ausreiseerlaubnis. Immerhin: Richter hatte 50.000 Dollar von der Ford-Foundation losgeeist. Damit konnte man die 80 eingeladenen Personen gut versorgen. Und es war offiziell kein Geld vom amerikanischen Staat, was die anderen, teilnehmenden Kritiker (Weiss, Lettau, Enzensberger) beschwichtigte. Dass die Ford-Foundation angeblich dem CIA nahestand wurde geflissentlich übergangen – besser war es, nicht so genau nachzufragen.
Ausgiebig und kenntnisreich die Ausführungen über den dauerhaft schwelende Konflikt über die Wechselwirkungen zwischen Literatur und politischem Engagement. Für Richter gab es eindeutig getrennte Räume: Auf der Tagung ging es um Ästhetik; Politik war davor und danach. Die Gruppe war für Richter kein Verein. Für die Dauer eines Treffens redeten Einzelwesen miteinander über Literatur. Als Weiss öffentlich eine politische Stellungnahme mit einem »Wir« statt mit »Ich« abgab, wurde er dafür von Richter gerügt und musste am nächsten Tag widerrufen.
Magenau zeigt, wie der Aufwand, die unterschiedlichen Kräfte innerhalb der Gruppe in der Balance zu halten, immer größer wurde. Die Dissense zeigten sich an den unterschiedlichen Biographien der Protagonisten. So waren die beiden Migranten Erich Fried oder Peter Weiss, die beide nicht in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren sondern im Ausland lebten, naturgemäß skeptischer, was die politische Entwicklung Deutschlands anging als ein Günter Grass, der der Institution SPD vertraute und sich (wie Richter) kopfüber in die Realpolitik stürzte. Während Walsers Sozialismuspose nur kurz erwähnt und Grass‘ Engagement spöttisch kommentiert wird, zeigt Magenau für Peter Weiss große Sympathien, vor allem was seinen Versuch angeht, den Auschwitzprozess, wie kein anderer es gewagt hatte, formal und ästhetisch zu verarbeiten. Auch im ähnlich gelagerten Streit zwischen Enzensberger und Weiss, der um die Notwendigkeit einer politischen »Bekenntnispflicht« eines Literaten kreiste, die Enzensberger ablehnte, positioniert Magenau sich vor allem gegen die Häme Enzensbergers gegenüber den Argumenten von Weiss. Der Spagat war fast undurchführbar: Politik machen hieß, Kompromisse eingehen – Schreiben aber setzte Kompromisslosigkeit voraus. Diese Spannung galt es auszuhalten.
Und in diesen unlösbaren Zwist zwischen Realpolitiker und Moralist platzte nun am dritten und letzten Tag, als alle schon mehr oder weniger mit ihren Gedanken bei dem Programm der nächsten Tage waren, Handkes Rede. War es ein geplanter Coup (wie Delius später suggerierte) oder spontan? Magenau scheint es nicht besonders zu interessieren; er moniert stattdessen die Redundanzen in Handkes Rede, das permanent verwendete Wort »läppisch« (was dann eigentlich dafür sprechen würde, dass sie eher unvorbereitet war). Natürlich vergisst er auch nicht auf die Publicity hinzuweisen, die Handke von nun an bekam.
Interessant, wenn die Substanz der Rede untersucht wird. Handke wollte die von der Gruppe bevorzugte Literatur nicht mehr; er vermisste in ihr das essentielle, was Literatur ausmacht, ein Sensorium von Sprache und Form. Je stärker sich Literatur auf sich selbst besinnt, auf die Sprache und auf die Form, in der sich das Denken ereignet, umso politischer ist diese Literatur, so Magenau zustimmend. Handke glaubte nicht an die von Richter und seinen Protagonisten praktizierte Trennung zwischen Literatur und Politik. Handkes aus der Sprache gewonnene Moral war etwas anderes als der Humanismus eines Peter Weiss oder Grass‘ Wahlkampfengagement. Er war radikaler als die beiden politischen Antipoden, weil er die Sprache nicht bloß als Instrument betrachtete, sondern als eigene Wirklichkeit, und wenn ein Schriftsteller die Wirklichkeit verändern wollte, dann musste er an der Sprache ansetzen, und nur da, denn da war ja schon die ganze Welt.
Schon in Handkes »Hausierer«-Text, den er mit provokativer Absicht als Kriminalroman ausgab, ging es darum den Zusammenhang zwischen den Worten und den Dingen zu ergründen […] Immer deutlicher wurde ihm, dass vor aller Gesellschaftskritik die Kritik der Sprache stehen müsse. Handke habe damit, so Magenau, die Gruppe an ihre Ursprünge zurückgebracht. Tatsächlich war man ja seinerzeit als Erneuerer und Ernüchterer der deutschen Sprache zusammengekommen. Aber weder Richter noch die anderen Teilnehmer nahmen dies wahr. Auch Handke selber nicht, so mutmaßt Magenau. Ob dieser tatsächlich so unbedarft war, ist zumindest fraglich, nachdem man jüngst seine Radiofeuilletons aus den Jahren 1964 bis 1966 nachlesen konnte, in denen er trotz seines jugendlichen Alters literatur- und theatertheoretisch sehr gut informiert gewesen war.
Umso erstaunlicher, dass Magenau, der die Intention Handkes kongenial illustriert, kurz darauf die These von Jakov Lind hervorholt, der in Handkes Philippika von Princeton einen Selbsthass auf seine eigene Prosa konstatiert. Hierzu rekurriert er auf einen »Spiegel«-Artikel Linds, in dem Handkes Erstling »Die Hornissen« verrissen wird – die entsprechenden Vokabeln fallen hier allerdings nicht. In der Auswahlbibliographie ist auch kein weiterer Hinweis zu finden. Man mag Handkes sprachkritischen Impuls in seinen Frühwerken als nicht gelungen empfinden, aber eine Autoaggression ist in seiner Rede von der »läppischen Literatur« nicht zwingend abzuleiten.
Tatsächlich ahnten einige noch nichts vom baldigen Ende der Gruppe. Dieter E. Zimmer kommentierte noch ganz enthusiastisch: »Solange Selbstgenügsamkeit und Selbstgerechtigkeit, die die Erstarrung auch aller Literatur sind, auf diesen Tagungen erschüttert werden können — solange ist die Gruppe 47 nicht tot.« Aber die Zerfallserscheinungen waren schon länger zu beobachten. Die letzte wirklich gelungene, freundschaftliche und literarisch bedeutende Tagung verortet Magenau in das Jahr 1963 nach Saulgau. Die einst Aufständigen waren in die Jahre gekommen. Natürlich wurde mit Handkes improvisiertem Vortrag nicht das Ende eingeleitet; es zeigte sich lediglich der Riss in den Generationen, das gegenseitige Nicht-Verstehen. Mit Schriftstellern wie Chotjewitz, Buch, Handke oder Piwitt konnten die Alten, die sich zudem in politische Grabenkämpfe verstrickten, nichts anfangen. Richter hatte sie zwar eingeladen, aber weniger aus Überzeugung, sondern weil er instinktiv spürte, dass die Gruppe sich weiter entwickeln musste. Also hörte er auf die Einflüsterungen von Verlegern. Der Werkstattcharakter war längst verschwunden; die erste Reihe wurde von Kritikern besetzt. Richter sah diese Entwicklung mit Sorge, scheute sich aber, dies zu verändern. 1967 fand das letzte reguläre Treffen der Gruppe 47 statt. Der politische und gesellschaftliche Aufbruch, den man herbeigesehnt hatte, trug letztendlich dazu bei, dass die Gruppe und ihre Regeln als obsolet empfunden wurden.
Am Ende legt Magenau den leicht ironischen, dabei aber nie sarkastischen Ton ab und ergreift emphatisch Partei für die Gruppe 47 und gegen ihre Kritiker, die sich nach der Tagung 1966 in einer Mischung aus Verlogenheit und Diffamierungsorgie zu Wort meldeten und ihren Vernichtungsphantasien freien Lauf ließen. Verbitterte Männer wie Robert Neumann und Hans Erich Nossack seien es gewesen, zudem schlecht informiert, was also schon damals kein Hindernis gewesen war. Richter litt physisch und psychisch an den Anfeindungen »von links«. Magenau verteidigt die Gruppe 47 überzeugend, weil er sie weder sakralisiert noch dämonisiert, sondern in ihrer Zeit verortet.
Keine Frage: Die Positionierung der Gruppe 47 gegen die restaurativen Kräfte insbesondere in den 1950er Jahren war wichtig für die Entwicklung der Kultur der jungen Bundesrepublik. Aber indem Magenau Richters Erzählung der ausschließlich in einer Tagung sich zusammenfindenden und danach dann wieder zerstreuenden Gruppe übernimmt, spielt er deren Einfluss zu sehr herunter. Richter moderierte mehr als 100 sowohl politische wie literarische Radio- und Fernsehsendungen (in den Dritten Programmen, aber auch im ZDF), in denen ständig (ehemalige) Gruppenteilnehmer zu Wort kamen. Alfred Andersch arbeitete in den 1950er Jahren als Rundfunkredakteur in verantwortlicher Stellung und vergab gut dotierte Aufträge für Hörspiele. Günter Eich war ab 1960 Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung; ein Blick auf die Preisträger des Büchnerpreises seit den 1960er Jahren zeigt die Dominanz der Protagonisten der Gruppe 47. Man war auf leisen Sohlen zum intellektuellen Establishment geworden und beanspruchte neben der politischen vor allem auch die literarische Meinungsführerschaft. Obwohl sie ab 1968 nicht mehr als Tagungsgemeinschaft existierte, nahm ihre Diskurshoheit sogar noch zu. Dies hält bis zur unmittelbaren Gegenwart an.
So folgerichtig eine solche Entwicklung war, so kritisch muss sie nachträglich betrachtet werden. Besonders die Kritiker nahmen Sortierungen vor; wer nicht den (politischen) »Stallgeruch« hatte, wurde mit der Höchststrafe, der Nichtbeachtung, bestraft und notfalls aus dem Kanon getilgt. Die Leistungen der Gruppe 47 rühmt Magenau zu Recht, aber ihre Exklusionsmechanismen, die die literarische Szene auf lange Zeit uniformierten, hätte man wenigstens erwähnen können.
Laut Magenau hatten die Verächter der Gruppe 47 von 1966 zumindest eine Entwicklung antizipiert: diesen gut abgefederten Schreib-Subventionismus, ein ab Ende der 1960er Jahre sukzessive aufblühendes Paradies aus Preisen, Stipendien und Stadtschreiberposten, in dem vor allem das Mittelmaß gut gedeiht, zumal wenn die Spürnase für Förderungen das geringe literarische Talent ersetzt. Kurz geht Magenau auf die »Nachfolger« der Gruppe 47 ein – den Bachmannpreis in Klagenfurt ab 1977, der den eitlen Kritikern endgültig das Spielfeld überlassen sollte. Und es gab den Döblin-Preis, in dem Grass irgendwann den Richter spielte und der den Werkstattcharakter wieder aufleben ließ, und das ohne Fernsehen.
Es gibt ein paar unnötige Wiederholungen (so habe ich irgendwann verstanden, dass Handke doof angezogen war, Hans Mayer ein spitzes Mündchen hatte, die Luft im Auditorium schlecht war und die Gruppe sich für die Umgebung und Historie des Ortes überhaupt nicht interessierte) und die gelegentlichen Ausflüge in die Zukunft der Autoren wirken ein bisschen aufgesetzt, etwa wenn es heißt, dass Grass noch 33 Jahre auf den Nobelpreis habe warten müssen oder F. C. Delius noch nicht ahnen konnte, dass er irgendwann den Büchner-Preis bekommen würde. Aber das sind Kleinigkeiten. »Princeton 66« ist ein leichtes, aber gleichzeitig anspruchsvolles Buch eines kenntnisreichen wie leidenschaftlichen Lese- und Ohrenzeugen.
Die kursiv gesetzten Stellen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
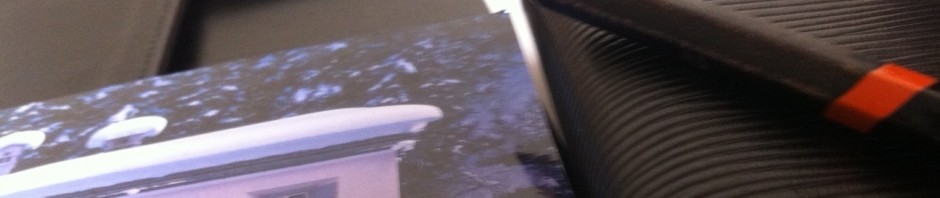



















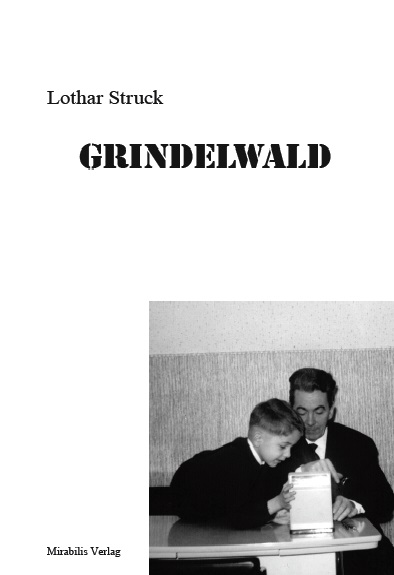
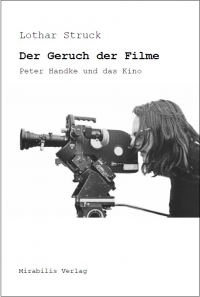
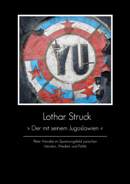
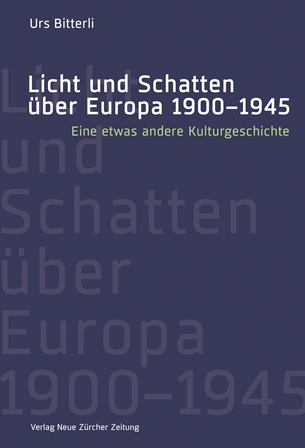
Ich frage mich welche der Amerikanischen Teilnehmern Magenau fuer sein Buch interviewt hat, z.b. Ted Ziolkovky von der Princeton U. der Handkes er sei “der neue Kafka”!, mitgehoert hat. Ich war einer der eingeladenen Amerikaner (Freund Peter Weiss Fuersprecher bei Richter den ich, durch Uwe Johnson, in Berlin traf, ein Treff der keine Funken schlug). Ich kannte Enzensberger schon seit 1961, bei Ruth Landhof-York in New York getroffen, und uebersetzte und verlegte dann zwei Essay Sammlungen bei Continuum Books; MAUSOLEUM bei Urizen, hatte Uwe Johnson, Peter Weiss Guenter Grass interviewt (bei Suhrkamp auf Deutsch zu erhalten) & hatte mich in die Deutsche Nachkriegsliteratur, West wie Ost, einiegermassen eingelesen. Als Kind von 20ten July Teilnehmern die gerade noch ueberlebten in ihrem Gestapo Gefaengnissen waehrend der »Siege of Berlin« Fruehling 1945 (http://www.lukasverlag.com/programm/titel/317-gestapo-im-op.html )
erschrocken ueber meines Grossvaters Buchenwald Tortur entschied ich mich aus Deutschland Moerderland 1947 weg als 11 jaehriger, spaet Emigrant also!, was mir 1950 gelang (vide mein Memoir SCREEN MEMORIES).
Waehrend Handkes Attacke sass ich neben Erich Kuby, den ich aus Hamburg kannte, Kuby sagte mir wer das war der da sprach. Ich war Suhrkamp Scout, gewesener fuer Atlantic Monthly Press wo ich die Prosa von Weiss und Bichsel untergebracht hatte. Als geflohener Auswanderer war mein Anliegen verlorengegangene Deutches “Kultur Gut” einzuverleiben! Ausserdem war die USA, auch politisch, schnell, ab 1952 – McCarthy, Mossadegh, Guatemala – enttauschend fuer jemand so politisierten wie mich.
Nach Princeton gaben Pannah Grady, Jakov Lind & ich eine Party fuer die Gruppe in Pannahs Apartment im Dakota in Manhattan wo, beruehmterweise, Alan Ginsberg mich anredete zu uebersetzen, dass er den neben mir stehenden Handke fi**en wollte. Der neben mir stehende grinsende Handke dachte dieses Anliegen sei an mich gerichtet. Als Ginsberg den Wunsch wiederholte flackerten Preussischen Dolche in meinen Augen und Ginsberg wich zurueck. Das haben Handke und ich erst 1980 in Salzburg aufgeklaert, (vide http://www.van.at/see/mike/index.htm
Handke trug ein braun-gelb klein kariertes Hemd, Nelke im Knopfloch.
Ich wurde dann sein erster Amerikanischer Uebersetzer und Lektor, auch Regie der fruehen Stuecke, leider bei dem Culture Vulture Gauner Roger Straus, von Farrar, Straus & Giroux. Freund Juergen Becker memoralisiert die Party, in FELDER glaub ich. Handke’s “Impotenz” bezog sich insbesonders auf naturalistisches Zeug – er schaetzte ja Grass, Weiss, Johnson, hasste Enzensberger von frueh an – genau so wie er sich noch jetzt ueber Haneke aufregt. Inwiefern Handkes Fruehwerk die Polis betrifft? Wenn man die Sprache, ihre Grammatik, ihren Syntax betrachtet, legen sich die politischen Strukturen dort ab, ab ihrer familaeren Grundstruktur, politisch wohl im Sinne von Uranarchistischem, KASPAR, und das stimmt auch ganz physikalisch.
Aber ein nicht 68ziger wie Handke war eher interessiert die Sprache auf ihre klassischen Grund zurueckzufuehren, als Prosa Schriftsteller; in den Happeningsartigen Stuecken veraendert die Sprache dass Bewusstsein der Zuhoerer auf ganz besondere Weise.
Handke hat sich ueber das Parolenhafte der 68er aufgeregt, war doch eher ein Yuppie der schon in Berlin in eines Prinzen Wohnung hauste. Aesthetik, formales literarischen Kunstwerk waren ihm doch wichtig. Dazu vielleicht spaeter noch etwas differenziertes von mir, besonders ueber den HAUSIERER.
[Kleinere Fehler korrigiert – LS]
#1
As promised a note on Lothar Struck’s mention of the political nature of the linguistics of DER HAUSIERER
« »Der Leser, wenn er eine Geschichte zusammensuchen will, kann sich nur an das äußere Kriminalgeschichtenschema halten, es gibt keine Geschichte zum Zusammensuchen, die Sätze lassen sich nicht logisch zusammensetzen« (Handke 1967b)
Since I already have a page at the Handke project devoted to DER HAUSIERER
http://handke–revista-of-reviews.blogspot.com/2013/04/der-hausier-handke.html
I am posting my rather lengthy comment there online. However, in nuce, as to the poltiical, or at least is psychological nature within this context the briefest comment & recollection about the amazing DER H AUSIERER at my revista site.
The brief comment is that DER HAUSIERER is political in the same sense as OEDIPUS, since all that anxiety that is being played with and stilled in that fashion is derivative of the patrimony – not as brief a twitter as I had envisioned. . I am not sure I agree, if in fact I understand Struck’s comment – or is it Magenau’s with whom he agrees? – that “darum den Zusammenhang zwischen den Worten und den Dingen zu ergründen […- That is not the case in DER HAUSIERER I don’t think, KASPAR!
Also note:
http://handkeonline.onb.ac.at/node/1343
which provides the novel’s Entstehungskcontext
#2