»Turksib« in ziemlicher Einmütigkeit den Ingeborg-Bachmann-Preis zugesprochen bekam. Auch wenn man vielleicht einen anderen »Lieblingstext« im Wettbewerb hatte – die Qualität dieser Prosa war eindeutig und tatsächlich herausragend. Und noch heute erinnert man sich an diesen schaurig-zärtliche Loreley-Gesang des russischen (?) Heizers auf den rüttelnden Turksib-Gängen. Vielleicht ist dieser Fischgesang, der sich zwischen Erzähler und Heizer für eine schwer durchatmete Dauer ereignete, der Kristallisationspunkt dieser Erzählung, die ansonsten fast nur aus der Bewältigung des Ich-Erzählers der Strecke vom Zugende zum Zuganfang (oder ist es umgekehrt?) und der Beschau eines Geigerzählers (und vor allem dem Geräusch!) zu bestehen scheint. Aber – und dies wird noch Gegenstand der Erörterung sein – es ist nicht immer ganz leicht, den Movens der Erzählungen von Lutz Seiler »herauszuarbeiten«, was allerdings die Lektüre zusätzlich reizvoll macht.
Der vorliegende Band mit dem schönen, allegorischen Titel »Die Zeitwaage« (eine Zeitwaage ist ein Instrument zur Feststellung der Ganggenauigkeit einer Uhr) umfasst dreizehn Erzählungen (die Titelgeschichte findet sich am Ende des Buches). Sie weisen formal kein einheitliches Schema auf. Häufig gibt es einen Ich-Erzähler, der bisweilen durchaus (biografische) Parallelen mit dem Autor suggeriert (aber manchmal wird dieses übereifrige Germanistensuchen auch auf perfide Art plötzlich, innerhalb der Erzählung, gebrochen) und sogar, einmal (in der Erzählung »Gavroche«), werden Erzähler und Erzählung selber Gegenstand der Erzählung. Und in einigen Geschichten gibt es abweichend einen auktorialen Erzähler.
Bis auf die ersten beiden Geschichten (»Frank« und »Im Geräusch«), die durch die Protagonisten miteinander verbunden sind (sie sind auf Urlaub in den USA), »Turksib« und die »Zeitwaage« (Berlin) kann man als Ort Seilers Heimat Thüringen ausmachen. Und obwohl die Geschichten in der ehemaligen DDR mindestens verwurzelt sind, die Protagonisten ihre Sozialisation dort erfahren haben (zu allerdings durchaus unterschiedlichen Zeiten) und es durchaus Anspielungen auf Skurrilitäten und Absonderlichkeiten des Systems gibt (diese meist eher mit leichter Hand gezeichnet), ist die »Zeitwaage« kein »DDR-Buch«, schon gar kein Bewältigungsbuch. Die Verstörungen und Verletzungen der Figuren sind auf eine fast betörende Art Zeugnis eines aus-der-Welt-gefallen-Seins und besitzen einen merkwürdig hohen Grad an Universalität (die allerdings in keinem Fall mit Beliebigkeit verwechselt werden darf).
Wendepunkte des Lebens
Gemeinsam ist den Geschichten, dass nicht nur ein bestimmtes Ereignis im Leben einer Person von ihr bzw., seltener, dem allwissenden Erzähler, nicht nur erinnert oder reflektiert, sondern im Erzählen wiederbelebt wird. Ein Ereignis, dass rückblickend das Leben entscheidend geprägt hat und es bis heute noch bestimmt (und wenn auch nur als unverstandene, auch nach all‘ der Zeit noch verstörende Begebenheit). Dieser Moment der Peripetie, der immer überraschend eintritt, bildet den tatsächlichen Kern der Erzählungen.
Wobei die Einbringung dieses Motivs in den einzelnen Erzählungen durchaus variiert. »Das letzte Mal« beginnt damit: Es war am 20. November 1976, ich war dreizehn Jahre alt und hatte meinen Vater das erste Mal im Schach besiegt. Es war das letzte Mal, daß wir miteinander spielten. Die Erzählung mäandert dann vom Triumphgefühl dieses Sieges über den Ort des Geschehens (eine Kleingartenanlage in einer etwas heruntergekommenen Gegend zwischen Zeitz und Meuselwitz) und die Wohnverhältnisse der Familie (man ist mit Aushubarbeiten beschäftigt) und kommt immer wieder zurück auf die Faszination des Schachspiels (wie frisch lackiert glänzten die Steine). Anhand der großen Stabtaschenlampe, mit der Vater und Sohn abends nach der Arbeit beim Spiel zusammensitzen, wird die Geschichte des »Erwerbs« der Kleingartenanlage assoziiert (eine kleine Burleske um den Versuch, durch wohlfeiles Verhalten seinen Platz auf der Zuteilungsliste zu verbessern). Und am Ende schließt sich dann wieder so schön der Kreis, wenn es heißt Nie hatte ich mich ernsthaft gefragt: Warum eigentlich, warum war das unser letztes Spiel gewesen? In all den Nächten, die wir noch nebeneinander auf unseren Pritschen zubrachten…blieben das Steckschach und auch die Schachfibel verschwunden. Wir sprachen nie wieder über Schach, ich forderte kein neues Spiel, nie, und mein Vater keine Revanche – fast war es so, als hätten wir niemals gespielt, als hätte es all die Jahre meiner Niederlagen und seiner Siege nicht gegeben.
In »Der Stotterer« erwächst das Motiv erst im Laufe der Erzählung. Zunächst wird eine Art Garagenmechanikeridylle aufgebaut, in der der Ich-Erzähler und ein »Stotterer« Genannter die Nachmittage und ganze Sonntage (Garagensonntage) nebeneinander verbrachten. Der Stotterer, der, wie ich es empfand, endgültig aus der Gemeinschaft gefallen war, ein ehemaliger Maurer (wie gemunkelt wurde), war ein Mann, der offensichtlich am liebsten allein war und bastelte in einem fort an seinem »Saporoshez« (der Ich-Erzähler, jünger als der Stotterer, am »Shiguli« seines Vaters). Schön, wie es Seiler gelingt, diese Stimmung in der Garage mit wenigen Strichen zu verdichten und dabei die Litanei des Stotterers während des Arbeitens wie einen epischen Gesang wiederbelebt. Dieses getrennte, und doch irgendwie zusammengehörige Werken der beiden Protagonisten. Und obwohl ab und zu der Stotterer aus de[n] Augenwinkeln die Arbeit des Anderen verfolgte und prüfte und Handgriffe…, Haltung, wie ich mit dem Werkzeug umging beobachtete: Es war ein andächtiges Tätigsein – und sofort entsteht der Wunsch beim Lesen: Sollte so nicht unser aller Arbeit sein?
Tanz der Wanderer
Und just in diesem Moment macht die Erzählung einen Schwenk – hin zu ihrem geheimen Zentrum. Plötzlich ist der Erzähler auf dem Weg nach Hause, auf einem kleinen Berg, es dunkelt bereits und vor ihm der Stotterer und dann eine gar nicht so unbekannte Situation: Fast war ich auf seiner Höhe, zögerte aber noch, ihn zu überholen; ich wußte, daß ich dann nicht umhinkommen würde, ihn zu grüßen, nachdem wir den halben Nachmittag stumm nebeneinander gearbeitet hatten, jeder vor seiner Garage. Was tun?
Womöglich würde er seine Schritte beschleunigen, um sich für den Rest des Weges anzuschließen…Nein, unvorstellbar, das würde sicher nicht geschehen, überlegte ich, aber wenigstens war es nötig im Vorübergehen ein Wort zu wechseln, zumindest einen Gruß, um die Peinlichkeit, in die uns mein Überholmanöver unweigerlich bringen musste, zu überbrücken. Im nächsten Moment wurde mir klar, daß gerade das unmöglich war… […] Ratlos war ich hinter ihm geblieben, in seinem Rücken, auf seinen Fersen. Ich hatte den Rauch seiner Zigarette eingeatmet, mich umfing ein Geruch von Tabak, Schweiß und Verlassenheit – ich atmete, ich füllte meine Lungen, und ein seltsam wohliges Gefühl kehrte ein.
Lässt er sich beim ersten Mal noch mitziehen von diesem Gehen, so wird von nun an wird dieser Tanz auf dem Nachhauseweg zum festen Ritual. Des Erzählers Wahrnehmung fokussiert sich auf des Stotterers Gang, dem Halten der Zigarette, die Wolkenbildung des Zigarettenrauchs (willig inhaliert er ihn ein und wendet sich dazu je nach Windrichtung). Der frisch ausgestossene Dunst seines Atems schlägt ihm manchmal direkt ins Gesicht. Er ist vollkommen sicher unentdeckt geblieben zu sein, obwohl er ihm manchmal sehr nah kommt (ich hätte meine Wange auf seine Wildlederschulter legen können) und wenn er stehen blieb blieb auch ich stehen. Und einmal hatte sich der Stotterer urplötzlich umgewandt und fast kindlich die Reaktion, in dem der Andere sich geistesgegenwärtig umdrehte und schnell ein paar Schritte in die entgegengesetzte Richtung machte. Jede Bewegung des Vorgehenden wird aufgesogen gefesselt folgt man der Erzählung dieses scheinbar so unspektakulären Ereignisses.
Inzwischen war ich mir sicher, daß meine Anhänglichkeit einer verhängnisvollen Sucht entsprang, die bei dieser Gelegenheit erstmals zutage getreten war. Diese Sucht, so der Ich-Erzähler, beweise, dass er nun erwachsen werde. Sie war das Zeichen einer neuen Reife. Auf meinem Weg von der Garage nach Hause entfernte ich mich auf unumkehrbare Weise von dem, was mein bisheriges Leben ausgemacht hatte. […] Im Rücken des Stotterers hatte ich den guten, bitteren Vorgeschmack einer künftigen Zeit auf der Zunge. Und in dem Gewölk aus blauglänzenden Luftmolekülen, in deren Obhut ich mich begeben hatte, oszillierten winzige Momente von Verheißung. Er wurde durch das Schauen zum Erwachsenen, zum »Mann«.
Aber dieser Prozess der Selbstkonstituierung durch den Anderen, der so fremd und doch so vertraut ist, dauert nur kurz. Das Ende der Erzählung stellt den Stotterer wieder in den Fokus (soll hier aber nicht verraten werden). Der Leser kann danach nicht ablassen von diesem seltsamen Paar und die Bilder verfolgen, nein: begleiten ihn noch lange Zeit und nie wieder wird man an einen Wanderer einfach vorübergehen, ohne an diese Geschichte zu denken.
Überhaupt: Wie nachhallend, manchmal auch suggestiv diese Geschichten und die Protagonisten doch sind. Da ist die junge, hochtalentierte Turnierschachspielerin »Gavroche«, die für mehrere Jahre zur Freundin des Erzählers wird. Auch hier wieder ein Geheimnis: Bei aller Intimität sagt er ihr nicht, dass er das Schachspiel sehr wohl spielen kann; er simuliert den Kenntnislosen (die Schachlüge). Und wie ergreifend (und beinahe selbstquälerisch) dann die Erzählung endet, als er ihr dies weitere Jahre nach einem flüchtigen Kontakt beim Jahrgangstreffen der Uni endlich mitteilen und eine neue Welt der Vertrautheit mit der ehemaligen Geliebten begründen möchte (und abermals schweigt der Leser über den weiteren Fortgang).
Die ephemere Unschuld der Kastanie
Oder die Kindheitsgeschichte vom »heroischen« Kapuzenkuss als das »offizielle« Kussspiel auf dem Pausenhof schon beendet war. Nebenbei eine ganz andere Internats- und dann sogar Kriminalgeschichte mit zwei Hausmeistern (Oberer und Unterer). Eine Welt in der es Stoffturnbeutel gibt, eine »Schällerelli«, Mittagsschlaf im Klassenraum (am Ende die rührende Szene als die angehimmelte, kapuzengeküßte Heike den Kopf des Erzählers streichelt – aber in Wirklichkeit nur die Narben von seinem Umfall ertastet), drei Verstecke und willkürliche Ranzenkontrollen (die Angst um die Fußballbilder!). Und abermals wird die Atmosphäre (hier der 1970er Jahre in der DDR) so stark erzeugt, dass man den betäubenden Dunst des Garagenverstecks förmlich sehen kann.
Oder Frank und Teresa mit ihrem (?) Kind Luzie auf einer Reise durch die USA und Luzie verschwindet eines Tages auf einem Jahrmarkt in einer riesengroßen, maschinell erzeugten Seifenblase – Metapher für die Ehe oder Beziehung der beiden, die Frank durch einen immer in der Anrede stockenden, nie geschriebenen Brief noch erretten möchte (es bleibt vergeblich: »Zu spät« […] »Ich weiß«).
In einer anderen Erzählung ist von der »Jagd« die Rede und Knüppeln, die in die Bäume geschleudert werden, die sogenannte »Kastanienjagd«, die auch der Protagonist Serkin (während der Dauer der Erzählung den Amseln im Wald lauschend) betrieb und es dürfte sicher sein, dass diese noch nie so erzählt wurde: Serkin dachte daran, welchen Genuß ihm alleine das Geräusch bereitet hatte, wenn der kreiselnde Knüppel im Geäst der Kastanie schnitt. Dann das gedämpfte Prasseln, der warme Regen, das Gehüpf der brauen Perlen auf den Pflaster der Reimannstrasse. Ein zunächst sinnlicher, dann sogar erotischer Vorgang, der bei der Betrachtung und Behandlung der Früchte einsetzt:
Oft war die Schale an einer Stelle aufgeplatzt und in dem feuchten Spalt ein frisches, braunglänzendes Auge sichtbar geworden, das ihm aus seiner Unberührtheit entgegensah. Wie ein bleiches Augenlid lag noch etwas Innenhaut über der Frucht. Am Spalt setzte er die Daumen an und drückte die beiden mit Stacheln besetzten Hälften der Schale auseinander. Langsam, behutsam. Er hatte gut darauf zu achten, daß das blanke Auge nicht plötzlich hervorspritzte und in den Dreck fiel. Denn es ging um genau diesen Moment, in dem er der erste war, der die seidigfeuchte, fast etwas fettige Frucht empfing, sie zwischen seinen Fingern gleiten ließ, zum Handteller hin, sie schließlich fest umschloß und presste: Es ging um diese tiefe Befriedigung im Inneren der Faust, ein Gefühl, das ihn mit dem Zentrum seiner Lust verband. Und ab und zu, wenn es ganz bestimmt niemand sehen konnte, steckte er sich eine der braunen Augenperlen in den Mund und schmeckte ihre kaum wahrnehmbare Süße – das Ganze dauerte nur Sekunden, dann war die Kastanie verbraucht, dann war ihre Unschuld verdampft.
Dieses Erleben wird nun eines Tages gestört, als neben den Kastanien auch eine Amsel vom Knüppel getroffen auf dem Boden landet. Ihr Körper lag auf der Seite, wie umgekippt. Serkin ist verstört; es dauert, bis er sich entschließt die Amsel aufzunehmen (der Vogel schrie) und ihn unter dem Anorak nach Hause zu bringen. Und jetzt die Überlegungen des offensichtlich jugendlichen Protagonisten, dass seine Eltern ihm Tiere verboten hatten, der Gedanke an die Möglichkeiten, dem Tier zu helfen, die Furcht vor dessen Tod – in Wirklichkeit: die Abhängigkeit von unverhofften Ereignissen, die das Leben durcheinanderbringen und urplötzlich Verantwortung einfordern. Endlich kommt er zu Hause an und legt den kranken Vogel in den Elektroschrank. Und stolz flüsterte er ihm etwas zu wie: »Warte nur kurz, ganz kurz…«. Auch hier soll das – kuriose – Ende nicht verraten werden (welches den etwas holperig anmutenden Titel der Erzählung, »Die Schuldamsel«, erst verständlich macht und dann noch allegorisch gelesen werden kann).
Vergebliche Suchen
Und in der »Zeitwaage«, der mysteriösesten und rätselhaftesten Geschichte des Buches, wird ein nicht näher beschriebener Ich-Erzähler nach Berlin eingeladen, um sich von seinem Liebeskummer abzulenken. Er redet mit den Freunden, die ihn eingeladen hatten, streift alleine durch die Stadt, sucht sich nach einiger Zeit eine Wohnung und findet eine, in der noch Klingelschild und Einrichtung des Vormieters präsent sind (es sind die Wendejahre, in der einige Wohnungen, beispielsweise von Ungarnflüchtlinge[n], leer stehen). Dabei wirkt er seltsam phlegmatisch, und selbst diese Charakterisierung erscheint in Anbetracht des fast aphoristischen Satzes Eine Weile suchte ich nach meiner Verzweiflung, fand aber nichts noch Understatement. Er bekommt eine Anstellung »in der Gastronomie« und bedient in Kneipen wie z. B. der »Assel«.
Immer wieder wird dieser ruhige Erzählstrom durch kurze Szenen aus einer Uhrmacherei oder Werkstatt unterbrochen, die sich zunächst nicht in den Hauptstrang einordnen lassen. Eines Tages, an einem Freitag im August, betritt ein Arbeiter, der mit Gleisarbeiten an der Straßenbahn beschäftigt ist, die (eigentlich geschlossene) »Assel« (ein bisschen verunglückt hier die Beschreibung des Eintritts: als ginge er über Wasser) und bestellt wie selbstverständlich ein Frühstück und einen Weinbrand. Dies wiederholt sich und der Ich-Erzähler ist fasziniert von der Aura dieses Mannes und der heilige[n] Sphäre der Arbeiterschaft, die er für ihn tatsächlich physisch verkörpert. Aber am 31. August ist es zu Ende; er machte das letzte Frühstück für ihn (die Zahl der Weinbrände hatte sich erhöht). In surreal-expressionistischen Bildern wird nun der Stromschlag, dem der Arbeiter zum Opfer fällt, erzählt; der Erzähler zitiert hier aus seinen fast reportagehaften Notizen. Und dann war da diese Uhr des Mannes – er nimmt sie als Bezahlung für die vielen Frühstücke und lässt sie nun herrichten. Und plötzlich schließt sich der Kreis zu der Werkstatt und der Leser steht mit seinen Assoziationen zunächst einmal alleine da, als er im abschließenden Bild den Ich-Erzähler auf eine Ruine mit Einschusslöchern zugehen sieht.
Und immer wieder diese Geräusche, die Musik der Erzählungen. Das Klopfen des Möwenvogels in »Frank«; das sich rhythmisch wiederholende Geräusch, eine Art Jaulen im Versteck des Internatschülers in »Der Kapuzenkuß«; das Amselsingen in »Die Schuldamsel« als Kontrast zum Prasseln der Kastanien und dem verletzten Vogel; die singenden Hiebe mit der Säge bei einem Halbstarken-Überfall aus »Und jetzt erschießen wir dich, du alter Mann« und dann der kurze Augenblick der Stille; das Knarr- und Quietschkonzert der Liegen aus »Das letzte Mal«, und so weiter.
Lutz Seilers Erzählungen unterscheiden sich sowohl von den in den letzten Jahren modern gewordenen Geschichten insbesondere angelsächsischer Autoren, die einfach eine kurze Zeit im Leben einer Person ausrissartig (und sozusagen symbolisch für deren Lebensumstände) erzählen und dann offen enden lassen als auch von der »klassischen« Kurzgeschichte, die er vor allem sprachlich (aber teilweise auch durch die Konstruktion) variiert. Virtuos beherrscht er den genauen Blick, der in eine faszinierende Verdichtung des Augenblicks überführt wird wie auch die sparsame Lakonik, die niemals mit falscher Coolness daherkommt und versteht es zwischen diesen Polen oft auf kleinstem Raum stilistisch souverän zu alternieren.
»Die Zeitwaage« ist Ausweis eines großartigen Erzählers; ein grandioses Buch. Der Leser blickt immer wieder entzückt, verstört, verzaubert auf und fragt sich am Ende, wie er es bisher ohne diese Erzählungen ausgehalten hat. Und das ist nur ein kleines bisschen übertrieben.
Die kursiv gesetzten Stellen sind Zitate aus dem besprochenen Buch. – Und hier gibt es eine Leseprobe.
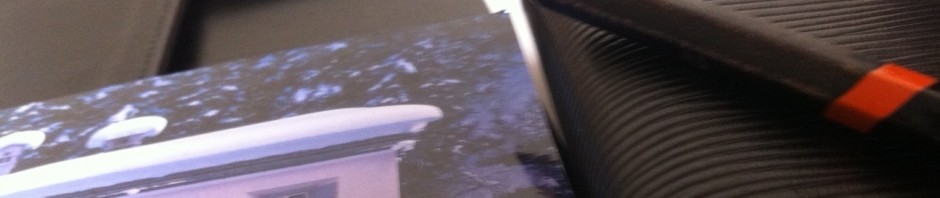
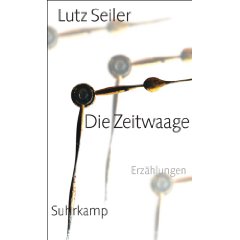


















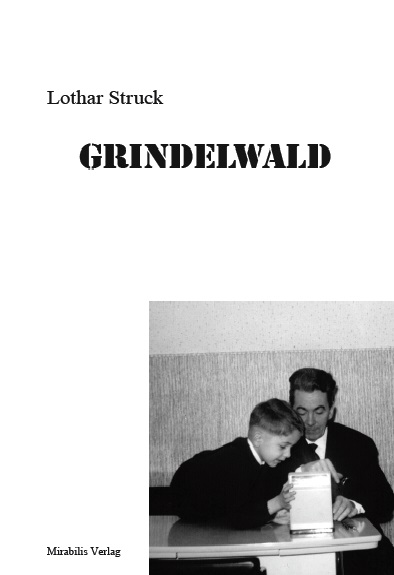
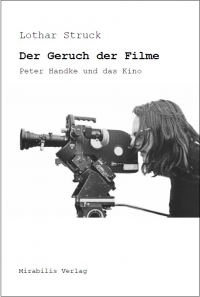
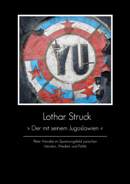
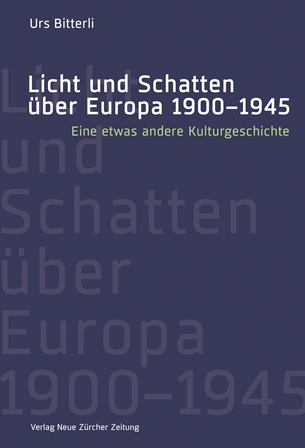
Ruhe & Emphase: Noch einmal „Literatur“
Lutz Seiler hatte Auszüge aus dem Buch neulich im LCB gelesen. (Ich glaube, es war ein Stück aus dieser „Kapuzengeschichte“ – ich hatte etwas zu spät eingeschaltet und deshalb den Titel nicht mitbekommen; das für mich „überflüssige Gespräch“ mit den Kritikern blende ich dann eh lieber aus und verpasse so manchmal etwas.)
Und obwohl mir anfangs das Thema etwas sehr treuherzig daherzukommen schien, nahm mich doch die ruhige Präzision gleich ein, wurde doch diese Qualität der Prosa à la „Turksieb“ gleich wieder offensichtlich. Etwas, das mich zum wiederholten Male einerseits wieder an Wolfgang Hilbig erinnert, andererseits an eine russische Tradition der Literatur (etwa Turgenjew); aber dieses Anklangsnervengeflecht ist zuletzt vielleicht völlig subjektiv.
Trotzdem noch ein Gedanke in diese Richtung: Dass es „im Osten“ vielleicht doch eine besondere Qualität der Ruhe, der anderswie eroberten Selbstgewissheit, einer Tiefenauslotung mittels des Sich-Zeit-Nehmens für seinen Stoff gegeben hat, die in dem hysterischen, divers und täglich anders bewegten Westen sich nicht derart, nicht so konsequent entwickeln konnte. Natürlich ist das auch eine Frage des Temperaments – und vielleicht sogar eine der Mentalitäten, letztlich also wieder der Verortung (ob in „Landschaften“ oder einem dort hiesigen geistigen Raum).
Die Musikalität der Sprache ist dann – für mein Gefühl – eine sehr zurückhaltende, nicht auftrumpfende, eine, die wiederum eine gewisse Zeit zur Entfaltung braucht. Und zugleich gibt es manchmal diese Einsprengsel – oder „Wurmlöcher“ – der Ereignung eines Phantastischen. (Da sehe ich bei Seiler ein weiteres Moment an russischem Einfluss [etwa Bulgakow?], das andererseits in der Querverbindung aber auch im Thema der „Radioaktivität“ zu liegen scheint [Geigerzähler, Pechblende, die Metapher der ungreifbaren „Verstrahlung“ des politisch eben nicht einseitig zu definierenden Wirklichen kommen immer wieder vor], die Seiler schon in seinem ersten Lyrikband biographisch bedeutsam gemacht hat.)
Ich empfand das Vorlesen zwar nicht ganz so euphorisch wie Sie („grandios“), spürte aber eine deutliche Sympathie, die, glaube ich, in die gleiche Richtung drängt. Und das wiedererweckt die manchmal selten zu werden scheinende Freude, dass es wirklich noch die Literatur als klassische Tugenden der Erzählung gibt, die einen mit dem oft so unbefriedigt lassenden Rest versöhnen kann.
#1
Die LCB-Sendung habe ich nicht gehört, wohl eine Kritikerbesprechung mit Helmut Böttiger und einem Moderator, der Fehler über Fehler beging und nicht korrigiert wurde.
Seiler setzt ein Hilbig-Zitat seiner Erzählung »Die Zeitwaage« voraus (ich bekenne, Hilbig ist bei mir nach wie vor eine Bildungslücke; Schande über mich). Aus dem, was ich über ihn gelesen habe: Ja, da ist sicherlich ein Kontinuum; eine Anknüpfung. Genau wie ich eine gewisse Parallelität zu Tellkamp erkenne, obwohl er in seinem Roman nicht so verdichtet hat (nicht so zu verdichten brauchte).
Es scheint fast so, dass dieses Verdichtende und auch immer wieder ins Epische mäandernde ein Phänomen derzeit fast nur noch von ostdeutschen Autoren ist (ich nehme da Ingo Schulze ausdrücklich aus). Dieses »Sich-Zeit-Nehmen« und auch eingestehen dessen, sich diese Zeit zu nehmen. Etwas, was vielleicht hier eher als »langweilig«, gar restaurativ gesehen wird, weil es das Gegenteil der Pop-Literatur ist, die man sich wie eine Salbe einschmiert (und nach kurzer Zeit vergisst, dass sie aufgetragen wurde).
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Seiler die ganze Erzählung »Der Kapuzenkuss« gelesen hat; sie ist ja selber in mehrere Teile unterteilt. Sie wirkt natürlich in dem Sinne nur als ganzes – eben auch, wenn man sich »Zeit nimmt«, sie als Gänze zu lesen (vorzulesen) und nicht als Ausschnitt.
In der SWR2-Bestenliste-Diskussion (ebenfalls im Radio) meinte Löffler sinngemäss, jeder mittelmässige Autor hätte aus dem Stoff dieser Erzählungen fünf schwache Romane geschrieben. Das genau ist es: Die Kunst ist das Genre der Erzählung (ökonomisch sicherlich für einen Verlag nicht so lukrativ wie DER »Roman«), welches ich hier wiederbelebt sehe und zwar anders als beispielsweise im Wohlstandskinder-Jargon von Judith Hermann (den ich auch gerne lese aber eben nur konsumieren kann).
#2
Schöne Besprechung
Und danke für die Empfehlung, das Buch wäre sonst an mir vorbeigegangen. Ich habe es diesmal nur umgekehrt gemacht, und die Besprechung nachher zu Ende gelesen, um möglichst wenig vorab zu wissen, obwohl Du Dir Mühe gegeben hast nicht zuviel zu verraten.
Die Uhr, warum bleibt die Uhr liegen? Hat er sie tatsächlich vergessen? Oder ahnte er was kommen würde? Warum immer mehr Weinbrand? Ich kann es nicht begründen, aber irgendwie scheint mir ein einfaches Vergessen, unplausibel (Den Notizen des Erzählers nach, kann man einen Selbstmord ja ausschließen).
Interessant, dass immer wieder Männer und ihre lebensweltliche Situation im Fokus stehen: Frank, Im Geräusch, Na?, Und jetzt erschießen wir dich, du alter Mann, (Gavroche).
Lutz Seiler ist ein Könner, keine Frage. Turksib war die erste Erzählung die mich in Bann geschlagen hat, meine Favoriten, neben dieser: Die Schuldamsel, Gavroche, Und jetzt erschießen wir dich du alter Mann, Die Zeitwaage und Der Kapuzenkuss.
Ganz kann ich mich Deinem Urteil nicht anschließen, aber fast. Was mir ein wenig fehlt, aber das ist sehr viel verlangt, ist, dass mich das Buch nicht unbedingt zwingt, es wieder zur Hand zu nehmen. Und verzaubert, möchte ich so nicht sagen, aber das liegt vielleicht an dem Wort, das wir unterschiedlich verstehen.
#3
Vielleicht ist es ja auch dieses »Ungeklärte«, was immer wieder in diesen Erzählungen aufschimmert, was sie auch auszeichnet. Wie in der Schuldamsel – warum »vergisst« er die Amsel? Oder Gavroche, die er irgendwann auch einfach »vergisst«, um sie dann anzurfen – mit dem bekannten Ergebnis.
Ich möchte dabei gar nicht ins Deuten verfallen, warum jemand so etwas vergisst, geschweige denn ob das »realitätstauglich« ist (ich sag damit nicht, dass ich das bei Dir herauslese).
Ich fand »Turksib« seinerzeit gar nicht so toll, obwohl die Erzählung im Kontext des Bachmann-Wettbewerbs herausstand.
Tja, ob man das Buch noch einmal zur Hand nimmt (so etwas wie eine Gretchen-Frage, finde ich). Zumindest bin ich froh, es immer zur Hand nehmen zu können. Und das geschieht nicht sehr oft. (Obwohl ich kaum Bücher weggebe.)
#4
Realitätstauglichkeit
Um die geht es nicht (oder nur in speziellen Fällen), aber die innere Logik muss stimmig sein, d.h. Seltsamkeiten, und Ungeklärtes müssen sich deuten lassen können, in ein Gesamtbild fügen, in eine Leserichtung, sonst könnte man sie nicht von Fehlern des Autors unterscheiden.
Das Vergessen der Amsel, hat mich nicht weiter verwundert, da ich ähnliches von mir selbst kenne: Man vergisst (da muss man gar nicht den Begriff der Verdrängung bemühen, um mit dem was geschehen ist, klar zu kommen) manche Dinge (sogar schon Stunden später) einfach, obwohl sie momentan emotional stark belegt sind, und wichtig erscheinen.
Weil Du das Ende »Der Zeitwaage« in Deiner Besprechung erwähnt hast, habe ich es noch einmal gelesen, und mir ist eine »Seltsamkeit« aufgefallen: Warum sollten die Hülsen der Geschosse in den Einschusslöchern stecken? Nur die Projektile verlassen die Mündung einer Waffe, die Hülsen werden ausgestoßen und verbleiben an Ort und Stelle. Und dann als er von dem rostenden Metall spricht, was sollte rosten? Die Hülsen? Die sind im Regelfall aus Messing. Die Projektile? Da wird zwar mitunter auch Stahl verwendet, aber ich würde zumindest annehmen, dass auch der korrosionsbeständig ist.
Und jetzt findest Du Turksib besser?
#5
»Turksib« fand ich tatsächlich jetzt, nach dem zweiten Lesen, besser, obwohl es m. E. nicht die beste Erzählung im Buch ist.
Den Schluß der »Zeitwaage« werde ich nochmal lesen…
#6
Der Schluß der Erzählung »Die Zeitwaage«
Die Stelle lautet wie folgt (S. 284):
Nur für ein paar Sekunden stand ich dort, allein im Dunkeln, am Sockel des Instituts, und bohrte etwas losen Sand oder Dreck aus dem Loch. Obwohl ich mich unleugbar mitten in der Stadt befand, herrschte eine vollkommene Stille. Flüchtig fragte ich mich, ob es möglich sein könnte, dass die Hülsen der Geschosse noch an den Enden dieser kleinen Höhlen steckten, und ob ich sie auf diese Weise irgendwann ertasten würde. […] Ein Stück rostendes Metall schlägt durch mit der Zeit…
Du hast natürlich vollkommen Recht. Bei einem Schuss wird die Geschosshülse ausgeworfen, während das Geschoss (Projektil) im Ziel landet. Insofern ist es ungenau. Wobei natürlich auch der Ich-Erzähler mit den Gegebenheiten nicht vertraut sein muss; die Unterscheidung nicht kennt bzw. in diesem Moment nicht vergegenwärtigt.
Es gab/gibt (s.o. Artikel) durchaus Projektile aus Eisen. Aber auch hier könnte der Erzähler wieder einem Irrtum aufsitzen. (Ich weiss, das klingt arg verteidigend für den Autor, aber unmöglich ist es nicht.)
#7