Im vergangenen Jahr standen gleich zwei dystopische Romane – Heinz Helles »Eigentlich müssten wir tanzen« und Valerie Fritschs Meisterwerk »Winters Garten« – auf der Longlist zum deutschen Buchpreis. Der Trend zur Dystopie in der deutschsprachigen Literatur bestätigt sich in diesem Jahr mit Thomas von Steinaeckers neuem Roman »Die Verteidigung des Paradieses«. Wie auch bei Helle und bei Fritsch ist bei von Steinaecker nicht so sehr von Bedeutung, was zum Untergang der Zivilisation geführt hat oder führen wird, sondern wie die Zivilisation mit ihrem Ende umgeht.
 Zu seinem fünfzehnten Geburtstag erhält der Ich-Erzähler Heinz vier leere Schreibhefte und einen Faber-Castell-Bleistift. Er fühlt sich zu Großem berufen: Das schwarze Heft, mit dem »Die Verteidigung des Paradieses« beginnt, dokumentiert sein Leben auf der Alm in den bayrischen Alpen, auf der er zusammen mit sechs anderen Überlebenden der »mitteleuropäischen Katastrophe« lebt, die zwölf Jahre zuvor die gesamte Zivilisation in Deutschland und den anliegenden Ländern ausgelöscht zu haben scheint. An seine ersten Jahre vor der Katastrophe erinnert er sich dunkel, zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder lebte er in der Elite-Siedlung Waldweben IV mit jedem erdenklichen Luxus, den das Leben um das Jahr 2045 bereit hielt: mit Robotern für alle erdenklichen Tätigkeiten, ein vollautomatisiertes Leben in vermeintlicher Sorglosigkeit. Übrig ist davon nichts mehr. Die Gemeinschaft führt ein archaisches Leben mit Kühen, Schweinen und Hühnern auf dem Almbauernhof unter einem der letzten funktionierenden Shields, das die – vermutlich wegen des Ozonlochs – tödliche Sonneneinstrahlung abhält und aufgrund seiner Programmierung einen ewig anhaltenden Frühling fernab der »großen Ebene«, auf der vor der Katastrophe Solarfelder standen, gewährt.
Zu seinem fünfzehnten Geburtstag erhält der Ich-Erzähler Heinz vier leere Schreibhefte und einen Faber-Castell-Bleistift. Er fühlt sich zu Großem berufen: Das schwarze Heft, mit dem »Die Verteidigung des Paradieses« beginnt, dokumentiert sein Leben auf der Alm in den bayrischen Alpen, auf der er zusammen mit sechs anderen Überlebenden der »mitteleuropäischen Katastrophe« lebt, die zwölf Jahre zuvor die gesamte Zivilisation in Deutschland und den anliegenden Ländern ausgelöscht zu haben scheint. An seine ersten Jahre vor der Katastrophe erinnert er sich dunkel, zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder lebte er in der Elite-Siedlung Waldweben IV mit jedem erdenklichen Luxus, den das Leben um das Jahr 2045 bereit hielt: mit Robotern für alle erdenklichen Tätigkeiten, ein vollautomatisiertes Leben in vermeintlicher Sorglosigkeit. Übrig ist davon nichts mehr. Die Gemeinschaft führt ein archaisches Leben mit Kühen, Schweinen und Hühnern auf dem Almbauernhof unter einem der letzten funktionierenden Shields, das die – vermutlich wegen des Ozonlochs – tödliche Sonneneinstrahlung abhält und aufgrund seiner Programmierung einen ewig anhaltenden Frühling fernab der »großen Ebene«, auf der vor der Katastrophe Solarfelder standen, gewährt.
Zusammen mit der bereits dementen Anne, einer ehemaligen Krankenschwester, dem ehemaligen CEO und Regierungsmitglied Constantin, dem Ehepaar Özlem und Chang, sie Moderatorin, er Information Architect, und Jorden, einem ehemaligen Soldaten und dem späteren Ressort-Ranger wächst Heinz als »das vielleicht einzige und letzte Kind auf Erden« auf dem Rosenhof auf, das vormals Teil eines rekonstruierten Urlaubsressorts für die Elite war. Sie alle nehmen ihn, den Honk, wie sie ihn liebevoll nennen, nicht ernst – kein Wunder, verbringt er doch jede Minute mit seinem Roboter-Wüstenfuchs, der ihm Märchen erzählt –, bis er eines Tages beginnt, die ersten Sätze der großen, vermeintlich untergegangenen Weltliteratur zu zitieren. Denn noch etwas unterscheidet ihn von den anderen: in seiner rechten Achsel hat Heinz ein kleines, rechteckiges Tattoo, von dem keiner weiß, was es bedeutet, außer dass Heinz es spürt, wenn ihm die Sätze von Shakespeare, Goethe oder aus Mozart-Arien einfallen.
»Aber klar, was sollen die anderen auch mit ‚Parkett’, was mit ‚Erbstück’ oder ‚artgerecht’ anfangen, wenn das, was wirklich zählt, Vorräte, Erne und Fleisch heißt?«
Sprache und Literatur nehmen im Leben der Alm-Gemeinschaft und im Roman selbst eine zentrale Rolle ein. So wiederholen die Bewohner rituell immer wieder »Alt-Wörter«, an die sie sich aus der Voruntergangszeit erinnern, die aber in ihrer Gegenwart keinerlei Bedeutung mehr in sich tragen. Sie sind Relikt einer Kultur, die Heinz und die anderen verloren glauben. Dem fünfzehnjährigen Heinz gegenüber haben jedoch alle anderen Überlebenden der Katastrophe einen Vorteil, sie können sich bewusst erinnern:
»Ich war wirklich kurz davor zu heulen, weil mir bewusst wurde, wie viel Glück die anderen haben, die alle wissen, wer sie sind und woher sie kommen, anders als dieser Junge, als ich.« Den tagebuchartigen Kapitel des Romans dokumentiert das Ich nicht nur die Ereignisse, sondern thematisiert immer wieder die Suche nach seiner eigenen Identität. Wie könnte das auch anders ein, möchte man sagen, wenn hier ein Ich erzählt, das sich im Alter von fünfzehn Jahren auf dem Höhepunkt der Pubertät befindet? Heinz ist jedoch, das wird schnell klar, kein typischer Fünfzehnjähriger. Sexuelle Gedanken liegen ihm fern, er wirkt schon früh nicht ganz menschlich. Bestärkt wird dieser sehr subtile Eindruck von Kommentaren anderer Figuren wie »Zieht mal jemand den Stecker?«
Als das vermeintliche Paradies der Alpen-Alm zu kollabieren droht, da das schützende Shield wegen ausbleibender Wartung immer wieder ausfällt, beschließen die mittlerweile acht Almbewohner – Özlem und Chang haben derweil eine Tochter namens Xiwang (dt. »Hoffnung«) bekommen – die Alpen zu verlassen, denn schon lange gibt es ein Gerücht, das von einem »großen Lager« jenseits des Rheins, der aufgrund der Polschmelze zu einem großen See angewachsen ist, in dem sich Überlebende versammeln.
Das blaue und grüne Heft, die den Mittelteil von »Die Verteidigung des Paradieses« ausmachen, erzählen von der Reise durch das zerstörte Süddeutschland in Richtung Westen.
In diesem Teil des Romans gleicht »Die Verteidigung des Paradieses« am ehesten konventionellen Science-Fiction- und Dystopie-Szenarien, wie sie einem im Hollywoodkino begegnen. Die Reise durch die menschenleere, verlassene Infrastruktur, auf der die Gruppe höchstens auf wahnsinnig gewordenen, kannibalistischen Mutanten trifft, erinnert an Zombie-Filme wie »28 Days Later« oder »World War Z«. Den Eindruck, den man durch die protokollartigen Aufzeichnungen des Ich-Erzählers von der Voruntergangswelt durch am Wegesrand herumliegende Überbleibsel erhält, erinnern zum Teil an die neue HBO-Serie »Westworld«, in der künstliche Lebenswelten und Roboter, die so menschlich gestaltet sind, dass sie nicht gleich als solche zu erkennen sind, omnipräsent sind.
Nicht alle überleben die Reise, und bevor am Ende das rettende französische Ufer erreicht wird, hält der Roman einige Twists und Wendungen für die Reisegesellschaft bereit, die in ihrer Ereignisfolge ebenfalls aus dem Popcornkino stammen könnten. Schlecht erzählt ist diese Odyssee dabei keinesfalls; »Die Verteidigung des Paradieses«
ist kurzweilig und hält den Spannungsbogen bis zu den letzten Seiten, auf denen Heinz’ Rolle aus der Retrospektive mithilfe des Gedächtnissystems ARCHIVA aufgelöst wird und (fast) keine Fragen offen bleiben.
»Solange ich schreibe, überleben wir.«
»Die Verteidigung des Paradieses« ist, so verkündet Klappentext des Verlags, ein Roman darüber, was es heißt, Mensch zu sein – von Steinaeckers Ansatz ist ein literarischer, denn was die Gemeinschaft vom Wahnsinn abhält, ist die Vergegenwärtigung der Sprache. Das Wiederholen von vergangenen Alltagswörtern und den ersten Sätzen der Weltliteratur, das Aufzeichnen und das Geschichten erzählen ist zentral in diesem dystopischen Roman. Gleichzeitig funktioniert diese Selbstversicherung über das Sprechen nur in der Gemeinschaft; als Heinz während der Reise kurzzeitig in Einzelhaft sitzt, verwehren die sonst so rettenden Worte dem Ich-Erzähler den rettenden Sinn, sie verschwimmen: »Zusammengerollt hängen die Fingernägel wie die Ringe von einem Baum, dessen Name mir nicht einfällt. Birke? Barke? Berke? Fahrnis? Fuhrnuß? Fährnuß? Härte? Hürte? Hörte?«
Sprachlich ist »Die Verteidigung des Paradieses« nicht unbedingt poetisch – vor allem die vielen Anglizismen des jugendlichen Ichs verhindern dies –, aber ausgesprochen intelligent, vielseitig und spannend. Auch wenn es für die Shortlist zum Deutschen Buchpreis nicht gereicht hat – zu den wichtigsten deutschsprachigen Dystopien des Jahres gehört »Die Verteidigung des Paradieses« in jedem Fall.
Besprechung von: Tabitha van Hauten, Mitbetreiberin des Blogs Zeilensprünge
Thomas von Steinaecker: Die Verteidigung des Paradieses. Roman, S. Fischer Verlag 2016, 416 Seiten, 24,99€.





 Gerold Ebner steht aber nicht erst heute am Rand, er steht schon seit seiner Geburt am Rand. Seine Mutter ist eine Prostituierte, die weggelaufen ist aus dem sehr patriarchal geführten elterlichen Haus, sexuelle Ausbeutung hat dort wahrscheinlich auch stattgefunden, in Glurns (Südtirol). Sie ist nach Bludenz (Vorarlberg) gelangt, arbeitet seit Gerolds Geburt im Kloster als Altenpflegerin, hat eine Wohnung in der Südtirolersiedlung bezogen. So wie ihr Land schwankend war in seiner Zugehörigkeit, mal österreich-ungarisch, im nächsten Moment italienisch, aber mit einer großen Sehnsucht, dass Hitler sie „Heim ins Reich“ hole, so unterstellte man auch den Südtirolerinnen Wankelmut: „Mal zu den Faschisten, mal zu den Nazis, mal zu den Widerstandskämpfern. Nicht deutsch und nicht nichtdeutsch, waren sie, mal hier, mal da.“ Und so wird Gerold gleich zweifach ausgegrenzt aus der Gemeinschaft in der Schule: als Sohn einer Prostituierten – dass die nun bei den Nonnen arbeitete, zählt nicht – und als Südtiroler Junge, erkennbar an der Adresse und am Dialekt: „Überall wurde Ortsfremden zu verstehen gegeben, dass sie anders waren.“
Gerold Ebner steht aber nicht erst heute am Rand, er steht schon seit seiner Geburt am Rand. Seine Mutter ist eine Prostituierte, die weggelaufen ist aus dem sehr patriarchal geführten elterlichen Haus, sexuelle Ausbeutung hat dort wahrscheinlich auch stattgefunden, in Glurns (Südtirol). Sie ist nach Bludenz (Vorarlberg) gelangt, arbeitet seit Gerolds Geburt im Kloster als Altenpflegerin, hat eine Wohnung in der Südtirolersiedlung bezogen. So wie ihr Land schwankend war in seiner Zugehörigkeit, mal österreich-ungarisch, im nächsten Moment italienisch, aber mit einer großen Sehnsucht, dass Hitler sie „Heim ins Reich“ hole, so unterstellte man auch den Südtirolerinnen Wankelmut: „Mal zu den Faschisten, mal zu den Nazis, mal zu den Widerstandskämpfern. Nicht deutsch und nicht nichtdeutsch, waren sie, mal hier, mal da.“ Und so wird Gerold gleich zweifach ausgegrenzt aus der Gemeinschaft in der Schule: als Sohn einer Prostituierten – dass die nun bei den Nonnen arbeitete, zählt nicht – und als Südtiroler Junge, erkennbar an der Adresse und am Dialekt: „Überall wurde Ortsfremden zu verstehen gegeben, dass sie anders waren.“
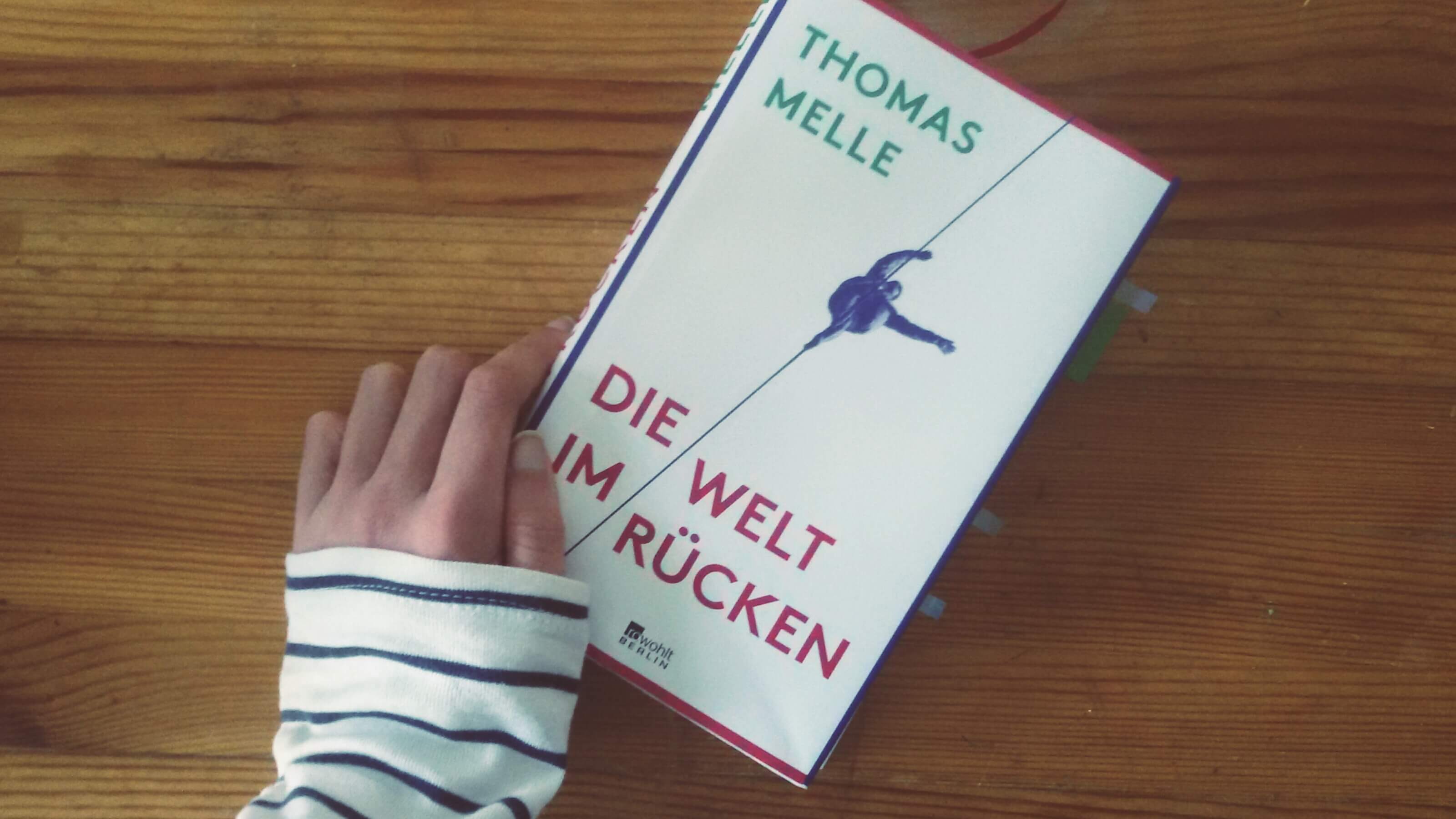
 Fast könnte man tatsächlich meinen, dass Reither so ziemlich mit allem in seinem Leben abgeschlossen hat: seinen Kleinstverlag samt Miniaturbuchhandlung hat er liquidiert, hat sich aus Frankfurt zurückgezogen in ein kleines Appartement im Weissachtal, ganz im Süden Bayerns, kurz vor der Grenze zu Österreich. Hat im letzten Jahr zum letzten Mal eine Reise nach Italien unternommen und nun sein Auto verkauft, nicht, weil es ihm nicht mehr gefallen hätte dort, vielmehr, weil „ja alles Schöne irgendwann zum letzten Mal (geschieht) (…) Und besser, man bestimmt diesen Zeitpunkt selbst.“ An diesem Abend, als ihm das erste unerwartete Ereignis zustößt, öffnet er die letzte Flasche des Weines, den er im letzten Jahr gekauft hat in Apulien.
Fast könnte man tatsächlich meinen, dass Reither so ziemlich mit allem in seinem Leben abgeschlossen hat: seinen Kleinstverlag samt Miniaturbuchhandlung hat er liquidiert, hat sich aus Frankfurt zurückgezogen in ein kleines Appartement im Weissachtal, ganz im Süden Bayerns, kurz vor der Grenze zu Österreich. Hat im letzten Jahr zum letzten Mal eine Reise nach Italien unternommen und nun sein Auto verkauft, nicht, weil es ihm nicht mehr gefallen hätte dort, vielmehr, weil „ja alles Schöne irgendwann zum letzten Mal (geschieht) (…) Und besser, man bestimmt diesen Zeitpunkt selbst.“ An diesem Abend, als ihm das erste unerwartete Ereignis zustößt, öffnet er die letzte Flasche des Weines, den er im letzten Jahr gekauft hat in Apulien.

