H.C. Artmann: Das poetische Werk – Zimt & Zauber
NEUN HAIKAI
um die treibhäuser
aller gärtner im frühjahr:
plast und metallmüll.
hier welkt der flieder
schon aus seinen knospen braun;
kein wort von lila.
montag, wenn jasmin
aus abgenagten stiften
modrig hervorwächst.
dienstag, ein bißchen
blauverwaschene stimmung
über dem schreibtisch.
mittwoch, weniger
idealismus im leib
als ideen im kopf
donnerstag, fliegen
auf meinen manuskripten
und eine motte.
freitag, eine frau
mit der verhatschten syntax
doofer gedichte
sonnabend, blätter
neben der tippmaschine,
die eben verreckt.
domingo, dimanche,
domenica, sunnantac;
morgen ist montag.
Ich betrachte die folgenden texte…
Ich betrachte die folgenden texte als bloße inhaltsverzeichnisse für den leser, als literarisierte inhaltsverzeichnisse freilich; als anhaltspunkte und als ideen für noch nicht existierende, erst in der vorstellung sich vollziehende gegebenheiten. Ich versuche mich also praktisch in ausgriffen auf die zukunft. Ein inhaltsverzeichnis weist auf etwas hin, das erst zu realisieren wäre: es ist ein vorentwurf, und ein solcher befaßt sich mit der zukunft.
Mit diesen texten soll ein weg, eine methode gefunden werden, um von der engen und allgegenwärtigen vergangenheit, wie sie da in der literatur als abgehalfterter Ahasver herumgeistert, wegzukommen. Hiermit soll der sehnsucht nach einer besseren vergangenheit entgegengetreten werden; wehmütiges sicherinnern ist fruchtlos, ein abgestorbner kirschbaum, der sich nie mehr beblättern wird. Wohl bin ich romantiker – aber war nicht jede romantik von etwas erfüllt, das uns hin und wieder gegen ende des winters gleich einer noch unrealen frühlingsbrise überfällt?
Auch die konventionelle science-fiction ist meist nichts anderes als in die zukunft projizierte vergangenheit (kenntlich allein schon am imperfektstil), obendrein dominiert der vergangenheitscharakter jedenfalls eindeutig in ihr.
Warum inhaltsverzeichnis? Warum so viel unausgeführtes? Warum nur angedeutetes? Warum nur versprechungen? – Warum denn nicht? Eine eindeutige antwort soll nicht gegeben werden, weil sprache festlegt; jeder leser mag jedoch für sich herausfinden, was diese texte ihm persönlich an möglichkeiten anbieten.
Auf die frage, welche von diesen möglichkeiten mir selbst am meisten am herzen liegen, kann ich nur antworten: jene, die in die westliche, in die atlantische richtung weisen, jene abenteuer, die ich bei der lektüre der fragmentarischen altirischen dichtung er-lebte, durch-lebte und noch heute weiter-lebe.
H.C. Artmann, aus: Unter der Bedeckung eines Hutes, Residenz Verlag, 1974
Editorische Notiz
Es waren 16 Haiku, die im Manuskripte-Heft zu Alfred Kolleritschs 50. Geburtstag gedruckt wurden. Sieben davon wurden in die Sammlung nachtwindschnur übernommen und zwar die Nummern 4, 5, 6, 7, 9, 10 und 12.
Die Gedichte aus Vier Scharniere mit Zunge sind H.C. Artmanns Beiträge zu einer Renshi-Kettendichtung, an der sich außerderdem Makoto Ooka, Oskar Pastior und Shuntaro Tanikawa, sowie die Übersetzer Hiroomi Fukuzawa und Eduard Klopfenstein beteiligten.
Die Sammlungen das prahlen des urwaldes im dschungel, nachtwindsucher, album und st. achatz am walde – ein holzrausch wurden jeweils vollständig nach den Erstausgaben chronologisch gedruckt.
Den Band beschließen drei Gedichte aus dem noch nicht beendeten Zyklus gedichte aus dem botanischen garten.
Die Entstehungsdaten der Gedichte finden sich im Inhaltsverzeichnis.
Rainer Verlag und Verlag Klaus G. Renner
Editorische Notiz der Verleger
Die Idee zu einer mehrbändigen, aufgegliederten Ausgabe des damals schon auffällig vielschichtigen poetischen Œuvres von H.C. Artmann in der „Kleinen Reihe“ des Rainer Verlages – naheliegend erschien es damals – entstand 1967. Sie wurde – wie die meisten „Ideen“ von Verlegern – aufgrund dieser und jener Entwicklung (des Autors, seiner ständigen Wohnwechsel, des kleinen Verlages und seiner Probleme) ad acta gelegt, eigentlich aber nie aus dem Gedächtnis entlassen.
1969 erschien die von Gerald Bisinger mit Liebe und Fleiß betreute Sammlung Ein lilienweißer Brief aus Lincolnshire im Suhrkamp Verlag. 1978 auch in Taschenbuchform, die bis dahin vollständigste Zusammenstellung der Gedichte, welche bis heute Gültigkeit und Wirksamkeit erlangt hat.
Viele Jahre später, im Herbst 1991 also – was im Durcheinander der Frankfurter Buchmesse nicht möglich – nämlich bei einem Besuch der Renners bei Rainers im ungarischen Fünfkirchen, gerät diese „Idee“ wieder ins Blickfeld: ein mehrbändiges Werk, verteilt auf zwei Schultern.
Salzburg, Wohnort des H.C., liegt zwischen Fünfkirchen und München, zwischen Rainer und Renner. H.C. gibt also wenige Tage später sein Placet, bekundet Wohlwollen, avisiert gar seine Mitwirkung. Auch Klaus Reichert in Frankfurt am Main – nobilder und aufrechter Herausgeber vieler Werke H.C.s – wird sofort gewonnen.
1992 – Klaus Reichert hat seine nicht mühelose Arbeit angefangen, fortgeführt und mit H.C. abgestimmt – die, von den Verlegern übernommen, die Bandzahl der Gesamtausgabe auf zehn Stück (ursprünglich acht) ausgeweitet bzw. begrenzt. Die redaktionelle Arbeit des Herausgebers und des Autors ist vorläufig abgeschlossen.
Im Sommer 1993 beginnen Pretzell und Renner unter Nutzung der typographischen Vielfalt einer 1992 erworbenen leistungsfähigen Photosatz-Maschine die Ausführung der ersten Bände.
Frühjahr 1994 – Beendigung der Satzarbeiten. Die Drucklegung kann beginnen…
Klaus G. Renner und Rainer Pretzell, Nachwort
Beiträge zur Gesamtausgabe: Das poetische Werk
Fitzgerald Kusz: Kuppler und Zuhälter der Worte
Die Weltwoche, 18.8.1994
Andreas Breitenstein: Die Vergrößerung des Sternenhimmels
Neue Zürcher Zeitung, 14.10.1994
Thomas Rothschild: Die Schönheit liegt in der Abwesenheit von Nützlichkeit
Badische Zeitung, 15.10.1994
Franz Schuh: Weltmeister jedweder Magie
Die Zeit, 2.12.1994
Albrecht Kloepfer: Hänschen soll Goethe werden
Der Tagesspiegel, 25./26.12.1994
Karl Riha: Wer dichten kann, ist dichtersmann
Frankfurter Rundschau, 6.1.1995
Christina Weiss: worte treiben unzucht miteinander
Die Woche, 3.2.1995
Dorothea Baumer: Großer Verwandler
Süddeutsche Zeitung, 27./28.5.1995
Armin M.M. Huttenlocher: Narr am Hofe des Geistes
Der Freitag, 25.8.1995
Jochen Jung: Das Losungswort
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.12.1995
Das hobson-jobson’sche im Werke H.C. Artmanns
Vielen Dank Herr Prof. Greisenegger für die einführenden Worte und guten Tag meine Damen und Herren…
ich möchte heute H.C. Artmann und sein Werk mit einer ganz bestimmten Gattung der europäischen Literatur in Beziehung setzen: und zwar mit Wörterbüchern. Die Begeisterung für Wörterbücher war etwas, das mich mit H.C. über die Jahre sehr verbunden hat und bevor ich Ihnen mehr darüber erzähle, möchte ich einen Blick auf die Jugendjahre H.C.s werfen.
Es wird oft erwähnt, daß H.C. bereits mit ungefähr 14 Jahren Detektivgeschichten unter dem Namen John Hamilton schrieb, und diese unter seinen Schulkameraden verteilte.
Und etwa zur selben Zeit begann er mit Hilfe von Grammatiken, die er von einem Onkel bekommen hatte, mit seinen autodidaktischen Sprachstudien.
Diese Geschichten sind schön, aber ein Neider hätte vielleicht meinen können, daß er ein Streber war, oder vor seinen Mitschülern unbedingt brillieren wollte – und daher bin ich froh, daß H.C. mir noch ein paar andere Geschichten erzählt hat, die ein anderes Licht auf seine frühe Beschäftigung mit Sprache und Wörtern werfen. So erzählte er mir zum Beispiel, wie er als junger Bub in Wien stundenlang indische Briefmarken in der Auslage eines Ladens studierte.
-> ERSTES OVERHEAD
Hier sehen sie eine schöne indische Briefmarke aus dem 19ten Jahrhundert, wie H.C. sie damals vielleicht im Schaufenster gesehen hat.
-> ZWEITES OVERHEAD
und hier eine andere, jetzt aus den 30ern, wohlgemerkt nicht nur in Englisch, sondern auch in Hindi…
-> DRITTES OVERHEAD
und weil die letzte Marke etwas kompliziert war, möchte ich Ihnen eine Briefmarke späteren Datums zeigen, in der die Schrift besser zu lesen ist. Und darum geht es jetzt…
Solch eine Briefmarke hatte H.C. gesehen und er erzählte, daß er die Devanagari-Schrift, das heißt, die Zeichen der indischen Schrift, nachmalte und sie anhand der darunterstehenden lateinischen Buchstaben zu entziffern versuchte. Wie er freilich zugab, war seine Methode etwas fehlerhaft: die Devanagari-Schrift steht für „Bharat“, der Hindi Name Indiens, und nicht für „India“, wie auf der Briefmarke zu lesen ist. Aber was mir an dieser Geschichte besonders gefällt, ist, daß sie zeigt wie H.C. sich nicht nur als Autor von Detektivgeschichten sah, sondern daß er sozusagen als Detektiv im eigenen Auftrag arbeitete. Und mag seine Übersetzung der Devanageri-Schrift etwas fehlerhaft gewesen sein, so, erzählte er, bildete die Schrift immerhin die Basis für die Geheimschrift die er in seinem Tagebuch benutzte.
Noch weiteren Stoff für seine Dechiffrierarbeit bekam H.C., wie er mir erzählte, als ihm seine Mutter ein ganz besonderes Buch zum 14. Geburtstag schenkte: The Gospel in Many Tongues, von der British and Foreign Bible Society, in dem ein Bibelsatz „Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab“ in 665 Sprachen, mitsamt den Schriften, übersetzt stand. Man kann sich schön vorstellen, wie er sich daran ergötzt haben muß.
Artmanns Faszination für Sprachen hörte nie auf. Wie die Nadel eines Kompaß wurde er magnetisch vom Fremden, vom Anderen angezogen. Bei meinen Besuchen bei H.C., anfangs um Übersetzungsprobleme zu diskutieren, später aus tiefer Freundschaft, habe ich immer wieder über seine abstruse Lektüre staunen müssen. Auf seinem Schreibtisch lagen Werke wie das Goddodin – ein frühwalisisches Epos des 7ten Jahrhunderts, oder ein Hottentot Lexikon, oder ein Assyrisches Wörterbuch. Solche Werke waren gleichzeitig Werkzeug und Inspiration für ihn, wie z.B. Terebelskys Vollständiges Handbuch der Böhmischen Sprache von 1853, das den Montagen von H.C. und Konrad Bayer zugrunde liegt. Oder die armenischen und tibetischen Wörterbücher, mit deren Hilfe er später eigene Dialekte erfand und in seine Erzählungen einbaute – ich denke dabei an das Tibetische in Tök ph’rong süleng oder das Transylvanische in Drakula Drakula. Er amüsierte sich köstlich über die Verzweiflung die seine Erfindungen bei den Spachforschern auslöste, die versuchten die benutzten Quellen ausfindig zu machen.
Auch ich bin ein Liebhaber von Wörterbüchern und von einer Reise aus Nepal, brachte ich H.C. den Hobson-Jobson mit, ein Wörterbuch, das gerade neu aufgelegt worden war.
Ich wußte, daß es ihm gefallen würde, aber das Ausmaß der Begeisterung H.C.s hätte ich nicht erwartet. In den darauffolgenden Jahren konnte ich ihn kaum besuchen, ohne daß das Buch immer wieder konsultiert wurde. Er empfahl es seinen Freunden, und während eines sehr langen Aufenthaltes im Krankenhaus hatte er, wie ich später von ihm erfuhr, das Lexikon ständig bei sich auf seinem Nachtisch liegen – als Rettungsanker, wie er sagte. Was könnte das denn für ein Buch sein?
Veröffentlicht wurde das 1000-seitige Werk, mit dem Untertitel A glossary of colloquial Anglo-Indian words and phrases, bereits 1886. Zusammengestellt wurde es von Sir Henry Yule, seines Zeichens Marco Polo Übersetzer und Forscher, und Arthur Burnell, Richter in Südindien und Sanskrit Gelehrter. Also, zwei wohlsituierte Gentlemen, die fasziniert waren von diesen Wörtern, die sie als „organische Überbleibsel“ bezeichneten, die „von den verschiedenen Strömungen äußerer Einflüsse hinterlassen wurden, die während zwanzig oder mehr Jahrhunderten die Gestaden Indiens überspült haben“.
Daraus entstand Anglo-Indian, die Sprache der Briten in Indien, die sie unter sich und mit den Einheimischen verwendeten. Die Zahl der Fremdsprachen die darin einmündeten, sind fast so zahlreich wie die in The Gospel in Many Tongues: Hindi, Urdu, Marathi, Persisch, Chinesisch, Portugiesisch usw. und so fort. Viele Wörter, die wir im Hobson-Jobson finden, sind hier in Europa noch geläufig, z.B. Khaki, Teakholz, Rattan, Punsch, Mandarin (aus dem Portugiesischen!!), Artischocke, Chintz usw.. Für solche Worte ist das Buch eine etymologische Fundgrube. Aber eine Wunderkammer wird an den Stellen daraus, an denen die Wörter nicht nur einfach importiert wurden, sondern an die akustischen Gegebenheiten der neuen Sprache – in diesem Falle Englisch – angeglichen wurden. Der Titel des Buches – Hobson-Jobson – ist ein Beispiel dafür:
Das Wort Hobson-Jobson ist eine anglo-indische Bezeichnung für ein Spektakel oder eine feierliche Aufregung unter den Einheimischen, und kommt von der Beobachtung der moslemischen Muhárrám Zeremonie. Dabei ziehen lange Prozessionen von Pilgern durch die Straßen, schlagen sich auf die Brust, und schreien zum Gedenken die Namen von Mohmades Enkeln, die im Heiligen Krieg starben: Ya Hasan! Ya Hosain! Mit einer ungeheuren Sorgfalt zeigen Yule und Burnell die Verwandlung dieses Ausrufes über dreieinhalb Jahrhunderte an 17 Beispielen – von Vah Hussein! sciah Hussein (Italian, 1618), über Hosseen Gosseen (England, 1673 – hier bereits als eine allgemeine Bezeichnung für solche lärmreiche Festivitäten verwendet), bis schließlich 1829 the Oriental Sporting Magazine endgültig Hobson-Jobson schrieb.
Das Wort Hobson Jobson klingt zwar sehr englisch, hat aber keine eigentliche Bedeutung. Anders verhält es sich aber bei vielen anderen Worten in dem Buch: Isle o’ bats (Fledermausinsel) war ein anglo-indischer Name für Allahbad oder Ilahabaz; die Insel Shang-Chuang auf welcher der Heilige Francis Xavier starb wurde St. Johns; und man sieht wieviel Fantasie im Spiel ist, wenn sich das portugiesische Wort für Cholera, „mordexim“, langsam in Mort-de-chien (Hundetot) verwandelt, komplett mit falscher französischer Etymologie. Diese systematische Korruption läßt sich vermutlich in allen Sprachen entdecken: das bekannteste Beispiel in der Deutschen Sprache ist das Wort Hängematte, dessen Ursprünge in dem westindischen Wort Hamac liegen, und nichts mit hängen und Matte zu tun haben.
Für mich ist es völlig klar, daß ein Dichter mit einem so starken historischen Bewußtsein für Sprachen und Worte wie H.C. sich für diese Recherchen einfach begeistern mußte. Und daß er eine starke philologische Bestätigung für seine poetische Arbeit in dem Buch fand. Ganz abgesehen von seiner Anglophilie, seinem Hang zum Anachronistischen und Abstrusen, und seiner Liebe für rechtschaffende Burschen und klarumrissene Typen, wie die Wallahs und Pukka Sahibs und Offiziersfrauen und sogar Kannibalen die überall in Hobson-Jobson vorkommen.
Das Poetische läßt sich in der Tat auf fast jeder Seite von Hobson-Jobson finden. Nicht nur in den vielen Gedichten, die zitiert werden, die, ganz im Geiste von H.C.s Arbeiten, keinen Unterschied zwischen ,high‘ and ,low culture‘ zulassen: also: Knittelverse, neben Gedichten von Knastvögeln und Hindi-Reime, neben Versen von Erasmus Darwin und Perlen der Barockpoesie.
Poetisches läßt sich sogar in Definitionen finden, wie z.B. bei „zircon“, ein Edelstein dessen Name sich von dem Spanischen zarca „eine Frau mit blauen Augen“, herleiten läßt. Oder in Fragmenten, wie die Geschichte, die unter dem Stichwort ,Pyjamas‘ erzählt wird, in der ein Gentleman seinen Schneider kurz vor Antritt einer Reise nach Indien besucht, und fragt warum seine neuen Pyjamas Füße hätten. Darauf antwortet der Schneider: „I believe, Sir, it is because of the White Ants“. Ein Fragment das gleichzeitig ein enigmatisches Ganzes bildet, und mich daran erinnert wie genial H.C. ein Romankapitel auf ein paar Wörter reduzieren konnte. Und mich sogar an die Concetti und Greguerías erinnert, die er Anfang der 50er Jahre komponierte.
Aber das Poetische liegt vor allem in den Wörtern selbst. Worte, die in Hobson-Jobson als Drehpunkte zwischen Sprachgebrauch und Erfahrungswelten gezeigt werden.
Wir lesen nicht bloß Definitionen mit historischem Beiwerk, sondern Beschreibungen vom Werdegang und Umgang der Wörter, und die Facetten der Welten, in denen sie sich bewegen. Wörter werden in ihrer ganzen Potenz und mit ihrem ganzen Potential präsentiert, wie sie vor der changierenden Kulisse der anglo-indischen Erfahrungswelt agierten.
Dazu paßt das was H.C. 1967 bei den Literarischen Colloquium in Berlin sagte:
Worte haben eine bestimmte magnetische Masse, die gegenseitig nach Regeln anziehend wirkt, sie sind gleichsam „Sexuell“, sie zeugen miteinander, sie treiben Unzucht miteinander, sie üben Magie, die über mich hinweggeht, sie besitzen Augen, Facettenaugen wie Käfer und schauen mich unaufhörlich und aus allen Winkeln an. Ich bin Kuppler und Zuhälter von Worten und biete das Bett…
Das Bett das er bietet ist aber so voller Überraschungen wie die Lebenswelten, denen wir in Hobson-Jobson begegnen. Systematisch wie ein Wörterbuch, wie ein Sammler, baute H.C. seine eigenen Systeme auf – um sie immer wieder durch Brechungen zu unterminieren, oder besser gesagt: in neue Bewegung zu bringen. Ich denke dabei an einen Zyklus wie Persischen Quatrainen, beim ersten Blick eine Hommage an Hafis oder Omar Khayam. Aber H.C. erzählte mir, daß er sie so geschrieben hat, als wäre er der berühmte Rubaiyat Übersetzer Edward Fitzgerald, aber eben als wäre Fitzgerald ein Deutscher. Das Schillernde wird immer wieder bewußt durch neue Begegnungen von Welten und Worten heraufbeschworen. Oder in dem Text „Tök ph’rong süleng“, wo mir klar wurde, daß der klassische Stoff einer Werwolfgeschichte im Stil Lord Dunsanays geschrieben worden war. Aber ebenfalls auf Deutsch. Solche Brechungen sind natürlich nicht direkt in Hobson-Jobson zu finden. Aber die sind überall in dem Sammelsurium von Worten, die wir eine Sprache nennen, sei es Anglo-Indisch, oder die Sprachwelten die H.C. ins Leben rief.
H.C. verstand sich nicht als jemand der einfach – wenn das überhaupt einfach sein kann – Gedichte schreibt. Spätestens mit seiner „Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Aktes“ von 1953 wurde klar, daß es für ihn bei der Poesie um Haltung, Lebensformen, Lebensweisen geht. Und wenn ich zurück zu meinen anfänglichen Gedanken über den jungen H.C. komme, verstehe ich auch, warum ich gerade den Briefmarkenforscher H.C. so interessant finde. Zwar war der Krimiautor John Hamilton eine von H.C.s ersten literarischen Personen oder Masken, wie er sie überall in seinen Werken aufgesetzt hat. Aber als Detektiv vor dem Briefmarkenladen zog er die Maske des Under-cover Agents an. Er arbeitete unbemerkt, im eigenen Auftrag, und unbeeinflußt von außen. Und als Lebensform war das für den werdenden Dichter sehr aufschlußreich. Wie ein Lexikograph mußte er systematisch arbeiten, und womöglich schulte er hier seine fabelhafte Beobachtungsgabe. Und die hatte H.C. sein Leben lang: Mehr noch, er konnte in die Haut Anderer fahren – wie er selbst sagte – und darin aufgehen. Das habe ich immer wieder bei ihm gesehen, gerade im Alltag. Kleinigkeiten, Fragmente, eine Physiognomie, oder der Klang einer Stimme, erzählten ihm Bände. Dinge in seiner Umgebung wie Speisekarten, Straßenschilder, oder ein Gebäude wie z.B. in London, wo Aleister Crowley einst wohnte, konnten ihn minutenlang fesseln. Und Wörter, wie eben aus Hobson-Jobson, konnte er über seinen Gaumen hin und her rollen lassen, wie die Tropfen eines kostbaren Weines…
Die Maske des jungen Detektivs – mit allem was dazugehörte, wie die Kenntnis von Fremdsprachen und die Beherrschung von Geheimschriften – erlaubte ihm neue Richtungen einzuschlagen, neue Welten selbst zu entdecken und auch neu zu erfinden.
Dies zeigt wiederum etwas, daß man allzu schnell vergißt: daß eine Maske nicht bloß Tarnung sein muß, ein Mittel um sich zu verstecken, sondern auch und vor allem bei H.C. etwas Beflügelndes hat, auf Englisch würden wir ,empowering‘ sagen, das Ungeahntes möglich macht. Der eigene Enthusiasmus wird potenziert, ein Teil vom Ich wird ausgeschaltet, damit andere, neue Welten erschlossen werden können:
Welten die bei H.C. nicht bloß Zufluchtsorte sind, nicht Zerrspiegel, sondern so voller Potential sind, wie das Leben selbst, und an denen wir uns laben und uns erquicken können, wenn die Möglichkeit unseres Alltags zu beschränkt zu sein scheinen. Ein Alltag aber – wie vielleicht in der heutigen Zeit immer klarer wird – in der wir uns immer neu erfinden müssen, an den wir uns immer neu oktroyieren müssen. H.C. zeigt uns all dies und damit erfüllt er für mich eine der höchsten Möglichkeiten der Poesie.
Malcolm Green, manuskripte, Heft 153, 2001
H.C. ARTMANN
wartump knast tu sott klosse auen
wömm wöllst erschröcken mit der nösen
mit dämnen schandmaleur des zahlstein
wossu der omma brülle an der brauen
mit a stimm so koalt und grauen
wie ist mir ach die kehle weh
ein piff ein paff en puffer fehl er geh
am hals am ohr samt bart vorbeh
wo bleibst denn mit dei scheren
im hirn uns zu verklären
schau nicht den wein am nachtschrank stehn
gib s pfötchen meinem enkel schön
und dann verzisch dich im
turnschuhsenkelhalsumdrehn
Peter Wawerzinek
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 1)
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 2)
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber
Fakten und Vermutungen zum Autor + Reportage +
Archiv + Sammlung Knupfer + IMDb + KLG + ÖM
Interview 1 + 2 + Georg-Büchner-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf H.C. Artmann: FAZ ✝︎ Standart ✝︎ KSA
70. Geburtstag + 10. Todestag
Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Die Jagd nach H.C. Artmann von Bernhard Koch, gedreht 1995.
H.C. Artmann 1980 in dem berühmten HUMANIC Werbespot „Papierene Stiefel“.




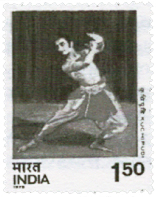
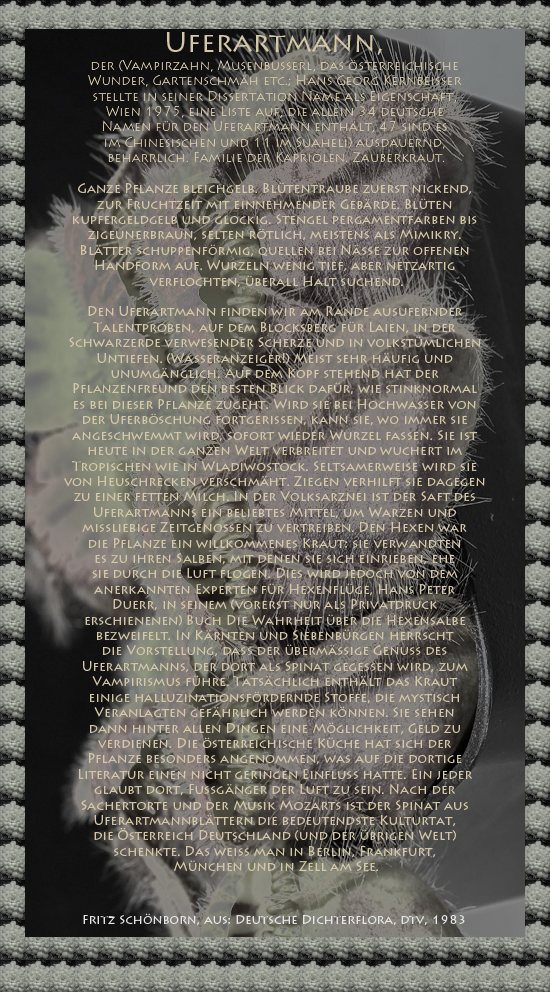








Schreibe einen Kommentar