Walter Höllerer (Hrsg.): Ein Gedicht und sein Autor
DIE MASCHINEN
Manche Maschinen sind früh aufgekommen,
andere spät. Außer der Zeit, der sie angehören,
hat die Welt keinen Platz für sie.
Heronskugel Wurfschleuder Voltasäule.
Die Große Fahrkunst zu Falun. Kuriosa:
Die „pneumatische Kornfege“
Una macchina per riscaldare i piedi
Die uns auffallen, das sind Maschinen
aus einem fremden Jahrhundert: sie wirken ortlos.
Sie werden deutlich, nehmen Bedeutung an.
Doch was sie bedeuten, weiß niemand.
Das Kunstgezeug: eine Vorrichtung
aus zwei gegenläufigen Stangen, um Kraft
über große Strecken hinweg zu überführen.
Was bedeutet das Kunstgezeug?
Die Bergwerke im Harz anno 1723
Der Kupferstich wimmelt von Leuten. Menschen,
klein wie Fliegen, fahren auf und ab in den Körben,
und „La Grande Machine«, Abbildung Ziffer j,
neben dem sprudelnden Wasserfall, treibt alle Riemen an.
Es wäre ohne weiteres denkbar,
Dampfmaschine und Kunstgezeug,
Heronskugel und Voltasäule
zu kombinieren. Niemand hat das getan.
Möglichkeiten als Überbleibsel.
Eine fremde Sprache, die nie jemand sprach.
Und genau genommen ist die Grammatik
selber eine Maschine,
die unter unzähligen Sequenzen
das Gebrabbel der Kommunikation auswirft:
die „Fortpflanzungswerkzeuge“, die „Zeugungsglieder“,
die „Schreie“, das „erstickte Geflüster“.
Wenn die Wörter verschwunden sind, bleibt die Grammatik zurück
und das heißt: eine Maschine. Doch was sie bedeutet,
weiß niemand. Eine fremde Sprache.
Eine durchaus fremde Sprache.
Eine durchaus fremde Sprache.
Eine durchaus fremde Sprache.
Der Kupferstich wimmelt von Leuten. Wörter,
klein wie Fliegen, fahren auf und ab in den Körben,
und „La Grande Machine“, Abbildung Ziffer j,
neben dem sprudelnden Wasserfall, treibt alle Riemen an.
Mein Gedicht „Die Maschinen“ schließt in sich ein offenbares Paradoxon, das vielleicht einen Kommentar verträgt. Um den Blick auf seine Beschaffenheit freizumachen, möchte ich zunächst ein paar Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, die im Detail stecken.
Daß die Heronskugel ein antiker Vorläufer der Dampfturbine (angeblich eine Erfindung des Alexandriners Heron), daß die Voltasäule eine Ahnin der modernen Flüssigkeits-Batterie und die Wurfschleuder eine primitive Form der Artillerie, nämlich ein riesiges Gerät ist, das mit Steinen schießt, brauche ich kaum zu erklären.
Weniger bekannt dürfte die Große Fahrkunst zu Falun sein. Es handelt sich um eine enorme Vorrichtung zur Erzförderung, die Christopher Polhem, ein Zeitgenosse von Wilhelm Leibniz, für die größte schwedische Kupfergrube seiner Zeit konstruierte. Die Konstruktion bestand fast ausschließlich aus Holz. Sie wurde durch Wasserkraft angetrieben. Wie manche andere Erfindungen des achtzehnten Jahrhunderts wirkt die Große Fahrkunst von Falun gewissermaßen „maschineller“ als moderne Maschinen. Das mag an der altertümlichen Art der Kraftübertragung liegen, für die ein klobiges und umständliches System von gegenläufigen Gestängen sorgte. Das Original jener riesigen Konstruktion ist heute eine Ruine: es ist längst verwittert und verfault. Doch hat sich Polhems eigenes Modell der Maschine erhalten; es wird im Technischen Museum zu Stockholm aufbewahrt. Diese Vorrichtung bewegt sich ruckartig, intrikat und unbarmherzig: der Eindruck läßt sich kaum beschreiben.
Die „pneumatische Kornfege“ ist ein Kuriosum, dessen Spuren man in alten Lehrbüchern der Physik finden kann. „Una macchina per riscaldare i piedi“ ist eine Reminiszenz an jene Zeiten, da die mechanischen Erfindungen noch gleichsam in der Luft hingen. Die Renaissance betrachtete Maschinen als Gegenstände der Unterhaltung und der Verwunderung, die zum Inventar der fürstlichen Kuriositätenkabinette gehörten; allenfalls konnte die eine oder andere sinnreiche mechanische Vorrichtung der Bequemlichkeit eines adligen Herrn in seinem Lehnstuhl dienen.
Die Mechanik stand damals sozusagen noch jenseits der Erfahrung; mit der Produktion hatte sie nichts zu schaffen; sie genoß, als eine Art von Taschenspielerei, wie die Kunst eine zweifelhafte Autonomie.
Das Kunstgezeug schließlich war eine Art von Transmission, die im achtzehnten Jahrhundert die Umgebung der Bergwerke auf weite Strecken hin beherrscht haben muß: wenn man will, ein Vorläufer unserer Hochspannungsleitungen. Die Wasserkraft wurde vom Schaufelrad über Pleuel auf ein System von gegenläufigen, hin- und hergehenden Stangen übertragen. Solche Kunstgezeuge, auf hohen Pfählen montiert, liefen zuweilen kilometerweit über das Gelände hin; sinnreiche Vorrichtungen, sogenannte Kunstkreuze, erlaubten es, die Laufrichtung im rechten Winkel zu ändern.
Sie werden bemerken, daß ich es vermieden habe, eine Maschine aus meiner eigenen Zeit in das Inventar des Gedichts aufzunehmen. Mit voller Absicht. Was mich hier interessiert, das sind nicht die Maschinen selbst: es ist ihre mechanische Natur. Nicht ihre Funktion, sondern ihr maschineller Charakter. Dieser schwer bestimmbare Zug aber tritt an Maschinen, die veraltet oder zu Kuriosa geworden sind, deutlicher hervor als an jenen, die uns heute umgeben. Er zeigt sich an Vorrichtungen, die außerhalb der alltäglichen Zusammenhänge stehen, und für die die Welt, wie das Gedicht sagt, „keinen Platz hat“.
Daß ein Gedicht von Maschinen handelt, ist natürlich nicht weiter bemerkenswert. Die ältesten mechanischen Vorrichtungen, von denen die Literatur sich Bilder ausgeliehen hat, sind vermutlich der Webstuhl und die Mühle. Seit den Tagen Tennysons gehen immer mehr Maschinen in der Poesie um. Sie haben ihr die verschiedensten Erfahrungen und Gefühlslagen zugeführt: von der naiven Bewunderung (die bei den Futuristen zum Rausch geworden ist) bis zur hemmungslosen Verzweiflung. Auf eine einzige literarische Traditionslinie läßt sich das nicht bringen: eine ganze Reihe von literarischen Entwicklungen beruht auf dem Ausdrucksreichtum der Maschinen. Mit dem, was ich hier ausführen will, hat weder der romantische Enthusiasmus einiger Poeten aus der Kindheit des industriellen Zeitalters, noch die ekstatische Haltung der Futuristen, noch das „realistische“ Maschinenpathos der frühen Sowjetpoesie etwas zu tun.
Es ist eine ganz andere, schwer bestimmbare Gefühlslage, die mich interessiert, eine Faszination, die ich in manchen Zeichnungen aus „Un autre monde“ von Granville wiederfinde. Dort werden Maschinenteile zu Karikaturen ihrer selbst. Dampfpfeifen und gußeiserne Details nehmen menschliche Gestalt an und führen ein parodistisches Dasein, zugleich biedermeierlich wie im Kindermärchen und fantastisch wie im surrealistischen Gedicht. Die gleiche Faszination zeigt sich in den seltsamen, minutiösen und unfaßbar komplizierten Maschinenbeschreibungen, von denen es in Raymond Roussells Romanen wimmelt, und sie kehrt, mit erschreckender und glasklarer Deutlichkeit, in Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“ wieder, deren Zentrum die Beschreibung einer entsetzlichen Maschine, eines mechanischen Folterwerkzeugs, ist.
Eine ähnliche Erfahrung tritt einem vielleicht aus Marcel Duchamps Glasmalerei „La Mariée, mise à nu par ses célibataires mêmes“ entgegen, auf dem merkwürdig benannte Maschinenelemente in einem offenbar zweckvollen, aber unbegreiflichen Prozeß begriffen zu sein scheinen. Alle diese Kunstwerke würden eine ausführliche Interpretation verdienen. Was sie unterscheidet, ist sicherlich nicht weniger wichtig und interessant, als das, was sie gemeinsam haben. Ich begnüge mich hier mit der Feststellung, daß sie allesamt sich ein und derselben, spezifischen Erfahrung des Maschinellen annähern. Sie reagieren nicht auf die Maschine, sondern auf den Maschinencharakter, der bei ihnen von einer eigentümlichen, geheimnisvollen und Schrecken einflößenden Aura umgeben scheint. Wir kennen alle dieses Gefühl, und wir sind mit einer Symbolik vertraut, die dem berechenbaren Gleichlauf der Maschine die fruchtbare Unberechenbarkeit des organischen Lebens gegenüberzustellen pflegt.
Die Maschine beunruhigt uns auf ähnliche Weise wie die Idee des Gespenstes: etwas Lebloses bewegt sich und lebt, das heißt: es simuliert Leben. Hebt man die mechanischen Bewegungen der Maschine gegen die Regungen des organischen Lebens ab, so läuft das nicht darauf hinaus, daß die Maschine zum Todessymbol wird. Nicht auf den Tod weist sie hin, sondern auf die Möglichkeit, daß unser eigenes Leben, wie das ihre, nur ein simuliertes sein könnte.
Wir alle teilen eine Erfahrung, mag man sie Entfremdung nennen, mag man sie in den Marxschen oder Kierkegaardschen Begriffen zu fassen suchen, die uns nötigt, eine solche Hypothese ins Auge zu fassen: die Möglichkeit nämlich, daß wir bloße Marionetten sind, mechanische Puppen, Homunculi. Und daraus folgt unvermeidlich die Frage: Wenn dies so wäre, würde es einen Unterschied machen?
La Mettrie ist, soviel ich weiß, der erste, der diese Frage explizit gestellt hat. In den letzten hundert Jahren hat sie sich zunehmend verschärft, wie ein Verdacht, der immer stärker wird.
Dies ist die Erfahrung, die bei der Entstehung meines Gedichts den Ausschlag gegeben hat. Sein Paradoxon besteht darin, daß sie sich bei der Arbeit mit einer anderen, ebenso eigentümlichen Erfahrung gekreuzt hat, was schließlich dazu führt, daß ich in einem Zustand, der andere desorientiert, verwirrt und erschreckt hat, auf paradoxe Weise meine Zuflucht suche.
Manchem Leser mag es wie eine weithergeholte Allegorie vorkommen, daß ich die Sprache mit dem Verhalten der Maschinen vergleiche und behaupte, die Grammatik selber sei eine Maschine. Dazu haben mich einige Gedankengänge der neueren Linguistik veranlaßt, insbesondere die Überlegungen, die sich mit dem Begriff der grammatischen Struktur verbinden. Genauer gesagt, schwebte mir Naham Chomskys Versuch vor, den grammatischen Satz mit Hilfe einer Anzahl von elementaren Operationen zu definieren.
Im Verhältnis zu den Gedanken, zu deren Vermittlung sie dient, behauptet ja die Grammatik eine schier unergründliche Objektivität: ihre Formen geben sich einerseits zu allem her, was denkbar ist, und sie bewahren andrerseits eine gleichsam unmenschliche Selbständigkeit.
Es war Chomsky, der in seiner Untersuchung „Syntactic Structures“ die Grammatik als eine Maschine bezeichnet hat: als jene Maschine nämlich, die aus der Mannigfaltigkeit aller theoretisch möglichen Wortkombinationen und Sequenzen, aus dem „Gebrabbel“, von dem das Gedicht spricht, eben jene auswählt, welche die organisierte und verständliche Sprache ausmachen.
Wem dieser Gedanke vertraut geworden ist, der kann sich schwer von der Vorstellung freimachen, daß unseren Worten und unserm Sprechen etwas Mechanisches und gleichsam Unpersönliches anhaftet, als wären nicht wir es, die unsere Gedanken hervorbrächten, sondern als dächte die Sprache in uns, und als liehen wir bloß einer größeren, unübersehbaren sprachlichen Struktur unsere Stimme, die uns durchwüchse, so wie in einem parasitären Pilz das Myocel die Wirtszellen durchdringt. Oder, um den Vergleich zu wechseln: als wäre die Sprache ein enormer, unsichtbarer mechanischer Prozeß.
Es gibt wohl keinen Menschen, der nie erfahren hätte, mit welch paradoxaler Selbständigkeit die Wörter in uns leben und denken, und der es nicht am eigenen Leib erlebt hätte, wie diese Objektivität der Sprache uns mit fremden, entfernten oder halbvergessenen Gedanken, mit verschwundenen historischen Erscheinungen und mit Haltungen behaftet, die uns völlig fremd sind. Man könnte auch sagen: in solchen Erfahrungen schlägt die Logik durch, deren rätselhafte Kraft eben darin liegt, daß aus jedem Satz, den wir äußern, eine unendliche und unüberblickbare Menge von weiteren Sätzen folgt, gleichgültig, ob wir diese Konsequenzen verstehen oder nicht, ob wir sie wahrhaben wollen oder ob wir sie leugnen. Das Erlebnis, das ich meine, läßt sich auch in mathematischen Begriffen erläutern. Es hat etwas von der Halsstarrigkeit der natürlichen Zahlen. Einmal definiert, lassen sie nur noch jene Verwandlungen und Kombinationen zu, die in ihrer Natur liegen, und sperren sich gegen jede andere Art, sie zu brauchen.
In ihrer Natur? Der Natur der Zahlen? Ganz recht. Jedenfalls eher in ihrer als in unsrer Natur.
Wir sehen uns also einer fremden, unpersönlichen, unübersehbaren Mannigfaltigkeit ausgesetzt, an der wir auf eine ganz intime Weise teilhaben. Und man kann ebensogut sagen, daß diese Mannigfaltigkeit in uns denkt, wie daß wir uns beim Denken ihrer bedienen.
Die moderne Kybernetik hat eindeutig gezeigt, daß eine ganze Reihe von Eigenschaften, die wir für Eigentümlichkeiten des menschlichen Denkens hielten, von Maschinen simuliert werden können: das Gedächtnis, die Fähigkeit, logische Schlüsse zu ziehen, und das Vermögen, auf Grund gegebener Voraussetzungen eine rational begründete Wahl zu treffen. In den Diskussionen über die modernen Rechenmaschinen und ihre Analogien zum Menschen kann man zuweilen das Argument hören, die Maschine sei „außerstande, zu phantasieren“. Soweit ich sehe, steht aber der Konstruktion einer Maschine nichts im Weg, bei der jede einzelne Operation ähnliche, aber nicht identische Operationen auslösen würde und zwar derart, daß der Ablauf nicht durch logische, sondern durch andere, beispielsweise assoziative Gesetze bestimmt wäre.
Möglicherweise wird mir der eine oder andere Zuhörer oder Leser nun die Absicht zuschreiben, eine deterministische oder mechanistische Philosophie zu entwickeln. Das liegt mir fern. Es hätte mit dem, worauf ich hinauswill, auch nichts zu tun. Wer in ein kybernetisches Gerät blickt, der sieht keine Gedankengänge, er sieht nur Maschinenteile. Es wäre reinster Animismus, wollten wir dem Gerät Leben zuschreiben. Wer einen Menschen öffnet und hineinblickt, sieht allerdings auch keine Gedanken; nur indem er sich selbst beobachtet, erlebt der Mensch sich als ein Bewußtsein. Wie, wenn auch dies eine animistische Vorstellung wäre?
Der symbolische Wert der Maschinen liegt darin, daß sie uns an die Möglichkeit erinnern, daß unser eigenes Leben in einem ähnlichen Sinn etwas Simuliertes sein könnte wie das ihrige.
Mein Gedicht handelt von dieser Möglichkeit. Der Mensch wird darin aufgefaßt als eine kybernetische Vorrichtung, die mit unserer eigenen Sprache und unserer eigenen Logik programmiert ist. Es handelt sich um einen Versuch, die Perspektive zu ver-ändern und das, was uns am besten bekannt ist, unter einem neuen Gesichtswinkel zu betrachten:
Der Kupferstich wimmelt von Leuten. Menschen,
klein wie Fliegen, fahren auf und ab in den Körben
und „La Grande Machine“, Abbildung Ziffer j,
neben dem sprudelnden Wasserfall, treibt alle Riemen an.
Die Geschichte der Philosophie ist voll von Argumenten, die zeigen sollen, daß das Ich keinen Zugang – jedenfalls keinen direkten Zugang – zum Innenleben anderer Menschen hat, und daß mithin alle andern Menschen außerhalb dieses Ich durchaus bloß Marionetten sein könnten. Sehr viel seltener wird dahingehend argumentiert, daß auch dieses Ich selbst eine Marionette sein könnte, ohne es zu wissen.
Wenn das Innenleben der Andern tatsächlich im Sinn jener Philosophen unzugänglich wäre, so hätte dies eine wichtige sprachliche Konsequenz. Es würde bedeuten, daß jedes Wort, das ich gebrauche, beispielsweise das Wort Apfel oder das Wort rot, zwei verschiedene Bedeutungen hätte: eine öffentliche, die jedermann zugänglich, und eine private, die nicht mitteilbar wäre.
Auf eine solche Betrachtungsweise gründen ich weiß nicht wieviele ästhetische und poetische Doktrinen von der „Unvollkommenheit der Sprache“ und von der „linguistischen Mauer“, die den Menschen angeblich von seinen Mitmenschen trennt. Sehr wohl möglich, daß diese Auffassung von einer „antipoetischen Mauer“ zu den wichtigsten Quellen des poetischen Purismus gehört, der seinerseits zu den Voraussetzungen der modernen Lyrik überhaupt zählt. Heute kommt mir diese Vorstellung, nach der das einzelne Wort oder die sprachliche Sequenz einen Erlebnisrest enthält oder vielmehr verbirgt, der sich niemals mitteilen läßt, mehr und mehr wie eine Selbsttäuschung vor. Sie ist selber ein Rest, das Überbleibsel alter und unhaltbarer metaphysischer Denkweisen, eine Illusion, die nach wie vor ihrer Überwindung harrt.
Ich bin hingegen der Auffassung, daß mit dem, was gesagt wird, alles gesagt ist, und ich betrachte die Sprache als etwas vollkommen Durchsichtiges: sie schöpft unsere Gedanken ohne Rest aus. Oder, um es mit einem Gedanken aus Wittgensteins „Philosophischen Untersuchungen“ zu sagen: ein sprachlicher Ausdruck, der für andere prinzipiell unverständlich wäre, müßte auch für mich selber, den Sprecher, prinzipiell unverständlich bleiben.
Linguistische Mauern gibt es nicht. Jedes Erlebnis ist (klar oder unklar formuliert) hier und jetzt unverkürzt und erschöpfend zugegen in der Formulierung, die ich ihm gebe. Unsere Worte bergen keine unzugänglichen Reste und keine privaten Bedeutungen. Die Sprache schöpft uns aus. Sie ist das Unpersönliche in uns, und unsere Gedanken existieren nur in diesem unpersönlichen und gleichsam objektiven Medium. Es denkt in uns.
Eine solche Betrachtungsweise muß zu einer Poetik führen, die sich von der des hergebrachten, klassischen Modernismus unterscheidet.
Das Gedicht „Die Maschinen“ kann als ein anspruchsloses Bruchstück zu einer solchen Poetik gelten. Es geht davon aus, daß es eine Gemeinschaft gibt, die ein für allemal gegeben ist, und daß diese Gemeinschaft in ihrem innersten Wesen etwas Unpersönliches ist. Und hierin sucht das Gedicht einen Trost.
Es handelt sich, wenn man es so ausdrücken will, um eine Gemeinschaft zwischen Marionetten, die zu leben vorgeben, die ihr Leben bloß simulieren. Aber eben dies ist die Grundbedingung ihrer Gemeinsamkeit, und es wird Zeit, daß wir uns den metaphysischen Schlaf aus den Augen reiben und diese Bedingung ins Auge fassen. Unsere Gemeinsamkeit ist von eigentümlicher Art, sie reicht tief in die Mechanik hinein; aber sie ist immerhin eine Gemeinsamkeit, ja eine Vertrautheit, die wir miteinander teilen.
Wer so denkt, für den liegt die Tragik des Menschen nicht darin, daß er eingeschlossen wäre, daß ihn etwas vom Leben ausschlösse. Und auch nicht darin, daß seine Worte nie ans Ziel kämen.
Die Tragik des Menschen, wie die der Maschinen, liegt darin, daß er kein Geheimnis hat.
Lars Gustafsson
GEDICHT UND REFLEKTIERENDER ESSAY
sind benachbart; Autoren moderner Gedichte sind nicht selten kritisch argumentierende Essayisten.
Im Augenblick, wo jemand in vollem Umfang zu reden anfängt, ist es sein Problem, dem Werk die eigene Ernsthaftigkeit zu verleihen, eine Ernsthaftigkeit, die hinreicht, das Ding, das er schafft, zu bewegen, seinen Platz neben den Dingen der Natur einnehmen zu wollen. (Charles Olson)
Im Vers und im Essay kann der Versuch „im vollen Umfang zu reden“ unternommen werden, es sind zwei verschiedene Möglichkeiten, dieses Ziel anzusteuern, – und sei es auch nur, daß der Ort der Gedichte etwas genauer beschrieben wird durch den Essay: „Meine eigenen Gedichte betrachte ich mit großem Mißtrauen. Ich habe sie aus dem Rest der übriggebliebenen, geretteten Worte gefügt, aus uninteressanten Worten, aus Worten vom großen Müllhaufen“ (Różewicz), – Bei anderen ist der Essay dem Gedicht völlig gleichberechtigt. Schritt für Schritt zeigt er den Gang des Autors, so wie, in anderer Fortbewegungsart, das Gedicht Schritt für Schritt/ den Leser mit sich zieht. Der Autor nähert sich dem ihm gemäßen Konzept lediglich von zwei verschiedenen Schreibmöglichkeiten her. Mit einem solchen Autor beginnt dieses Buch, mit Lars Gustafsson.
Dieses Buch: es kam dadurch zustande, daß das Literarische Colloquium Berlin für den Winter 1966/67 Autoren von Gedichten aus verschiedenen Ländern einlud. Sie nahmen eines ihrer Gedichte zum Beispielfall, zeigten an ihm, in einem Essay, ihren Standpunkt, und lasen weitere neue Gedichte vor. Man sah, man hörte, daß in Ost und West sondiert wird, wie weit Formulierbares trägt; daß in verschiedensten Sprachen Engagement und Zukunftsvorstellung der Poeten vergleichbar sind. Durch die Mitarbeit von Autoren und Übersetzern – die Übersetzer hatten schwierigste Arbeit – und von Verlegern, die ihre Erlaubnis zum Druck gaben, entstand aus diesen Vorlesungen das vorliegende Buch. Die Reihenfolge der Kapitel entspricht der Reihenfolge der Berliner Lyrik-Veranstaltungen.
Lars Gustafsson, der mit „Maschinen“-Gedicht und mit „Maschinen“-Essay die Reihe eröffnete, bekam im Rückblick von einigen Kritikern attestiert, daß er neben Heißenbüttel die kühlste und genaueste Sondierung vornahm. Er wurde von seinem Übersetzer Hans Magnus Enzensberger vorgestellt:
Auf den Handzetteln, die eine freundliche Direktion hier im Saal verteilt hat, steht, daß Lars Gustafsson ein wichtiger Mann sei. Ich kann diese Auskunft nur bestätigen, Lars Gustafsson dirigiert von winzigen Tischen aus, einem Tisch in Uppsala, einem Tisch in Stockholm, einem Tisch in Dunshamar, einem Tisch in Västerås – von vier winzigen Tischen aus dirigiert er eine große Zeitschrift, einen halben Verlag, und vor allem seine eigene Produktion, die, wer Lust dazu hat, einteilen kann in Abhandlungen, Gedichte, Romane, Essays, Erzählungen, Leitartikel und Rezensionen.
Auch muß er von seinen vier kleinen Tischen aus eine große Menge von Fragen beantworten, die aus ganz Schweden an ihn gerichtet werden. Ganz gleich, ob ein politischer Strafprozeß zur Debatte steht, oder eine alte Moral oder eine neue Ästhetik oder ein Spezialproblem der transfiniten Mathematik – in Schweden fragt man immer, was Lars Gustafsson darüber denkt. Er aber antwortet zögernd, ungern und genau. Doch daß er ein wichtiger Mann ist, das ist an Lars Gustafsson das Unwichtigste.
Zu seinen Lieblingsvokabeln gehört das Wort eigentümlich. Das wundert mich nicht. Dieser Schüler der Akademien aus Oxford und Uppsala, dieser gelehrte Aufklärer, der den mystischen Schwärmer Swedenborg schätzt und den dunklen Romantiker Almkvist liebt, dieser glasklare Nachfolger des undurchsichtigen Strindberg, er stammt aus einer ,eigentümlichen‘ Gegend. Aus der tiefsten Provinz. Dem tiefsten Schweden. Dorther, wo das Land so aussieht, wie es ausgesehen haben mag vor 500 bis 800 Jahren. Nur eine Einhundertkilovolt-Leitung zieht sich durch den Wald und über den See. Gustafsson, ein Mann von kosmopolitischer Bildung, ist zugleich ein Hinterwäldler. In diesem Wald gedeiht die Philosophie, aber nicht auf Holzwegen. Es ist eine Philosophie, die man in Deutschland kaum angefangen hat zur Kenntnis zu nehmen, obgleich sie auch deutsche Ahnen hat, von Leibniz bis zu Frege, eine sehr kühle, sehr rationale, mit einem Wort: die analytische Philosophie. Gustafsson hat – und von wievielen Poeten kann man das schon sagen? – die formale Logik, die Philosophie der Alltagssprache, die strengen Labyrinthe der angelsächsischen Erkenntnistheorie, durchaus studiert. Und wie diese Kenntnis dem Gedicht zu Hilfe kommt, das werden Sie gleich hören. Sie räumt mit alten Geheimnissen auf, sie führt zu einer Deutlichkeit, die ,eigentümlich‘ ist, so eigentümlich, daß im kühlen klaren Spiegel des Gedichts eine seltene Beute erscheint etwas Logisches, das nicht dürr, und etwas Phantastisches das nicht trübe ist. Die logische Phantasie, die phantastische Logik des eigentümlichen Herrn Gustafsson aus Uppsala.
Walter Höllerer
Der Autor, die Sprache des Alltags
und die Sprache des Kalküls
Hier kamen zu Wort: Autoren mit wissenschaftlich-reflektierenden Methoden, Ekstatiker, Gesellschaftsanalytiker, Anhänger des Mythischen, Techniker der Sätze, Verabsolutierer der Lautmusik, Geschichtskritiker, Autoren der weitreichenden Visionen, der genauen einzelnen Beobachtung, politisch argumentierende Autoren. Was zustande kam, ist es ein Zufallsbild? Solche Eigenarten, insgesamt, ergeben das Spektrum des gegenwärtigen Gedichts.
Die Autoren waren nicht zu katalogisieren nach ihrer nationalen oder ideologischen Herkunft. Woher die Autoren der progressiven Literatur auch kamen: überall hatten sie sich, in ihren Herkunftsbereichen, zunächst gegen Dogmen durchzusetzen. Das ist es, was sie auf Anhieb verband, – und sollten sie wirklich eine weltweite Verbindung finden, wie sie das anstreben, sollten sie sich, und das erscheint schwierig genug, weithin verständlich machen können, dann allerdings wird es kaum eine Zukunft für Dogmen geben.
Haben Sie beobachtet, wie sich Autoren zu ihren Arbeiten äußern? Das hat manches Mühsame, Vorgeschobene, Versteckende. Wortreichtum wird als Barriere verwendet. Dann die Dürre der Sätze, das Abbrechen der Perioden. Die Verbohrtheiten. Die Anläufe. Der rechthaberischste Aussagesatz hat in dem Zusammenhang, in dem er steht, noch den Schatten eines Fragezeichens, – oder er übertreibt die Festlegung so, daß sie einen Anflug von Ironie bekommt.
Dennoch, und gerade deswegen erscheinen mir diese Aussagen von Gewicht. Einer beschreibt etwas, und Sie finden, beobachtend, das Beschriebene im Beschreibenden: schon seine Kleidung, dann seine Gesten gehören zu seinem Zeichensystem, sind ein Teil seines semiologischen Bestands, wie die Formulierungen selber. Seine Begriffe sind nicht zu trennen von dem Gestus, mit dem sie formuliert werden. Und so erscheint, wenn Sie richtig zuhören, etwas überraschenderes und Zutreffenderes vor Ihnen als wieder einmal Vergangenheitssortierung und Zukunftsprognosen.
Sie beobachten die Grenzen der Genauigkeit. Sie sehen einen Beispielfall. Ich greife lieber auf diese Beispiele zurück, auf diese feinmechanischen Demonstrationen von Autoren, die der Selbsttäuschung offen sind, die gleichwohl verbarrikadierte Erkenntnis freilegen, – lieber auf sie, wenn von der Literatur der Gegenwart die Rede ist, als auf Ergebnisse und Vorschriften derer, die die Literatur in Übersichten und Pläne, in ihre Gesamttableaus eingeordnet haben. – Vergleicht man solche Autorpoetiken mit dem, was der Autor schreibend bewältigt, oder nicht bewältigt: so nähert man sich den primären Fragen der gegenwärtigen Literatur. Sie werden im Bewußtsein und im Schreibvorgang der Autoren entschieden.
Bei allen Verschiedenheiten der literarischen Traditionen, der gesellschaftlichen Hintergründe und der individuellen Sensibilität stand ein bezeichnendes Merkmal im Mittelpunkt: Der Autor stößt auf das Faktum, daß die Alltagssprache neben den künstlichen Sprachen des Kalküls gleichberechtigt weiterbesteht, – und daß beide reale Wirkungen und Bedeutungen schaffen.
In der Sprache des Alltags, also in der Umgangssprache und in der informierenden und werbenden Massenmediensprache wird der Ablauf des täglichen Lebens formuliert. Aber nicht weniger ist dieses tägliche Leben von den künstlichen Sprachen, den Formelsprachen des Kalküls beeinflußt und geformt.
Beide Arten von Sprachen sind in ihrem Nebeneinander nur dadurch möglich, daß es für sie gemeinsame Ausgangspunkte gibt; daß es eine Basisstruktur der Sprache gibt, in der die Sprache des Alltags und die Sprache des Kalküls inkorporiert sind. Der Autor versucht, in welcher Muttersprache er auch schreibt, dafür Ausdrücke zu finden. Oft gebraucht er dazu die scheinbar simpelsten Alltagswendungen, die aber im einzelnen Satz, im Nacheinander der Sätze seine kennzeichnende Betroffenheit zeigen. Diese Inkorporation ist mit angestrengten Mitteln schwerer zu fassen als mit weniger starren, weniger verbissenen; wohl deswegen, weil der Zustand der Basisstruktur kein Miteinander und Nebeneinander ist, sondern ein paradoxer Zustand von sich Berührendem und sich Widersprechendem. –
Die Mittel, mit denen der Autor vorgeht, sind jeweils seine Kompositions- und Stilmittel. Er gibt nicht einen Abdruck der wahrnehmbaren Welt, die ihn umgibt, eine in sich beruhigte Milieuschilderung, er kann sich auch nicht mit einer Nachahmung mathematischer Formeln mit Worten oder Buchstaben begnügen, – er sucht, will er nicht ins Zufällige abgleiten, die Welt in ihren gegenseitigen Abhängigkeiten von Alltagssprache und Kalkül darzustellen. Was er anfaßt, es lenkt seine Aufmerksamkeit, seine Sensibilität in diese Richtung. Er ist an dieser kontradiktorischen Welt beteiligt, reibt sich an ihr, verlängert ihre Perspektiven, mit scheinbarer Unbeteiligtheit, mit Eifer, mit Wut, mit Hoffnung, mit Veränderungswünschen in die Zukunft.
Wenn ich behaupte, daß zur Zeit allein der Autor die Möglichkeit hat, im Schreiben, mit seiner offenen Poetik, den Zusammenhang und den Widerspruch der verschiedenen gegenwärtigen Zeichensysteme sichtbar zu machen, – so hat das seinen Grund in der Beobachtung, daß der Autor nicht, zumindest nie ausschließlich, als Spezialist schreibt. Er wäre falsch beraten, streng wissenschaftliche, spezialisierte Methoden nachzuahmen, das gerade beraubte ihn seiner Möglichkeit. Er findet seine eigenen Methoden, mit Hilfe der Grammatik und notfalls gegen sie. Die Autoren haben dazu, von Jarry bis zu Beckett von Kafka bis Brecht die verschiedensten Wege begangen, und sie begehen auch heute verschiedenste Wege. Sie suchen für einen Fundus von widersprüchlichen Zeichensystemen möglichst zutreffende Zeichen. Hier liegen die Leistungen der modernen Literatur, – nicht in der Wiederholung historischer Konzeptionen, wohl aber in der Auseinandersetzung mit ihnen.
Hier, im Sondieren der Basisstruktur der Sprache, zeigt sich ein wichtiger Ansatzpunkt der Autorpoetiken, – wahrscheinlich einer der wichtigsten für realistisches Schreiben. Denn als realistische Literatur ist doch wohl die Literatur zu bezeichnen die ein Bewußtsein von dem bildet, was eigentlich geschieht, und was geschehen kann. Jedes Detail des hier und jetzt Sichtbaren, Schmeckbaren, des taste and see, erscheint von den Modellen mitgezeichnet, die das Kalkül errichtet hat, die nicht geschmeckt und gesehen werden können. Ein Zwiespalt wird spürbar, der im Schreiben ausgetragen wird. Gerade dieser Zwiespalt ist es, der verschiedene moderne Autoren nachdrücklich auf die Sinne zurücklenkt, ohne daß das unumwundene Vertrauen auf sie zurückkehrt.
Umgekehrt, wenn der Autor von den abstrakt-formelhaften Strukturen des Kalküls ausgeht, so wird er gezwungen, sich ebenfalls mit dem Verhältnis von Alltagsformulierung und Sprache des Kalküls auseinanderzusetzen. Solche Erfahrungen sind z.B. in Gedichten von Gustafsson und Heißenbüttel in Prosastücken von Kurt Schwitters erkannt und ironisch ausgespielt worden. Sie lassen diese Autoren nicht modisch-dogmatisch werden.
Das alles läßt erkennen, daß mit „Basisstruktur der Sprache“ nicht eine gleichbleibende Ursprache gemeint ist, ein mystischer Urgrund der Sprache, der unveränderlich wäre und zu dem allein der Dichter, als Seher, direkten Zugang hätte, – nicht die „Sprache der Engel“ Hamanns. Die Ausgangsmöglichkeiten für die sprachlichen Zeichen verschiedenster Art verändern sich, erweitern sich, verengen sich, – und der Autor stößt, bei seiner Suche nach zutreffendem Ausdruck, jeweils auf die „höchst vertrackte Mischung aus eigenem Handelnwollen und dem Rückgriff auf den vorgebildeten Apparat“ (Rühmkorf). Da die Sprache, die komplizierteste Form des sozialen Verhaltens, eng zusammenhängt mit Moden, Sitten, Riten, bleibt, was hier ausgetragen wird, nicht eine linguistische Auseinandersetzung. – Daß diese Auseinandersetzungen zu Verstößen gegen vordem systematisch Geordnetes führen, ist ein Kennzeichen von Gedichten und Essays dieses Buches. Das beschränkt sich nicht auf die hier vorliegenden Texte. Die Romane Becketts, die deutlich die Probleme Alltagssprache-Sprache des Kalküls zeigen, wurden auf dem Wiener Kritiker-Kongreß, kurz nach den Berliner Lyriker-Veranstaltungen, als asozial bezeichnet, und zwar mit den Worten:
ich spüre hier einen Trieb zum Asozialen, das beunruhigt mich, das kann ich nicht annehmen, ich kann nicht froh darüber sein.
Selten findet man diese Gegenposition sympathischer vorgetragen. Der Opponent ist von Literatur beunruhigt. Er liefert damit den Beweis, daß „asoziale Literatur“ soziale Wirkung haben kann. Wer will diese Wirkung als verwerflich bezeichnen. Fest bezogene Positionen in Frage zu stellen, ist kein inhumaner, sondern ein humaner Akt. Die allzu große Sicherheit des Lesers, und insbesondere eines Lesers, von dem Macht ausgeübt werden kann, ist keine geringere Gefahr als Selbstzweifel.
Die Autoren haben allenthalben Gegenzüge unternommen gegen das „Herumrühren in dem alten Topf“, gegen die Sprache, die in der Hauptsache nur bestätigt. Sie sind nicht durch Vorschriften aufgehalten worden, durch retardierende Programme, weder durch eng gefaßte Realismus-Thesen noch durch Klassizismus-Thesen, und auch nicht dadurch, daß man ihnen einen Begriff überstülpte, gegen den man verärgert ist: den Begriff Avantgardist. Ich kenne keine Autoren, die Wert darauflegen sich mit diesem militärischen Ausdruck zu benennen. – An die Stelle der unzutreffenden Alternative von Begriffen wie Avantgarde und Tradition werden gerne Ersatzbegriffspaare gesetzt, die ebenso ungenügend sind, Literatur zu charakterisieren: Harmonie, die mit Klassik, Chaos, das mit Avantgarde verbunden sein soll; oder soziale Literatur (also Literatur der Ordnung) und asoziale Literatur (also Literatur der Unordnung).
Was die Autoren beisteuerten, lief nicht auf solche Gegenüberstellungen hinaus. Sie zeigten auf eine in den Konturen sichtbare Welt, deren sprachliche, poetische, gesellschaftliche, politische Form mehr und mehr gefunden werden will; hier allerdings gilt am ehesten Gunar Ekelöfs Satz:
Oft sind unsere Gewohnheiten unsere schlimmsten Feinde.
Die neueren Gewohnheiten, wenn sie zu Dogmen werden, zeigen sich da nicht weniger hinderlich als die alten.
Die moderne Literatur entstand und entsteht in der Zone des Widersprüchlichen und Unvereinbarlichen, und damit in Ungelegenheiten. Nach Wosnessenskij: „Sie entsteht dort, wo die Zone des Schmerzes ist, sie ist dort, wo es den Menschen schmerzt, wo es das Volk schmerzt.“ – Schon in den Anfängen der modernen Literatur sind diese Einschnitte vorhanden. „Die Wunde Heine“ hat Th.W. Adorno einen Essay überschrieben. Und was Francis Ponge am gegenwärtigen Autor beobachtet, die „Schamlosigkeit“ im Gebrauch der Sprache, durch die er die Schranken der Begriffe und Formeln durchbricht, die Aufkündigung des Gehorsams gegen die alten Bilder, gegen die euklidische Geometrie, – das liegt ebenfalls in der Zone der Trennungen. Solche Überlegungen provozieren Gegenforderungen, die zur Selbstprüfung anhalten. Der Forderung nach Schamlosigkeit und Rücksichtslosigkeit im Formulieren steht die andere gegenüber, nach Möglichkeit auszukommen mit den vorgegebenen Mitteln, sie nicht leichtfertig zu verlassen, an ihnen zu arbeiten.
Dies alles wird ausgetragen inmitten von Bewußtseinsindustrie, in der zu fragen ist, ob sie nicht das Ende aller möglichen Innovation, die Eliminierung jeden Geheimnisses und damit für den Autor die Folgerung mit sich bringe, das Schreiben aufzugeben und dafür ein Plädoyer über die Unmöglichkeit des Schreibens zu halten. Der Vorschlag liegt nahe. Aber abgesehen davon, daß schon dieses Plädoyer den Ansatz zur Selbstwiderlegung enthielte, – der Autor lebt nicht in reinen Endzuständen. Er sieht sich in unreinen, gemischten Verhältnissen. Er reibt sich an ihnen. Er befindet sich inmitten von Literarischem, das nicht vom festen Kunstwerkbegriff einer geschlossenen Ästhetik her beurteilt werden kann, sondern das vom Kindervers bis zur Werbung reicht. Er ist daran beteiligt. Er kann sich kein Alibi durch reine Idealkonstruktionen oder durch pure Beschränktheit verschaffen.
Er sucht Worte, schreibt Sätze. „Wann sollen wir aufhören? Wann ist eine Unterscheidung genau genug?“ – Es liegt ihm nichts an dem Gebrauch des Worts Avantgarde. Es liegt ihm daran, an Gegenwärtiges ohne gestrige Vorbehalte heranzukommen.
Walter Höllerer, Nachwort
Über dieses Buch
Für den Winter 1966/67 lud das Literarische Colloquium Berlin 21 Autoren aus 11 Staaten ein. Sie nahmen eines ihrer Gedichte zum Beispielfall, zeigten an ihm, in einem Essay, ihren Standpunkt und lasen weitere neue Gedichte vor. Man sah, man hörte, daß in Ost und West sondiert wird, wie weit Formulierbares trägt; daß in verschiedensten Sprachen Engagement und Zukunftsvorstellung der Poeten vergleichbar sind. Durch die Mitarbeit von Autoren, Übersetzern und Verlegern, die ihre Erlaubnis zum Druck gaben, entstand aus diesen Vorlesungen das vorliegende Buch. Die Reihenfolge der Kapitel entspricht der Reihenfolge der Berliner Lyrik-Veranstaltung.
In der dtv-Taschenbuchausgabe wird jeder Lyriker mit einem biographisch-bibliographischen Abriß, einer kurzen Einleitung des Herausgebers und einem Foto vorgestellt. Außerdem wird der Essay des Autors und das Gedicht, das er als Beispiel wählte, veröffentlicht. Ferner enthält der Band einen Aufsatz von Walter Höllerer „Der Autor, die Sprache des Alltags und die Sprache des Kalküls“ sowie Übersetzerbiographien.
Deutscher Taschenbuch Verlag, Klappentext, 1969
Zum 65. Geburtstag des Herausgebers:
Peter Rühmkorf: Dem ,Langen Gedicht‘ ein langes Leben!
Zum 100. Geburtstag des Herausgebers:
Alexander Cammann: Aus Feuerschlünden
Die Zeit, 29.12.2021
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Archiv 1, 2 & 3 +
Internet Archive + KLG + IMDb + Kalliope +
Johann-Heinrich-Merck-Preis + Horst-Bienek-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Brigitte Friedrich Autorenfotos
Nachrufe auf Walter Höllerer : TAZ ✝ Die Zeit ✝ LCB
Günter Grass: Walter Höllerer nachgerufen
Sprache im technischen Zeitalter, Heft 166, Juli 2003
Norbert Miller: Der Vogel Rock
Sprache im technischen Zeitalter, Heft 166, Juli 2003
Peter Rühmkorf: Der Forderer
Sprache im technischen Zeitalter, Heft 166, Juli 2003
Bernhard Setzwein: Mitten am Rand
Sprache im technischen Zeitalter, Heft 166, Juli 2003
Technik und Poetik – Symposium in Erinnerung an Walter Höllerer.


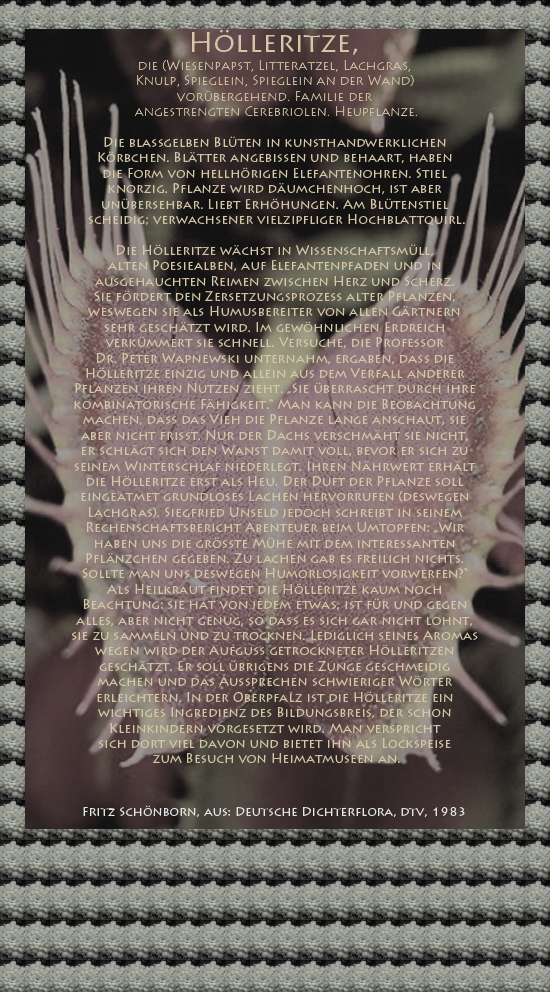
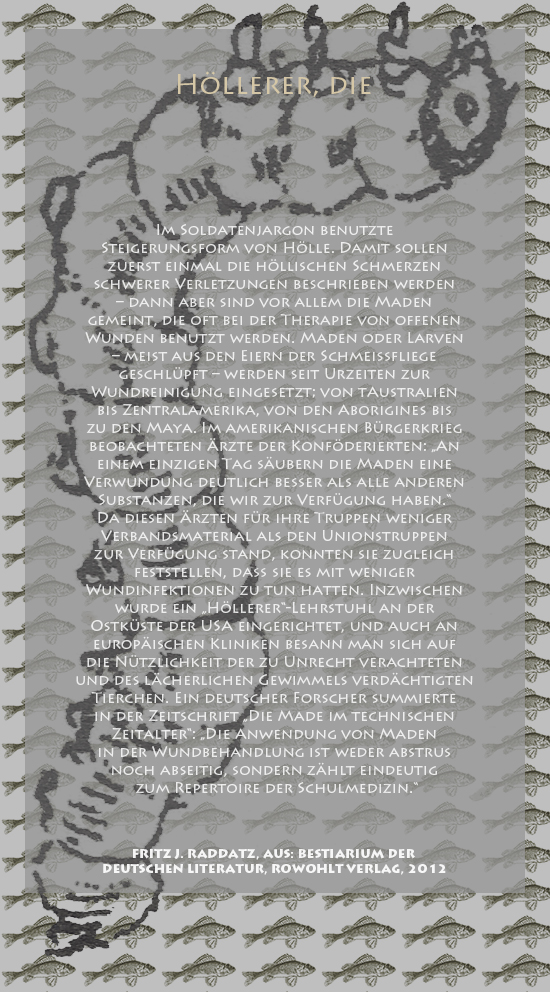












Schreibe einen Kommentar