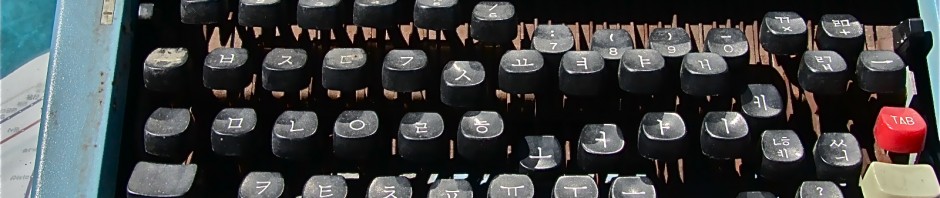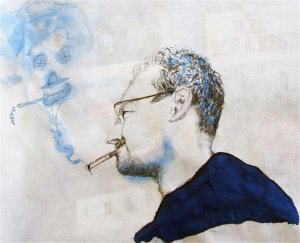»Bad Boy Bubby«
Titel: Bad Boy Bubby
Regie: Rolf de Heer
Länge: 109 (Min)
Produktionsort/- jahr: Australien 1993
FSK: 16
EAN: 4042564050967
Erschienen bei: Bildstörung
Veröffentlichungsdatum: 10.10.2008
Bildformat: 16:9
Ton/Sprache: Dolby Digital 2.0, Deutsch, DD 5.1, Englisch Extras:
Audiokommentar, Interviews, Kurzfilm „Confessor Caressor“, Photo-Galerie (110 Min. Bonusmaterial)
Hauptdarsteller:
Nicholas Hope, Claire Benito, Ralph Cotterill, Carmel Johnson, Syd Brisbane
Eine Aneignung
1. Über Aneignung
Die Wiederholung ist ein Akt der Aneignung. Ich eigne mir das Andere an. Das Andere ist das Fremde bis es ich mir angeeignet habe. In der Wiederholung verstaue ich es im Ich-Vorrat. Nun ist es nicht mehr das Fremde, sondern das Eigene. Dort muss es irgendwann gewesen sein. Es muss deshalb dort gewesen sein, weil ich es wieder hole. Die Wiederholung ist also Besitzanzeige und Diebstahl zugleich. Die Wiederholung ist also Paradoxie in ihrer reinsten Form. Ein Verbrechen aus kühler Leidenschaft sozusagen. Aus diesen kühlen Leidenschaften entstehen Kunstwerke. Sie sind geordnetes Imitat der Wirklichkeit, phantastisches Arrangement der Realität, spiegelverkehrte Ansichten des Gegebenen, Aneignungen des Fremden, der immer auch ein Teil von uns ist.
2. Über Bubby
Bubby (hervorragend und überragend durch Nicholas Hope verkörpert) ist ein leeres Gefäß, einer, der nur durch das Füllmaterial der Anderen zu leben beginnt. Er eignet sich an und er wird angeeignet. Er ist eine Puppe, die sich mit den Worten der Anderen spielt.
Die Anderen sind erst einmal nur die Andere. Die Andere ist seine Mutter, der Trog aus dem er also einst schlüpfte, dem Schoß dem er entkam. Diesem Schoß aber ist nicht zu entkommen. Mama hält ihren guten bösen Bubby gefangen in einem Trog, einem Gefäß. In diesem Fall ist der Mutterbauch ein gefängnisartiger Kellerraum, der grau in grau, die böse Welt außen vor lässt. Die Außenwelt bleibt die Außenwelt. Bubby darf sie nicht holen. Er kennt sie nicht einmal. Mama gibt ihm da die richtigen Tipps: Du würdest ersticken, du würdest keine Sekunde dort draußen überleben. Deshalb rennt Mama ja auch immer mit einer Gasmaske raus. Und die Gasmaske ist nur für sie.
Bubby indes muss zurück bleiben, er solle sich ja nicht vom Tisch weg wagen, ja nicht aufstehen, sonst würde er den Zorn Gottes auf sich ziehen. Wie zur Warnung hängt neben Bubby ein selbst gefertigtes Kreuz mit einer angenagelten Puppe ohne Kopf. Der ist hier unten auch nicht gefragt. Dann schon eher der Rest des Körpers. Es kommt wie es kommen muss. Bubby bleibt sitzen, aber irgendwann muss Bubby halt auch pinkeln. Da läuft die ganze gute böse Bubbybrühe dann den Stuhl entlang. Armer Bubby! Die Schelte nach Mamas Rückkehr lässt nicht lange auf sich warten, aber weil Mama Mama ist, putzt und wäscht sie den kleinen großen Bubby, der seit fünfunddreißig Jahren hier hausen muss, auch an den intimsten Stellen, den die sind keine intimen Stellen für Bubby. Die gehören eh alle Mama. Gleich danach geht es ab ins Bett. Mama hat sich beim Waschen scharf gemacht, und nun lässt sie den kleinen großen bösen guten Bubby ihre Brüste kneten, reitet auf ihm, der nicht wissen kann, was richtig oder falsch ist. Was ist richtig? Was ist falsch? Und wie entstehen solche Urteile? In einem leeren Raum gibt es keine moralischen Urteile.
Bubby aber hat sich eine Gegenwelt, eine Parallelwelt gebaut. In einer Art Miniaturgefängnis hält er eine Katze. Die muss dann hin wieder seine Rolle einnehmen, während Bubby zu Mama mutiert. Mamas Sätze rollen aus seinem Mund. Die Katze wird abgestraft. Bubby eilt um Tisch und Stuhl, die Imitate von Brüsten unter ein Kleid geklemmt. So probiert Bubby seine Welt aus. Die Hackordnung bleibt gewahrt.
Wir wissen nicht, wo sich der Kellerraum befindet. Vielleicht in der Nähe einer Fabrik. Maschinegeräusche tönen als Begleitmusik. Der Sound des Lebens ist das monotone Schleifgeräusch einer Maschine. Bubby muss in einem ungeschriebenen Beckett-Stück gelandet sein.
Der Tod ist das Fremde. Wie kann ich mir das Fremde zu Eigen machen. Indem ich es wiederhole?
Mama hält Bubby Nase und Mund zu, zeigt ihm die Außenwelt auf, den Erstickungstod. Das fasziniert Bubby natürlich ungemein und so experimentiert er so lange mit der Katze, bis sie sich den Tod völlig angeeignet hat. Er packt die Katze in Folie und tötet sie. Dem Tod ist er so nicht näher gekommen, dem Mord schon.
Eine Tages dann bricht das Weltgefüge. Bubbys verschollener Vater, der sich noch vor der Geburt aus dem Staub gemacht hatte, kehrt als „Priester“ zurück. Der Fremde, der ein Teil des Eigenen war und nun wieder ist, verlangt Rechte in diesem rechtlosen Alltag.
Bubby reagiert mit einer altbekannten Art darauf: er wiederholt, mal ist er Mutter, mal ist er Vater. Und weil die Leute den Blick in den Seelenspiegel so überhaupt nicht vertragen können, muss Bubby eine Menge Schimpf und eine Menge Schläge aushalten. Für Bubby scheint das leicht. Derlei Erziehungsmethoden ist er ja gewöhnt. Zum endgültigen Bruch kommt es erst, als Bubby aus dem Bett verdrängt wird. Die Verweigerung der urmütterlichen Brüste lässt auch ihn verweigern. Er verweigert Mutter und Vater das Leben. Erst packt Bubby sie in Folie, dann packt er seinen Koffer und verschwindet. Der Folienmörder ist geboren. So wechselt man Identitäten. Man zerstört die eine Welt, um in eine neue zu gelangen.
3. Über den Film
Natürlich ist die Außenwelt nicht Giftverseucht, wohl aber Menschenverseucht. Bubby stolpert durch die wackligen Kulissen eines nun „größeren“ Gefängnisses. Wie sich Welt aneignen? Wie sich Welt einverleiben? Eben mit der Bubby-Methode. Man spielt die Welt, so gut es geht, nach. Bubby spielt fabelhaft, spielt verwegen. Immer wieder klaubt er Sätze aus der Asservatenkammer seiner Erinnerung, arrangiert das Gehörte in neue Zusammenhänge. Das muss schief gehen und das geht schief, deshalb weil er alle so perfekt imitiert, aber niemand sich wahrnehmen will. Imitation will also solche gekennzeichnet sein, ansonsten verweigern sich die Menschen solch performativen Operationen. Gleich Puzzleteilen greift Bubby Wortketten aus seiner Umgebung auf, um sie dann an ungeeigneter Stelle dem Puzzle Leben einzudrücken. Er fungiert als eine Art Recorder, der seine Umwelt zitiert. In diesen Vorführungen entlarvt er die Welt, ihre Phrasenhaftigkeit, ihre Leere und ihre Brutalität.
Erlösung findet Bubby erst in der Kunst, in seinem Fall in der Musik. Mehr durch Zufall gerät er ans Mikrofon einer Band, schmettert all die erlernten Beschimpfungen ins Publikum, spuckt, bellt und jauchzt. Die Rezeption ist begeistert. Sich kunstvoll beschimpfen lassen, das ist ganz nach dem Begehr eines ansichtswütigen Gegenüber.
Ist die erste Hälfte des Films noch ganz dem Theater Becketts geschuldet, entwickelt es sich im zweiten Teil immer mehr zu einem antireligiösen Erlöserdrama, während die Stücke Becketts ja immer verhinderte Erlöser präsentieren. Die Paradoxie sich als antireligiöses Erlöserdrama zu entkleiden passt gut in diesen Reigen rissiger Kommentare zur verfehlten Kommunikation. Während Bubby alle Welt versteht und sogar die Sprachungenauigkeiten von Behinderten transportiert, versteht die Welt Bubby nicht, weil er immer nur die Welt nach außen trägt. Die Welt aber will sich nicht zuhören. Die Welt ist quasi taub auf beiden Augen. Sie will sich nicht im Spiegel entdecken. Und genau das macht „Bad Boy Bubby“ dann am Ende auch zu einem moralischen Film. Nicht Filme entledigen sich der Moral, wie immer man diese ausdeuten und formulieren möchte, sondern die abgebildete Welt entbehrt dieser Moral. Somit dürfen sich Filmemacher auch nie um Moral kümmern, sondern immer nur am Objekt der Abbildung Interesse zeigen. Ein Interesse, das vor nichts und niemand halt machen sollte.
4. Über Bildstörung
Noch ein letzter Satz zur DVD: Das junge Label „Bildstörung“ hat „Bad Boy Bubby“ aufgegriffen, sein Antlitz ein wenig verfeinert und ihn dann in die Welt entlassen. Wir können solchen Eltern nur danken, weil sie uns einen der schönsten DVD-Neuerscheinungen des Jahres 2008 beschert haben.
(Erschienen bei Glanz&Elend)