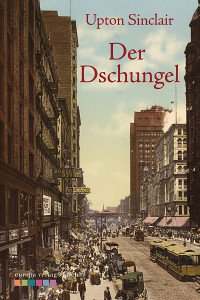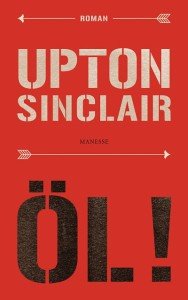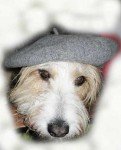80 Jahre Bücherverbrennung – Literaturquiz Teil 5
Mittwoch, 27. März 2013Die Fragen:
- Wie heißt die gesuchte Autorin?
- Wie lautet der Titel ihres 1930 erschienen Reportageromans?
- In welchen Berufen arbeitet sie während ihrer Amerikareise?
Antworten bitte an: Literaturblog Duftender Doppelpunkt
Einsendeschluss: Dienstag, 09. 04. 2013 um 12:00 Uhr.
Diesmal stellen der Karl Dietz Verlag und der Severus Verlag Bücher von bzw. über die gesuchte Autorin für die Verlosung zur Verfügung.
Erinnerung: Wenn Sie an die jeweils aktuelle Quizrunde erinnert werden möchten, senden Sie bitte einfach ein leeres Mail mit dem Betreff „Literaturquiz Erinnerung“ an das Literaturblog Duftenden Doppelpunkt.
Das literarische Rätsel
Oskar Maria Graf, der Autor des zwei Tage nach der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 in der Wiener „Arbeiterzeitung“ veröffentlichten Artikels „Verbrennt mich“, setzt sich für die gesuchte Autorin in einem Brief an Hubertus Prinz zu Löwenstein, dem Begründer der „American Guild for Cultural Freedom“, ein.
Unter anderem beschreibt er sie als „eine sehr aktive antifaschistische Schriftstellerin, die nur wenige kennen. Sie ist nicht nur eine gute Schriftstellerin, sondern eine der mutigsten und bescheidensten Frauen, die wir haben“.
Die „American Guild for German Cultural Freedom“ unterstützt in die USA emigrierte deutsche KünstlerInnen und Intellektuelle mit Stipendien und rettet durch die Beschaffung von Bürgschaften, Visa und Schiffspassagen oftmals Leben.
Die gesuchte Autorin wird 1892 in einer deutschsprachigen Familie in Ungarn geboren. Ab 1913 arbeitet sie als Journalistin in Budapest. Nach dem 1. Weltkrieg bzw. dem Ende der Ungarischen Räterepublik, für die sie sich engagiert, emigriert sie über Wien nach Berlin.
Gemeinsam mit Egon Erwin Kisch, Anna Seghers, Erich Weinert und vielen anderen organisiert sie sich im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller.
Sie arbeitet für den Ullstein Verlag und die von Willi Münzenberger geleitete Kosmos-Verlag GmbH. Diese ist das zweitgrößte Medienunternehmen der Weimarer Republik und druckt beispielsweise die „Arbeiter Illustrierte Zeitung“ (AIZ), zu deren MitarbeiterInnen auch der „Erfinder“ der politischen Fotomontage, John Heartfield, gehört.
In der Zeitung „Uj Elöre“, („Neuer Vorwärts“), der einzigen linken ungarischen Tageszeitung in den USA, erscheint 1923 der von ihr ins Ungarische übersetzte Roman „Die eiserne Ferse“ von Jack London in Fortsetzungen. 1933 werden „Die eiserne Ferse“ wie auch die Werke der gesuchten Autorin auf dem Scheiterhaufen in Flammen aufgehen.
Ab 1925 durchquert sie drei Jahre lang den amerikanischen Kontinent. Ihr Weg führt sie von New York bis nach Venezuela und Haiti. Bei ihrer literarischen Arbeit verlässt sie sich nicht auf den Blick von außen. Sie sammelt vielmehr in den unterschiedlichsten beruflichen Tätigkeiten, beispielsweise als Dienstmädchen, Zigarrendreherin und in einem Automatenrestaurant, ihre Erfahrungen vor Ort.
Ihr Schreiben ist geprägt von der Erkenntnis, dass die ArbeitnehmerInnen sich organisieren und solidarisch handeln müssen, wollen sie ihre Lage zum Besseren wenden. Die Voraussetzung für ein solidarisches Handeln sieht sie in einem möglichst umfassenden Verständnis der komplexen Prozesse, die für die wirtschaftliche und politische Entwicklung auf dem Globus verantwortlich zeichnen.
„Kein Ereignis bleibt isoliert, nirgends, auch in den entferntesten Winkeln der Erde kann etwas geschehen, das nicht alle gleichmäßig anginge. Die Welt ist ein organisches Ganzes, auch wenn sich die einzelnen Teile noch so heftig bekämpfen.“
1930 erscheint ihr Reportageroman „Hotel Amerika“. In eine Kriminalhandlung eingebettet, entwickelt sich das Schicksal des Wäschemädchens Shirley O’Brien. Der Roman thematisiert die sozialen Missstände anhand der Arbeitsbedingungen in einem amerikanischen Luxushotel.
Während sich der nationalsozialistische Terror im „Deutschen Reich“ ausbreitet, kann sie 1932/33 die sozialkritische Serie „Frauen im Sturm der Zeit“ in der „Welt am Abend“ und in der „Arbeiter-Illustrierte Zeitung“ den antikolonialistischen Fortsetzungsroman „Wehr dich, Akato“ veröffentlichen.
Ebenfalls 1932 erscheinen ihre Sozialreportagen aus Amerika in dem Sammelband „Eine Frau reist durch die Welt“.
Auf der schwarzen Liste des nationalsozialistischen Bibliothekars Wolfgang Herrmann befindlich, werden ihre Bücher 1933 verbrannt. Sie muss untertauchen und kommt als Emigrantin über Prag nach Paris. Mehrfach kehrt sie inkognito ins Deutsche Reich zurück und berichtet anschließend, wie sich das Land zum Krieg rüstet.
Trotz schwierigster Lebensbedingungen, versucht sie weiterhin als Schriftstellerin zu arbeiten. Ihre Reportagen erscheinen in der Exilpresse; in der Prager Zeitschrift „Die Neue Weltbühne“, in der „Pariser Tageszeitung“ und in „Das Wort“ in Moskau.
Mit „Elisabeth, ein Hitlermädchen“, der Roman erscheint 1937 in Fortsetzungen in der „Pariser Tageszeitung“, setzt sich die Autorin mit dem Thema Jugend und Faschismus auseinander.
Ab 1939 versucht sie intensiv, ein Visum für die USA zu erhalten. Hilfsorganisationen, insbesondere der „American Guild“ unterstützt sie dabei.
1940, nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Paris, wird sie von den französischen Behörden im Lager Camp de Gurs interniert. Ihr gelingt die Flucht nach Marseille, wo sie in extrem ärmlichen Verhältnissen im Untergrund lebt.
Hubertus Prinz zu Löwenstein schreibt in einer handschriftlichen Notiz, mit der er seinen Brief vom 31. Juli 1941 an Alfred Kantorowicz ergänzt, unter anderem über die Situation der Autorin: „Anna Seghers hatte sich sehr für sie eingesetzt. Aber jetzt kann ich einfach nichts machen, ich habe alles versucht. Das Emergency Rescue Committee, an das ich mich wandte, war unfähig (oder unwillig!) ihr ein Affidavit zu verschaffen. Jetzt hat das Rautenstrauch (?) Committee den Fall; die American Writers haben nichts getan! – Bitte helfen Sie!“
Im Frühjahr 1942 wird sie ein letztes Mal, verzweifelt und krank, im Büro des American Rescue Committee in Marseille gesehen. Danach verliert sich vorerst ihre Spur.
Vor allem den jahrzehntelangen Recherchen von Helga Schwarz verdanken wir den Großteil unseres heutigen Wissens über die Autorin.
Auf diesen Informationen aufbauend, kann Julia Killet im Rahmen ihrer Dissertation 2009/2010 das Ende der „verschollenen“ Schriftstellerin klären. Sie stößt auf behördliche Dokumente, die ihren Tod infolge völliger Erschöpfung für den 14. März 1942 attestieren.
Alle Beiträge zum Thema Bücherverbrennung / Exilliteratur im „Duftenden Doppelpunkt“ finden Sie in der Kategorie Bücherverbrennung und Exil.
In Petra Öllingers Bibliothek finden Sie eine Liste mit über 200 AutorInnen, Hinweise auf Sekundärliteratur und weiterführende Links.