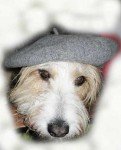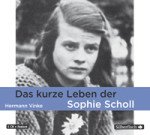Anlässlich des Gedenkens an die Bücherverbrennung am 30. April 1938 in Salzburg, firmiert der 7. Teil des Literaturquizes, mit dem wir an die Bücherverbrennungen 1933 / 1938 erinnern, diesmal ausnahmsweise unter dem Titel „75 Jahre Bücherverbrennung in Salzburg“.
Der Fischer Taschenbuchverlag stellt jeweils ein Exemplar zweier Titel des gesuchten Autors zur Verfügung. Weiters können Sie diesmal Publikationen der Verlage Milena, Promedia, Zweitausendeins und C.Bange gewinnen.
Die Quizfragen:
Wie heißt der gesuchte Autor?
Wie lautet der Titel seiner posthum erschienen Autobiografie?
Nennen Sie mindestens einen Literaten, den der Autor im Exil unterstützt hat.
Antworten bitte an: Literaturblog Duftender Doppelpunkt
Einsendeschluss: Dienstag, 07. 05. 2013 um 12:00 Uhr.
Erinnerung: Wenn Sie an die jeweils aktuelle Quizrunde erinnert werden möchten, senden Sie bitte einfach ein leeres Mail mit dem Betreff „Literaturquiz Erinnerung“ an das Literaturblog Duftenden Doppelpunkt.
Das literarische Rätsel
Als Sohn eines Großindustriellen und einer Bankierstochter in Wien des Fin de Siècle aufwachsend, erfüllt er die bildungsbürgerlichen Ansprüche seines Elternhauses. Er maturiert und studiert Germanistik und Romanistik.
Im Winter 1900 schreibt er voller Stolz an Karl Emil Franzos (1848 – 1904), dem Herausgeber der Halbmonatszeitschrift „Deutsche Dichtung“: „Ich habe jetzt einen Gedichtband zusammengestellt unter dem Titel ‚Silberne Saiten‘, der 50 Gedichte enthält, d. h. die genaueste Auslese.“ Als das Buch 1901 im Verlag Schuster & Löffler in Berlin veröffentlicht wird, ist er gerade einmal 19 Jahre. Zu seiner großen Freude vertont Max Reger (1873 – 1916) später zwei dieser Gedichte.
Mir wird der Herbst so nah. Ich fühle seinen Frieden:
Mein Herz wird reich und groß in weitem Einsamsein.
Denn Schwermut, die die dunklen Dörfer überweht,
Hat meiner Seele viel von ihrem Glück gegeben.
Nun tönt sie leiser, eine Glocke im Gebet,
Und glockenrein und abendmild scheint mir mein Leben,
Seit es des Herbstes ernstes Bruderwort versteht.
Nun will ich ruhen wie das müde dunkle Land…
Beglückter geht mein Träumerschritt in leise Stunden,
Und sanfter fühle ich der Sehnsucht heiße Hand.
Mir ist, als hätt` ich einen treuen Freund gefunden,
Der mir oft nah war und den ich nie gekannt.
1904 erscheint seine erste Novelle „Die Liebe der Erika Ewald“. In diesem Jahr schließt er auch sein Studium mit dem Doktor der Philosophie ab.
Durch seine vielen Reisen, so besucht er bereits 1910 Indien und 1912 Nord- und Mittelamerika, lernt er zahlreiche Literaten und Künstler kennen, mit denen er, teilweise freundschaftlich verbunden, eine umfangreiche und langjährige Korrespondenz führt.
Nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs meldet er sich freiwillig zum Militär und arbeitet im k. u. k. Kriegsarchiv. Die Realität des Krieges ist ihm, auch fern des millionenfachen Sterbens, rasch bewusst und lässt ihn zum engagierten Pazifisten werden. 1917 vom Militärdienst entlassen, reist er in die neutrale Schweiz nach Zürich. Von dort aus arbeitet er als Korrespondent für die „Neue Freie Presse“ und publiziert seine humanistische Weltsicht auch in der „Pester Lloyd“.
Die Aufgabe des Schriftstellers und Publizisten sieht er nicht darin, unmittelbar politisch Stellung zu beziehen. Seine zunehmende internationale Bekanntheit nutzt er allerdings konsequent, um für humanistische und pazifistische Werte einzutreten.
Er überträgt das Werk bedeutender Autoren, wie jenes des Franzosen Romain Rolland (1866 – 1944) oder des Belgiers Emile Verhaeren (1855 – 1916) ins Deutsche: „Dem eigenen Wunsch und dem Rate Richard Dehmels folgend, nützte ich meine Zeit, um aus fremden Sprachen zu übersetzen, was ich noch heute für die beste Möglichkeit für einen jungen Dichter halte, den Geist der eigenen Sprache tiefer und schöpferischer zu begreifen …“
1919 bezieht er das bereits im Ersten Weltkrieg erworbene Paschinger Schlössel am Salzburger Kapuzinerberg. 1920 heiratet er die Schriftstellerin Friederike von Winternitz (1882 – 1971). Während der gemeinsamen Jahre in Salzburg unterstützt sie, unter Einschränkung ihres eigenen literarischen Schaffens, die Arbeit ihres Mannes.
Salzburg ist für ihn ein „produktives Pflaster“. Er schreibt unter anderem Novellen, Erzählungen, Theaterstücke und Biografien.
Die Gefahr des Nationalsozialismus erkennt er nicht in ihrer vollen Tragweite, hofft vielmehr, es wird alles rasch vorübergehen.
So schreibt er im Jänner 1932 an den französischen Literaturnobelpreisträger und Pazifisten Romain Rolland (1866 – 1944): Er „fürchte die Hitler-Anhänger nicht, selbst wenn sie an die Macht kommen“, denn „nach zwei Monaten werden sie sich selbst zerfleischen.“
Am 10. Mai 1933 wird er demselben fassungslos mitteilen: „Nicht ein Protest eines deutschen Schriftstellers gegen das Autodafé von Werfel, von Wassermann, von Schnitzler, von mir! Keiner, keiner, keiner! Nicht mal in einem privaten Brief!! (…) Ich bin derselbe Mensch, derselbe Schriftsteller wie vor 14 Tagen, ich habe seitdem nicht eine Zeile publiziert.
Aber seit dem Moment, da ich auf der Liste dieser 18jährigen kleinen Hanswurste stehe, wagt niemand mehr, mir zu sagen: ‚Wie geht´s, lieber Freund.‘ Ach, sie haben schon um solche Kleinigkeiten Schiß: stellen Sie sich vor, wie es erst in wirklicher Gefahr oder im Kampfe sein wird.“
Sein Freund Joseph Roth (1894 – 1939) ist da um vieles hellsichtiger, dieser schreibt ihm im April 1933: „Unsere Bücher sind im Dritten Reich unmöglich. Nicht einmal inserieren wird man uns. Auch nicht im Buchhändler-Börsenblatt. Die Buchhändler werden uns ablehnen. Die SA-Sturmtruppen werden die Schaufenster einschlagen.“
Nachdem der Nationalsozialismus immer stärker nach Österreich ausstrahlt und es einige Tage nach dem Ende des Bürgerkriegs („Februar 34“) zu einer polizeilichen Durchsuchung in seinem Haus kommt, übersiedelt der Autor nach London.
Seine Frau bleibt vorerst in Salzburg. Nach ihrer Scheidung 1938 emigriert sie nach Frankreich und später in die USA. Dort arbeitet sie als Übersetzerin und schreibt unter anderem biografische Werke über ihn.
Er enthält sich weiterhin einer eindeutigen Parteinahme gegen den Nationalsozialismus. So betont er in seiner Rede am P.E.N.-Kongress 1937 in Paris – das Treffen ist vom Spanischen Bürgerkrieg und vom Mord an Garcia Lorca (1898 – 1936) durch die spanischen Faschisten überschattet – es müsse „die Unberührbarkeit der dichterischen Aufrichtigkeit unversehrt bestehen bleiben.“
Seine finanziellen Mittel und seine Kontakte zu einflussreichen Persönlichkeiten setzt er immer wieder ein, um zu helfen. So unterstützt er Joseph Roth (1894 – 1939) und Ernst Weiß (1882 -1949) mit monatlichen Zahlungen. Eine argentinische Auszeichnung lehnt er dankend ab und bittet statt dessen um Visa für drei Flüchtlinge.
In England lebt er gemeinsam mit seiner Sekretärin Lotte Altmann (1908 – 1942), sie heiraten 1939. Ein Jahr später erhalten sie die britische Staatsbürgerschaft. Bald darauf verlassen sie Europa.
Bereits 1936, auf dem Weg zum Treffen des PEN-Clubs im argentinischen Buenos Aires, lernt er Brasilien kennen und wird begeistert aufgenommen. Das Land wird für ihn zum Gegenbild des von Krieg und Rassismus zerstörten Europas. In einem Vortrag unter dem Titel „Dank an Brasilien“ vor der Brasilianischen Literaturakademie in Rio schließt er mit den Worten: „Und wenn ich mir vom Leben noch etwas Schönes wünschen darf zu dem unerschöpflich Schönen, das ich hier gesehen und empfangen habe, so wäre es dies: – wiederkehren zu dürfen in dieses wunderbare Land!“
Auf den Tag genau, vier Jahre nach seiner ersten Ankunft, betritt er gemeinsam mit seiner Frau wieder brasilianischen Boden.
Getulio Vargas (1882 – 1954), er regierte von 1937 – 1945 mit diktatorischer Vollmacht, hat in der Zwischenzeit den Notstand ausgerufen, alle politischen Parteien verboten und den „Estado Novo“ („Neuer Staat“) proklamiert. Eine Reihe führender Männer des Regimes befürworten zu diesem Zeitpunkt freundschaftliche Beziehungen mit dem nationalsozialistischen Deutschland.
1941 dankt er Brasilien für die freundliche Aufnahme mit dem kulturpolitischen Essay „Brasil – Païs do futuro“ („Brasilien – Ein Land der Zukunft“). Das Buch wird von einem Teil der BrasilianerInnen, nicht zuletzt durch seine idealisierende Sichtweise, als Auftragswerk des autoritär herrschenden Regimes gesehen.
Zuletzt lebt er gemeinsam mit seiner Frau in Petropolis, 70 Kilometer von Rio, hoch in den Bergen.
In seiner Autobiografie, die er nun vollendet, hält er Rückschau: „Jener Septembertag 1939 zieht den endgültigen Schlußtrich unter die Epoche, die uns Sechzigjährige geformt und erzogen hat. Aber wenn wir mit unserem Zeugnis auch nur einen Splitter Wahrheit aus ihrem zerfallenden Gefüge der nächsten Generation übermitteln, so haben wir nicht vergebens gewirkt.“
Am 22. Februar 1942 setzen beide, durch die Einnahme von Veronal, ihrem Leben ein Ende. Sein Abschiedsbrief, „Declaração“, schließt mit folgenden Zeilen:
„Ich grüße alle meine Freunde! Mögen sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht! Ich, allzu Ungeduldiger, gehe ihnen voraus.“
Entgegen ihrem testamentarischen Wunsch wird das Ehepaar im Rahmen eines Staatsbegräbnisses auf dem Friedhof von Petropolis zu Grabe getragen.
Im Mai 1942 beschließt die Wiener Universität, ihm den Doktortitel abzuerkennen.
***
Siehe auch den Beitrag Bücherverbrennung in Salzburg.