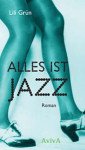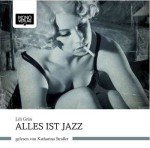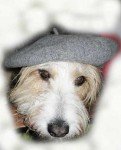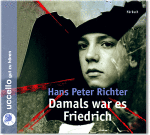80 Jahre Bücherverbrennung – Literaturquiz Teil 14
Mittwoch, 31. Juli 2013Wir möchten mit dieser Quizreihe jener AutorInnen gedenken, deren Werke der Bücherverbrennung 1933 zum Opfer gefallen sind und auf die oftmals in Vergessenheit geratene Exilliteratur aufmerksam machen. Über das Quiz hinaus finden Sie im Beitrag Bücherverbrennung-Exilliteratur in der Bibliothek von Petra Öllingers virtueller Wohnung viele weitere Anregungen und Informationen.
Die Fragen können Sie, so sie Sie die Antworten nicht ohnedies aus dem Handgelenk schütteln, nach dem Lesen des nachstehenden Textes und einer kurzen Recherche im Netz rasch beantworten.
Auch diesmal gibt es einige Bücher bzw. ein akustisches Porträt des Dichters auf CD zu gewinnen.
Eine zusätzliche Gewinnmöglichkeit bietet die „Sommerliche Zusatzrunde“: Sie machen FreundInnen, Bekannte oder KollegInnen auf das Quiz aufmerksam? Dann haben Sie, sobald jemand aus diesem Kreis bis zum 15. August an einer der Quizrunden teilnimmt, die Chance die zehnbändige Sonderedition „Die Bibliothek der verbotenen Bücher“ zu gewinnen. Dem bzw. der neuen TeilnehmerIn bietet sich wiederum die Möglichkeit „Paradies in schwerer Zeit. Künstler und Denker im Exil in Pacific Palisades“ zu erhalten.
Die Quizfragen:
- Wie heißt der Autor?
- Wie wurde er von seinen FreundInnen genannt?
- Welcher große deutsche Dichter der Romantik, dessen Geburtstag sich 2013 zum 225. Mal jährt, verstarb am 26. November 1857 mit 69 Jahren im Geburtsort des gesuchten Autors?
Antworten bitte an: Literaturblog Duftender Doppelpunkt
Das literarische Rätsel
„Sogar das bisschen Schein von einem Rang / zerrann und ließ mich vor der Welt nichts gelten. / Durch der Jahrzehnte Auf- und Niedergang / bleib ich der Ungebetne vor den Zeiten.“
Aus dem Gedicht „Der Zaungast“
Er ist zeitlebens ein Außenseiter, ein melancholischer Zaungast. 1886 geboren, studiert er Literatur- und Kunstgeschichte in Breslau und München und entschließt sich in seiner Heimatstadt, dem heutigen Nysa, als „freier Schriftsteller“ zu leben. Ab 1911 veröffentlicht er seine Lyrik in der von Franz Pfemfert herausgegebenen Zeitschrift „Die Aktion“ und im darauffolgenden Jahr im von Alfred Kerr verantworteten „Pan“. Im Ersten Weltkrieg nimmt er von Beginn an einen pazifistischen Standpunkt ein. Nach dem Tod der Eltern übersiedelt er 1917, gemeinsam mit der geliebten Frau Leni Gebek, nach Berlin.
In der Hauptstadt des Deutschen Reichs wird er zu einer bekannten Persönlichkeit der Bohème. Neben vielen Gedichten veröffentlicht er Romane, Erzählungen, Texte fürs Theater und Kabarett. Er arbeitet als Literatur- und Theaterkritiker und wird im Laufe der 20er Jahre zu einem der bekanntesten Berliner Autoren.
Er wird von seinem Freund George Grosz und vielen weiteren Künstlern wie Ludwig Meidner, Otto Dix oder Oskar Kokoschka porträtiert.
Über seine Besuche bei George Grosz schreibt er „Ganz zu Hause fühlte ich mich stets auch bei George Grosz. Wir hatten ungefähr dieselbe Gesinnung und Stimmung, dieselbe Sammlerneigung … Wir waren beide sowohl Lyriker als Zyniker, korrekt und anarchisch! Ich saß ihm unzählige Male herzlich gern (Modell), war in seinem Atelier selig geborgen … Er arbeitete an meinem Porträt mit einer Sorgfalt, die das Schaffen ganz ernst nahm.“
Eines dieser von Georg Grosz geschaffenen Bilder ist 1937 in der NS-Ausstellung „Entartete Kunst“ im Münchner Hofgarten zu sehen.
Wenn er einer der häufigst porträtierten Literaten seiner Zeit ist, so kann seine Frau Leni Gebek dank „Macke“, wie seine Berliner FreundInnen den Schriftsteller nennen, als eine der „umdichtetsten“ Frauen der deutschsprachigen Literatur bezeichnet werden.
Wir wollen näher aneinander rücken,
Noch näher .. so! nun gib mir Deine Hand!
Sahst Du im Sonnenstrahl den Tanz der Mücken,
Bis ihnen, allzu schnell, die Sonne schwand …
Mich fröstelt noch – auch meines, Deines Lebens
Tänzelnde Spiele sterben bald in Nacht! -
Noch faß ich Dich und halte Dich –- vergebens!
Die Stunde eilt, da wir uns, jäh erwacht,
Nach dieses Traumes Glück noch trunken bücken ..
Vorbei! – einsam, wie kalt! – Die Sonne schwand!
Wir wollen näher aneinanderrücken,
Noch näher .. so! – Und gib mir Deine Hand.
Er verbindet seinen Namen mit jenem seiner Geburtsstadt. Er tut dies, um Verwechslungen mit einem gleichnamigen Berliner Theaterwissenschafter hintanzuhalten. Über die Symbolik dieser Vorgangsweise werden bis heute Überlegungen angestellt. Ist der Bindestrich zwischen den beiden Namensteilen auch als Trennstrich zu verstehen? Drückt er durch den Doppelnamen sein vielschichtiges, mehrdeutiges Verhältnis zum Ort seiner Geburt aus?
In seinem biografischen Essay „Trauer und Trotz“ blickt er 1928 zurück: „Der harte, gewalttätige, böse Grundanstoß, der sozusagen meine Wunde zum Bluten brachte, das erste wirklich schwere Leid, das mich zum Dichter schlug, war das Erlebnis missgestalteter Körperhaftigkeit, des Verwachsenseins.“
Kurz nach dem Reichstagsbrand verlässt er gemeinsam mit seiner Frau Deutschland und emigriert über die Schweiz, Holland und Frankreich nach London.
Einem Freund schreibt er: „Ich könnte ja auch ein anerkannter deutscher Lyriker jetzt werden, mit meiner Naturlyrik und meiner uralten schlesischen Bauernahnenreihe, aber ich brächte es nicht über mich, auch nur stillschweigend mich fördern zu lassen von einem System, das für mich das wahrhaft teuflischste ist.“ Weiterlesen »