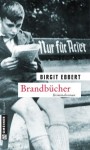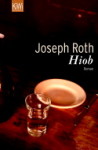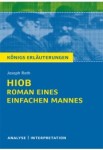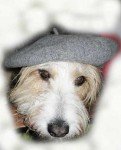80 Jahre Bücherverbrennung – Literaturquiz Teil 16
Mittwoch, 28. August 2013Die Quizfragen
- Wie heißt die Autorin?
- Wie lautet der Titel ihres Romanerstlings?
- Wer illustriert ihren Roman „Der Leib der Mutter“?
Antworten bitte an: Literaturblog Duftender Doppelpunkt
Unter allen richtigen Einsendungen werden einige Bücher verlost.
Erinnerung: Wenn Sie an die jeweils aktuelle Quizrunde erinnert werden möchten, senden Sie bitte einfach ein leeres Mail mit dem Betreff „Literaturquiz Erinnerung“ an das Literaturblog Duftenden Doppelpunkt.
Einen Gesamtüberblick über alle bisher veröffentlichten literarischen Rätsel können sie sich auf der Seite „Literaturquiz zur Bücherverbrennung 1933″ verschaffen.
Das literarische Rätsel
„Auch da draußen, in den Gassen der Armen, kam ein erster Frühlingstag. Nicht, daß die Sonne warm und schön geschienen hätte. Der Regen hatte aufgehört, und die Luft war klar, und überall hörte man Singvögel. Aber wie weit war es noch von der richtigen Lenzzeit. Der Wind hat noch etwas Eisiges vom letzten Schnee, und doch sind die Knospen an den Sträuchern alle schon da. Aber es ist und bleibt kalt und windig und nur blauer Himmel und Hoffnung wagt sich hervor.“
Sie ist eine jener AutorInnen, deren Lebensspuren vom Nationalsozialismus fast völlig ausgelöscht wurden. 1884 in Wien geboren, wächst sie gemeinsam mit einem „Schippel“ Geschwister in ärmlichen Verhältnissen auf. Als ihr Vater arbeitslos wird, bricht sie die Ausbildung zur Lehrerin ab und beginnt als Arbeiterin in einer Miederwerkstatt.
Wann sie journalistisch bzw. literarisch zu arbeiten beginnt, kann, da weder einen Nachlass noch Berichte von ZeitgenossInnen vorliegen, nicht verlässlich bestimmt werden.
Die erste bisher entdeckte Publikation, die Erzählung „Bettina und der Faun“, erschien am 5. Juli 1908 in der liberalen Wiener Tageszeitung „Die Zeit“.
Ihre Erzählungen, Rezensionen, Feuilletons veröffentlicht sie unter anderem in „Der Abend“, „Neue Freie Presse“ und der „Arbeiter-Zeitung“, dem Zentralorgan der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs (SDAPÖ). Vor allem macht sie sich mit sozialkritischen Reportagen aus den Armenbezirken Wiens und aus dem Milieu des jüdischen Proletariats, dem sie selbst entstammt, einen Namen.
1916 wird ihr Theaterstück „Der Schrei, den niemand hört“ auf der Wiener Volksbühne uraufgeführt. Die Kritiken sind zwiespältig. Neben einigen wohlwollenden Rezensionen, die das Talent der Autorin in den Mittelpunkt stellen, ist der Tenor einer Reihe von Besprechungen ablehnend bis gehässig. Dem Schauspiel ist letztlich kein großer Erfolg beschieden und es wird bald vom Spielplan genommen.
Während des Ersten Weltkrieges schließt sie sich dem Kreis um den Sozialreformer Josef Popper Lynkeus an. In seinem Werk „Die allgemeine Nährpflicht als Lösung der sozialen Frage“ entwickelt er bereits 1912 die Idee eines staatlich garantierten Grundeinkommens.
Sie beteiligt sich 1922 an der Gründung der Wiener Gruppe „Clarté“, einer 1919 von Henri Barbusse und Romain Rolland gegründeten Vereinigung von Intellektuellen zur Bekämpfung des Krieges und seiner Ursachen.
Über ihren autobiografisch geprägten Romanerstling „Löwenzahn“ schreibt Felix Salten in der „Neuen Freien Presse“: „Eine Kindheit, steht da als Untertitel, und das Buch erzählt in der Ichform die Geschichte einer in Armut verlebten Kinderzeit. Ein kleines Mädchen wächst auf, in einer Armeleutewohnung der Großstadt. Einige Stuben, von Stickluft und Küchendunst erfüllt, in irgendeiner Mietskaserne, die wieder neben anderen Mietskasernen in einer der vielen traurigen Gassen steht, aus denen sich die sogenannten volkreichen Bezirke zusammensetzen. Wien? Ja, Wien. Aber nicht die Stadt der Wiener Literatur oder des Wiener Walzers oder des Wiener Frohsinns oder sonst eines typischen, hundertfach plakatierten Wiener Merkmales, sondern ein anonymes, eintönig graues, unendlich trübseliges Wien, ein Großstadtgefängnis, darin man gelebt haben, darin man heimisch sein muß, um zu erkennen, wie gut hier die Trostlosigkeit der Brigittenau und mancher elender Teile der Leopoldstadt getroffen ist. (…) In diesen dumpfen Stuben also, in diesen armen Straßen wächst ein kleines Mädchen auf. Und erzählt ihr Leben. Von ihren ersten Eindrücken angefangen, von ihren frühesten Erinnerungen bis zur Schule. Dann durch die Schuljahre bis zur Erwachsenenheit. (…) Es ist ein seltsames Buch, das man mit Schmerz und mit Entzücken liest und das man unweigerlich bewundert, das man bedingungslos liebt, wenn man es gelesen hat.“
Obwohl sie literarisch bzw. journalistisch sehr produktiv ist, bleiben ihr gesicherte finanzielle Verhältnisse zeitlebens verwehrt. In dem Beitrag mit dem Titel „Ohne Geld“ bringt sie ihre Situation auf den Punkt:
„Man nimmt einen Anlauf, setzt sich hin und schreibt Anschriften, vierzig Briefumschläge mit dem Namen, Ort und Straße von Zeitungen! (Ich besitze die wertvolle Liste, die mir einmal ein lieber Kollege von seiner eigenen Liste selbstlos abschrieb.) Und schickt weg. Vierzig Manuskripte . . . Einmal erhalte ich – schon auf die zweite Mahnung, meine Geduld war auch einmal zu Ende – aus einem entfernt gelegenen Teil Posens sechs Mark, nebst Entschuldigungsschreiben. Und ein andres Mal sogar drei Mark. Drei Mark sind besser als gar nichts, denke ich, auf diese Weise habe ich schon fast meine eigenen Spesen für Papier, Porto, Schreibmaschinenabschrift, Fingerschwielensalbe usw. hereingekriegt – der Geist arbeitet umsonst.“ Weiterlesen »