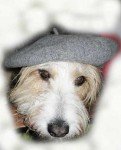Nun ist es soweit: Das dreiundzwanzigste und letzte literarische Rätsel im Rahmen unseres Jahresschwerpunktes „80 Jahre Bücherverbrennung“ ist online.
Da die Frage nach dem Autor diesmal keine große Herausforderung darstellt, haben wir die restlichen Quizfragen etwas umfänglicher und ein wenig komplexer als üblich gestaltet.
Trotzdem sollten das Lesen des Rätsels und eine kurze Recherche im Internet für die Beantwortung der Fragen ausreichen.
Wir hoffen, dass Ihnen die Beschäftigung mit dieser vorerst letzten Quizrunde Freude bereitet und Sie einen Gewinn daraus ziehen. Wie immer werden auch diesmal einige Bücher unter den TeilnehmerInnen des Literaturquizes verlost.
Zwei Zusatzpreise
1. Sie haben 20 – 23 Mal an unserem Literaturquiz teilgenommen? Dann haben Sie nun die Chance, ein Buchpaket zu gewinnen.
2. Unter allen TeilnehmerInnen, die das Quiz im „Duftenden Doppelpunkt“ kommentieren, verlosen wir ebenfalls ein Buchpaket.
Wer gewinnt, wird das Los am 17. Dezember entscheiden.
Und nun zu den Quizfragen:
- Wie heißt der Autor?
- Wie lautet der Titel seines erst heuer in Dresden uraufgeführten Weihnachtsstückes?
- Wie heißt der Illustrator seines ersten, 1928 veröffentlichten Gedichtbandes?
- Die „Schwarzen Listen“ des Bibliothekars Wolfgang Herrmann bildeten die Grundlage für die Bücherverbrennung 1933. Bis auf eine Ausnahme befanden sich alle Werke des Autors auf diesem Index. Welches seiner Bücher landete 1933 nicht auf den Scheiterhaufen?
- Wie heißt seine langjährige Sekretärin, die er gerne „& Co“ nannte?
- Sein satirischer Roman aus dem 30er Jahren wurde heuer erstmals in ungekürzter Form unter seinem ursprünglichen Wunschtitel „Der Gang vor die Hunde“ publiziert. Unter welchem Titel wurde das Buch 1931 erstmals veröffentlicht?
Antworten bitte bis zum 17. Dezember 2013 um 12:00 Uhr an: Literaturblog Duftender Doppelpunkt oder über das Kontaktformular.
Einen Gesamtüberblick über alle bisher veröffentlichten literarischen Rätsel können Sie sich auf der Seite „Literaturquiz zur Bücherverbrennung 1933″ verschaffen.
***
Das literarische Rätsel
Als Kind fürchtet er sich vor dem Heiligen Abend. Dieser wird von Vater und Mutter als Wettstreit in Szene gesetzt. In seinen Erinnerungen schreibt er: „Es war ein Konkurrenzkampf aus Liebe zu mir, und es war ein verbissener Kampf. Es war ein Drama mit drei Personen, und der letzte Akt fand, alljährlich, am Heiligabend statt. Von seinem Talent aus dem Stegreif hing es ab, ob das Stück eine Komödie oder ein Trauerspiel wurde.“
Vielleicht ist dies die Ursache, dass er sich, so er über Weihnachten schreibt, oft als Pessimist, ja als Zyniker zeigt.
„Ich ging zum Alchinger, trank fünf Steinhäger und nahm an der Bescherung für Junggesellen teil. Ich bekam ein Paket Pfefferkuchen geschenkt. Sie waren steinhart. Ich benutze sie noch heute als Briefbeschwerer.“
Sein Vater ist Sattlermeister, der nach dem Bankrott seines Geschäfts in einer Kofferfabrik in Dresden arbeitet. Weil das Geld nicht reicht, stellt die Mutter in Heimarbeit Leibbinden her.
1899 wird dem Ehepaar ein Sohn geboren.
„Die Wohnung war schon klein genug, aber das Portemonnaie war noch kleiner.“ So rückte die Familie zusammen, und ein Zimmer mit Frühstück wird vermietet. Später lässt sich seine Mutter zur Friseurin ausbilden und wäscht, schneidet und onduliert von zuhause aus den Damen der Nachbarschaft das Haar.
Zwischen Mutter und Sohn besteht eine enge Bindung. Als er nicht mehr in Dresden lebt, werden sie über viele Jahre nahezu täglich Briefe und Karten austauschen. Vorerst tut sie alles, um ihren Sohn eine fundierte Ausbildung zu sichern: „Ihr Leben galt mit jedem Atemzug mir, nur mir“ schreibt er in seinen Erinnerungen.
Er ist ein ausgezeichneter Schüler und tritt 1913 ins Freiherrlich von Fletscher’sche Lehrerseminar ein. Der Begin des 1. Weltkriegs markiert das Ende seiner Kindheit und Jugend. Die älteren Seminaristen werden an die Front geschickt und schon wenig später treffen die ersten Todesnachrichten ein.
1917 soll auch er in den Krieg ziehen. In der militärischen Grundausbildung fällt er einem besonderen Leuteschinder in die Hände und muss danach wegen eines Herzschadens einige Wochen im Lazarett verbringen.
„Der Mann hat mir das Herz versaut.
Das wird ihm nie verziehn.
Es sticht und schmerzt und hämmert laut.
Und wenn mir nachts vorm Schlafen graut,
dann denke ich an ihn.“
Mit Glück und Geschick vermeidet er den Kriegseinsatz und entwickelt sich zu einem überzeugten Antimilitaristen.
Wieder zuhause, entschließt er sich gegen den Beruf des Lehrers, legt im Herbst 1919 das Kriegsabitur ab und belegt in Leipzig Germanistik und Theatergeschichte.
Mit 26 hat er seinen Doktor in der Tasche und ist als Autor kein Unbekannter mehr. So bedeutsame Zeitungen wie das „Berliner Tagblatt“, die „Vossische Zeitung“ und das „Prager Tagblatt“ veröffentlichen seine Beiträge.
Als er Anfang 1927 ein erotisches Gedicht, er nennt es „Nachtgesang eines Kammervirtuosen“, in der Plauener Volkszeitung veröffentlicht, kommt es zum Skandal.
Da das Werk im Gedenkjahr zu Beethovens hundertstem Todestag erscheint und mit folgenden Zeilen beginnt, erhalten seine KritikerInnen zusätzliche Munition:
„Du meine neunte Sinfonie!
Wenn du das Hemd an hast mit rosa Streifen …
Komm wie ein Cello zwischen meine Knie,
Und lass mich zart in deine Seiten greifen!“
Die Kampagne der national-konservativen „Leipziger Neuesten Nachrichten“ erreicht, dass sowohl der Autor als auch der Illustrator des Gedichtes ihre Anstellung bei der „Neuen Leipziger Zeitung verlieren.
Später wird der so Geschasste das Ereignis als einen Fußtritt Fortunas bezeichnen, der ihn von Leipzig nach Berlin befördert hat, mitten hinein in die „schönste Zeit meines Lebens“.
In der Reichshauptstadt trifft er nicht nur Autoren wie Kurt Tucholsky, Egon Erwin Kisch, Robert Musil, Anton Kuh und viele andere, sondern auch zahlreiche KünstlerInnen aus dem Bereich des Theaters und Films.
Noch kann er sich nur ein möbliertes Zimmer leisten und verarbeitet sein „Leid“ in folgenden Zeilen:
„Mancher Mann darf, wie er möchte, schlafen.
Und er möchte selbstverständlich gern!
Andre Menschen will der Himmel strafen,
und er macht sie zu möblierten Herrn.“
Das Café ist jener Ort, an dem er am besten seiner Berufung nachgehen kann: „Er schreibt auch in Restaurants, oder – noch lieber – in einer Nachtbar, bei einem oder mehreren Gläsern Champagner, die gut für sein schwaches Herz sein sollen, ihm aber auch ausgezeichnet schmecken, und vielen, vielen Zigaretten; die Mutter schimpft oft besorgt über seinen immensen Zigarettenverbrauch.“
Im Frühjahr 1928 erscheint sein erstes Buch, der Gedichtband „Herz auf Taille“.
Noch im selben Jahr wird er durch Edith Jacobsohn, sie ist nicht nur die Herausgeberin der „Weltbühne“, sondern auch die Inhaberin des Kinderbuchverlages Williams & Co., angeregt, ein Kinderbuch zu schreiben. 1929 liegt es bereits in den Auslagen der Buchhandlungen und stößt auf großes Interesse.
Mit seinen Kinderbüchern, es werden noch viele weitere folgen, will er vor allem mit Hilfe von Vorbildern erziehen und so die Gesellschaft verändern.
Aufgrund seiner humanistischen Geisteshaltung ist er ständigen Angriffen von konservativer und nationalsozialistischer Seite ausgesetzt. Gleichzeitig geht der Linken seine gesellschaftspolitische Positionierung nicht weit genug. Sie misst die zeitgenössische Literatur vor allem daran, inwieweit sie als geistige Waffe gegen den immer stärker werdenden Nationalsozialismus hilfreich ist und spricht dem Werk des Autors diese Qualität oftmals ab.
Robert Neumann beschreibt den Schriftsteller in einer Parodie, wie er ihn Ende der 20er Jahre wahrgenommen hat: „Halb ein Bürgerschreck und halb ein erschrockener Bürger.“ – Als solcher sieht er die Gefahr und gleichzeitig unterschätzt er sie. Meint, es wird schon nicht so schlimm kommen und hält die NationalsozialistInnen nicht zuletzt für dumm. Weiterlesen »