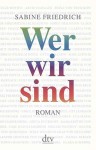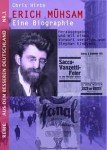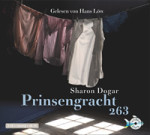Mela Hartwig
Dienstag, 5. November 2013Im 20. Teil unseres Literaturquizes wurde nach Mela Hartwig gesucht. Im Rahmen dieses literarischen Rätsels finden Sie ausführliche Infos über die Autorin.
Die Fragen und Antworten
- Unter welchem Namen veröffentlicht die Autorin zeitlebens ihre literarischen Werke? Mela Hartwig
- Wie lautet der Titel ihrer 1928 im Zsolnay Verlag veröffentlichten Novellensammlung? Ekstasen
- Welchen ihrer Romane wollte Metro-Goldwyn-Mayer mit Greta Garbo verfilmen? Das Weib ist ein Nichts
Falls die Informationen, die wir für Sie über Mela Hartwig im „Duftenden Doppelpunkt“ zusammengetragen haben, nicht ausreichen, sind Sie eingeladen, in folgenden Sites zu blättern:
- Diplomarbeit von Julia Maier-Lehner: Mela Hartwigs Novvellenwerk.
- Evelyn Fast: Das Frauenbild der 20er Jahre – Literarische Positionen von Irmgard Keun, Marieluise Fleißer und Mela Hartwig
Erinnerung: Wenn Sie an die jeweils aktuelle Quizrunde erinnert werden möchten, senden Sie bitte einfach ein leeres Mail mit dem Betreff „Literaturquiz Erinnerung“ an das Literaturblog Duftenden Doppelpunkt.
Alle bisherigen literarischen Rätsel und die das Quiz begleitenden Beiträge können Sie auf der Seite „Literaturquiz zur Bücherverbrennung 1933“ nachlesen.
Das nächste Quiz veröffentlichen wir am Mittwoch, dem 06. November 2013. Zur Beantwortung der Fragen haben Sie bis Dienstag, dem 19. November 2013 um 12:00 Uhr Zeit.
Die Preise und ihre GewinnerInnen
Julius H. Schoeps / Werner Tress: Orte der Bücherverbrennungen in Deutschland 1933 aus dem Olms Verlag geht an Gisela H. in Graz
 „Die Bücherverbrennungen von 1933 werden erstmals in ihrer deutschlandweiten Dimension dokumentiert. Die Autoren des Bandes haben durch Einzeluntersuchungen zu 62 Städten dazu beigetragen, 94 heute nachweisbare Bücherverbrennungen aufzuarbeiten.
„Die Bücherverbrennungen von 1933 werden erstmals in ihrer deutschlandweiten Dimension dokumentiert. Die Autoren des Bandes haben durch Einzeluntersuchungen zu 62 Städten dazu beigetragen, 94 heute nachweisbare Bücherverbrennungen aufzuarbeiten.
Während die Bücherverbrennungen bisher als eine vorübergehende, auf den Mai 1933 beschränkte und von Studenten organisierte Aktion eingeordnet wurden, ergibt sich nun ein gänzlich neues Bild des Gesamtphänomens. So kann gezeigt werden, dass bereits ab März 1933, also schon vor dem 10. Mai, zahlreiche Autodafés stattfanden. Bis in den Oktober 1933 hinein brannten in Deutschland die Scheiterhaufen. Es handelte sich dabei nicht nur um temporäre Massenevents, sondern um das Resultat dessen, was sich in den Wochen und Monaten zuvor landesweit zugetragen hatte: Plünderungen oppositioneller Parteigebäude, Razzien und Verhaftungen in Privatwohnungen, Säuberungen von Leihbüchereien und Buchhandlungen. Es folgte die Vertreibung der kulturellen und wissenschaftlichen Exzellenz aus Deutschland.“
Via Olms Verlag
Jakob Wassermann: Die Gefangenen auf der Plassenburg aus dem Kleebaum Verlag geht an Alexandra E. in Wuppertal
 Die Erzählung „Die Gefangenen auf der Plassenburg“ gehört zu Wassermanns frühen Meisternovellen. „Nach der Bücherverbrennung 1933 in Deutschland wurden seine Bücher verboten, obwohl er bis dahin einer der meistgelesenen Autoren gewesen war. Das bedeutete für ihn nicht nur den materiellen Ruin, sondern vor allem den Zusammenbruch seiner lebenslang gehegten Hoffnungen, durch sein Werk mithelfen zu können, eine Welt des Friedens ohne nationale Spannungen und ohne Rassenhass aufzubauen. Nach einer glänzenden Karriere starb Wassermann am 1. Januar 1934 im Alter von 60 Jahren in Altaussee, verarmt und psychisch gebrochen.“
Die Erzählung „Die Gefangenen auf der Plassenburg“ gehört zu Wassermanns frühen Meisternovellen. „Nach der Bücherverbrennung 1933 in Deutschland wurden seine Bücher verboten, obwohl er bis dahin einer der meistgelesenen Autoren gewesen war. Das bedeutete für ihn nicht nur den materiellen Ruin, sondern vor allem den Zusammenbruch seiner lebenslang gehegten Hoffnungen, durch sein Werk mithelfen zu können, eine Welt des Friedens ohne nationale Spannungen und ohne Rassenhass aufzubauen. Nach einer glänzenden Karriere starb Wassermann am 1. Januar 1934 im Alter von 60 Jahren in Altaussee, verarmt und psychisch gebrochen.“
Via Wikipedia
Joseph Berlinger: Hoffnung Havanna. Die Odyssee des Regensburger Kunstradfahrers Simon Oberdorfer aus dem LOHRBär Verlag geht an Dagmar W. in Wien
 „Joseph Berlinger zeichnet in seinem Feature die dramatische Lebensgeschichte des Regensburgers Simon Oberdorfer nach. Eine Geschichte, die tragisch endete: Oberdorfer wurde 1943 im Vernichtunglager Sobibor von den Nazis ermordet.
„Joseph Berlinger zeichnet in seinem Feature die dramatische Lebensgeschichte des Regensburgers Simon Oberdorfer nach. Eine Geschichte, die tragisch endete: Oberdorfer wurde 1943 im Vernichtunglager Sobibor von den Nazis ermordet.
Dabei begann alles so euphorisch: Der Velodromgründer, Kunstradfahrer und Varieté-Direktor verpasste seinem Regensburg eine Frischzellenkur. In Oberdorfers architektonisch reizvoller Stadthalle gab es Zirkus und Tanz, Politik und Propaganda, Kunst und Kommerz, Show und Geschäft…“
Via LOHRbBär Verlag
Das Brennglas von Otto Rosenberg. Aufgezeichnet von Ulrich Enzenberger aus dem Verlag Klaus Wagenbach geht an Traude P. in Aldrans
 „Otto Rosenberg hat erst nach fünfzig Jahren die Kraft für dieses Buch gefunden. Ein überlebender deutscher Sinto erzählt von seinen Erinnerungen. Er klagt nicht an, rechnet nicht auf. Er berichtet, wie es gewesen ist.
„Otto Rosenberg hat erst nach fünfzig Jahren die Kraft für dieses Buch gefunden. Ein überlebender deutscher Sinto erzählt von seinen Erinnerungen. Er klagt nicht an, rechnet nicht auf. Er berichtet, wie es gewesen ist.
Vorher waren Sinti und Roma eingebunden in das Berliner Stadtleben. Otto Rosenberg erzählt unbeschwerte Szenen aus seiner Kindheit in der Zeit vor der nationalsozialistischen Gesellschaftszersetzung. Er schildert in schlichten Worten, wie sich die braune Wolke erst nach und nach in das Alltagsleben der deutschen Sinti und Roma schob. 1936 wurde der neunjährige Otto Rosenberg als Mensch »artfremden Blutes« mit seiner Familie ins »Zigeunerlager« Marzahn zwangsumgesiedelt, dort von NS- »Rassenforschern« untersucht und 1943 nach Auschwitz deportiert., wo ein Großteil seiner Familie ermordet wurde. Rosenberg selbst kam dann nach Buchenwald, Dora und Bergen- Belsen – und überlebte. Vom Weiterleben in Deutschland berichtet Rosenberg erschütternd, einprägsam und lakonisch.“
Yair Auron: Der Schmerz des Wissens. Die Holocaust- und Genozid-Problematik im Unterricht aus der Edition AV geht an Liselotte J. in Bargteheide
 „Die Verletzung der Menschenrechte und Gleichgültigkeit angesichts des Leids anderer gefährdet die menschliche Gesellschaft. Der Holocaust ist der extremste Fall einer solchen Verletzung und zweifelsohne das äußerste moralische Versagen, das die Menschheit sich hat zu Schulden kommen lassen. Eine Auseinandersetzung sowohl mit dem Holocaust im Besonderen als auch mit Genozid im Allgemeinen dürfte wohl zum Verständnis der Wichtigkeit humanistischer und demokratischer Werte überhaupt beitragen. Sie könnte auch das Rüstzeug liefern, das wir dazu brauchen, moralisch zu urteilen. Deshalb sind Holocaust- und Genozidstudien zu einem festen Bestandteil der Lehrpläne in Schulen in Amerika und anderen Ländern geworden. Dieses Buch fragt danach, wie die moralischen Lehren, die sich aus derartigen historischen Vorkommnissen ergeben, in Schulen am besten vermittelt werden können.“
„Die Verletzung der Menschenrechte und Gleichgültigkeit angesichts des Leids anderer gefährdet die menschliche Gesellschaft. Der Holocaust ist der extremste Fall einer solchen Verletzung und zweifelsohne das äußerste moralische Versagen, das die Menschheit sich hat zu Schulden kommen lassen. Eine Auseinandersetzung sowohl mit dem Holocaust im Besonderen als auch mit Genozid im Allgemeinen dürfte wohl zum Verständnis der Wichtigkeit humanistischer und demokratischer Werte überhaupt beitragen. Sie könnte auch das Rüstzeug liefern, das wir dazu brauchen, moralisch zu urteilen. Deshalb sind Holocaust- und Genozidstudien zu einem festen Bestandteil der Lehrpläne in Schulen in Amerika und anderen Ländern geworden. Dieses Buch fragt danach, wie die moralischen Lehren, die sich aus derartigen historischen Vorkommnissen ergeben, in Schulen am besten vermittelt werden können.“
Via Edition AV
Ilka von Zeppelin: Dieses Gefühl, daß etwas nicht stimmte. Eine Kindheit zwischen 1940 und 1948 aus dem Wagenbach Verlag geht an Monika V. in Wien
 „Erlebnisse der Jahre 1940 bis 1948: der Krieg in Berlin und der scheinbare Friede in einem kleinen fränkischen Dorf, gesehen mit den Augen eines Kindes. Vieles kann das Mädchen nicht verstehen, aber es fühlt, dass etwas nicht stimmt.
„Erlebnisse der Jahre 1940 bis 1948: der Krieg in Berlin und der scheinbare Friede in einem kleinen fränkischen Dorf, gesehen mit den Augen eines Kindes. Vieles kann das Mädchen nicht verstehen, aber es fühlt, dass etwas nicht stimmt.
Ilka von Zeppelin beschreibt aus dem Blickwinkel des zu Beginn vier- und am Ende zwölfjährigen Kindes die widersprüchlichen Erfahrungen der Nazizeit. Diese Perspektive ist es vor allem, die diese Erinnerungen von anderen unterscheidet und ihnen eine unmittelbare, unvermittelte erzählerische Kraft gibt.“
Via Wagenbach Verlag
5 Bändchen (Heinrich Heine, Magnus Hirschfeld, Alfred Dreyfus,Selma Stern und Die Privatsynagoge „Beth Zion“) aus der Reihe „Jüdische Miniaturen“ aus dem Verlag Hentrich & Hentrich, gehen an Elvira E.-H. in Nürnberg.
 „Es handelt sich erklärtermaßen um Miniaturen, essayistisch und feuilletonistisch im Stil, angereichert durch jeweils zahreiche Abbildungen, Momentaufnahmen aus dem großen Fundus der deutsch-jüdischen Beziehungsgeschichte. Nicht unerwähnt bleiben sollte ein eher banaler, gleichwohl praktischer Hinweis – die Miniaturen lassen sich allesamt in einem Zug herunterlesen.
„Es handelt sich erklärtermaßen um Miniaturen, essayistisch und feuilletonistisch im Stil, angereichert durch jeweils zahreiche Abbildungen, Momentaufnahmen aus dem großen Fundus der deutsch-jüdischen Beziehungsgeschichte. Nicht unerwähnt bleiben sollte ein eher banaler, gleichwohl praktischer Hinweis – die Miniaturen lassen sich allesamt in einem Zug herunterlesen.
Zu empfehlen ist diese griffige Reihe zu einem günstigen Preis besonders einem jüngeren Lesepublikum. Und Lehrern mag die Kektüre in Zeiten wenig ausgeprägter Leseneugier als Unterrichtsmaterial ans Herz gelegt sein.“
Via Jüdische Allgemeine.