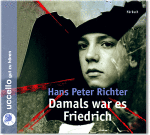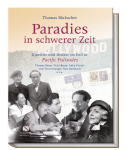Für das 11. literarische Rätsel des „Duftenden Doppelpunktes“ haben wir eine österreichische Schriftstellerin mit jüdischen Wurzeln gewählt. Sie gehört, soweit uns bekannt, nicht zu jenen AutorInnen, deren Werke auf den Scheiterhaufen landeten.
Ihre Bücher waren niemals Bestseller. Nach ihrem Tod geriet sie fast gänzlich in Vergessenheit. Unabhängig von Verkaufszahlen und Trends im Literaturbetrieb ist sie eine bedeutende Autorin des Exils. Ihre Werke stellen auch heute noch für all jene, die bereit sind sich darauf einzulassen, eine Quelle der Reflexion und ein Stück wunderbarer Literatur dar.
Wir hoffen mit unserem Quiz auch diesmal Ihr Interesse wecken zu können und freuen uns über Ihre Anregungen in Zusammenhang mit den zwölf noch vorzustellenden AutorInnen. Wie Sie anhand der aktuellen Runde sehen, muss es sich dabei trotz des Titels „80 Jahre Bücherverbrennung“ nicht zwangsläufig um SchriftstellerInnen handeln, deren Bücher verbrannt wurden.
Die Quizfragen:
- Unter welchem Pseudonym veröffentlichte die Autorin ihre literarischen Arbeiten?
- Wie lautet in dem Roman „Die Geschichte des reichen Jünglings“ der Vor- und Familienname eben jenes titelgebenden jungen Mannes?
- Wessen literarisches Porträt zeichnet die Autorin in der Person des Revolutionärs Iwanow?
Antworten bitte an: Literaturblog Duftender Doppelpunkt
Einsendeschluss: Dienstag, 02. Juli. 2013 um 12:00 Uhr.
Unter allen richtigen Einsendungen werden einige Bücher verlost.
Erinnerung: Wenn Sie an die jeweils aktuelle Quizrunde erinnert werden möchten, senden Sie bitte einfach ein leeres Mail mit dem Betreff „Literaturquiz Erinnerung“ an das Literaturblog Duftenden Doppelpunkt.
Alle bisherigen Fragen, Antworten und die das Quiz begleitenden Beiträge finden Sie auf der Seite „Literaturquiz zur Bücherverbrennung 1933.
***
Das literarische Rätsel
Sie wird 1882 in Wien in liberal-großbürgerliche Verhältnisse hineingeboren und erhält die Vornamen Alexandrine Martina Augusta.
Um eine Verwechslung mit ihrer Mutter, der Schriftstellerin Jenny Schnabl, von vornherein auszuschließen, wählt sie bereits als Schülerin ein Pseudonym, das sie ein Leben lang beibehält.
Erste Gedichte publiziert sie in Zeitschriften wie „Simplicissimus“ oder „Jugend“, später auch in „Der Brenner“, der vom österreichischen Schriftsteller und Verleger Ludwig Ficker herausgegebenen Kulturzeitschrift.
Aus einer jüdischen Familie kommend, konvertiert sie zum Katholizismus. Sie absolviert die Lehramtsprüfung und studiert Kunstgeschichte und Philosophie in Wien. 1910 bricht sie ihr Studium kurz vor der Promotion ab und heiratet den Chemiker Sigmund Weisl. Das junge Paar zieht nach Lódz, wo ihr Mann in einem Textilunternehmen arbeitet. Ein Jahr später wird ihr Sohn Hanno geboren.
1919 erscheint unter dem Titel „Bewegung“ ihr erster Gedichtband. In den 20er und 30er Jahren publiziert sie in einer Vielzahl renommierter Zeitungen und Zeitschriften Rezensionen, Feuilletons, Erzählungen, Novellen …
1930 stirbt ihr Mann und sie muss sich und ihren Sohn allein durchbringen. Obwohl sich ihre finanzielle Situation schwierig gestaltet, weigert sie sich ein Angebot, für die nationalsozialistische Presse zu arbeiten, anzunehmen.
Sie bewegt sich in fortschrittlich katholischen Kreisen und setzt sich mit dem Marxismus auseinander. Mit Persönlichkeiten wie Karl Kraus, Ludwig von Ficker, Franz Theodor Csokor und Georg Lukács ist sie freundschaftlich verbunden.
1934 erscheint „Das Asyl zum obdachlosen Geist“ als Fortsetzungsroman in der „Wiener Zeitung“. Als erster Roman in Buchform folgt 1936 „Rauch über St. Florian“. Die Autorin führt in dem Werk „… in einem fiktiven österreichischen Idealdorf Dutzende Figuren zusammen, um zu zeigen, daß auch das von der Heimatliteratur so bedenkenlos mythisierte Dorf eine, wie es schon der Untertitel nennt, ‚Welt der Mißverständnisse‘ bildet.“ Aus dem von Karl-Markus Gauß verfassten Vorwort zu „Die Geschichte des reichen Jünglings“, Sisyphus Verlag, 2005.
1939 gelingt ihr, sie ist zu diesem Zeitpunkt bereits weit über fünfzig, die Flucht nach Großbritannien. Ihr Sohn kann sich ebenfalls retten, er erhält ein Visum für Brasilien. Bis die beiden einander wieder in die Arme schließen können, werden zehn Jahre vergehen.
Im englischen Exil arbeitet sie als Lehrerin an verschiedenen Schulen und Mädcheninternaten. In dieser Zeit entsteht auch der Roman „Das Krähennest“. Er ist einer der großen österreichischen Exilromane. 1951 veröffentlicht, spielt er in der Zeit des 2. Weltkrieges und berichtet von Kollaboration, Widerstand, Verrat und über die Not und Einsamkeit im Exil.
In den folgenden Versen, die Teil des Gedichtes „Die Insel“ sind, fasst die gesuchte Autorin ihre Erfahrungen und Gefühle aus der Zeit des Exils zusammen.
„Gott hat mich in ein fremdes Land geführt –
Nein, hingesandt, versiegelt und verschnürt –
Ganz willenlos. Und alles ist hier fremd:
Die Kost, der Trunk, die Luft, das Wort, die Tracht –
Und was ich trag‘, geborgt, nichts mein als nur das Hemd
Am Leib – und noch das Heimweh, das ich mitgebracht.“
1947 kehrt sie nach Wien zurück und erhält fünf Jahre später den Großen Österreichischen Staatspreis für Literatur. Sie ist damit die erste von lediglich sieben Frauen, die in der 2. Republik mit dieser Auszeichnung geehrt wurde.
Am 25. Jänner 1957 stirbt sie und hinterlässt mit „Die Geschichte des reichen Jünglings“ ihr Opus Magnum. 15 Jahre hat sie an den fast 800 Seiten des Romans gefeilt. Neun weitere Jahre hat es gedauert, bis der bereits 1943 vollendete Roman einen Verleger gefunden hat.
Sein Inhalt ist von umfangreichen philosophischen und gesellschaftspolitischen Debatten geprägt. Diese begleiten den Sohn eines polnischen Industriebarons auf seinem Weg der Irrungen, hin zu einem tätigen Christentum, das in einem radikal individualistischen Humanismus mündet. Bis es soweit ist, sucht der „reiche Jüngling“ die Bewältigung seiner Probleme bzw. einen neuen Anfang in nächtlicher Lasterhaftigkeit, später durch wissenschaftliche Arbeit, bis er Iwanow, einem sozialistischen Agitator mit großer Ausstrahlungskraft, folgt.
„Unter einer Zugpende, deren grüner Papierschirm eine schwache Lampe beschattete, saß an einem Tisch mit schmutziger roter Wolldecke, worauf kreisrund wie ein nasser Fleck das Licht lag, der Genosse Iwanow. Bei meinem Eintritt schrieb er, ich hatte zuerst, über das Blatt gebeugt, seinen Kopf mit dünnem rötlichem Haar – seine schmalen Schultern in einer verschossenen Touristenjoppe, seine schmalen, blaugeäderten Hände vor mir, dann sah er auf. Ich blickte in ein mageres Gesicht mit tief eingeschnittenen Kerben, aber, obgleich Iwanow an die vierzig sein mußte, jung; in porzellanblaue, kühl und scharf blickende Augen, auf einen schmalen, unsinnlichen Mund. (…) Iwanow stand auf, er war größer, als er‘s sitzend erraten hatte lassen, aber nicht groß, sein schlechtsitzender, mißfarbener Sportanzug schien ihm zu weit geworden, seine Beine in grünen Wickelgamaschen waren außerordentlich mager, die Hand, die er mir reichte, fühlte sich kalt und trocken an, unkörperlich.“
Aus: „Die Geschichte des reichen Jünglings“, Sisyphus Verlag, 2005, Seite 326.
Es ist übrigens der Philosoph und Literaturhistoriker György Lukács, der sich nach der Niederschlagung der ungarischen Räterepublik einige Zeit in Wien aufhält und der durch die Figur des Iwanow in den Roman eingebunden wird. Die Frage, ob sich Lukács in dem Roman wiedererkannt hat, muss leider unbeantwortet bleiben.
Karl-Markus Gauß schreibt im Vorwort des 2005 im Sisyphus-Verlag neu aufgelegten Romans über die Autorin: „(…) sagt entschieden der Hoffnung ab, die Welt wäre auf politischem Wege und mit politischem Mitteln zum besseren zu verändern; stattdessen setzt sie auf die Läuterung des einzelnen – insbesondere des Mächtigen – und auf eine von Mitgefühl für alle Kreaturen durchtränkte Entsagungsphilosophie. Darin werden ihr die meisten heutigen Leser nicht folgen wollen, das ist aber auch nicht notwendig, um die Ernsthaftigkeit zu erkennen, mit der sie Verhältnisse kritisiert, die den Menschen schinden und das Ebenbild Gottes schänden, und um ihre schriftstellerische Leistung anzuerkennen.“
Bis auf „Die Geschichte des reichen Jünglings“ ist momentan keines ihrer Werke über den Buchhandel erhältlich. In manchen Bibliotheken und via Antiquariat bzw. das Zentrale Verzeichnis Antiquarischer Bücher sind zum Glück auch heute noch viele ihrer Werke verfügbar.
 „In der Kleinstadt findet sich Loni zwischen Probe, Auftritt und ihrem turbulenten Privatleben wieder: Die Rolle muss gelernt, das Zimmer bezahlt und der Hunger gestillt werden. Dazu hat sie sich ausgerechnet in den hitzigen Regisseur verliebt, dessen Verflossene die umschwärmte Diva des Provinztheaters ist. Die EinwohnerInnen von Mährisch- Niedau, allen voran Notar Dr. Liebig, im Nebenberuf Theater kritiker des Mährischen Anzeigers, bilden das kritische Publikum, dem sich die bunte Truppe stellen muss. ‚Zum Theater!‘ erschien zum ersten Mal 1935. Zuvor war das Werk als Vorabdruck im ‚Wiener Tag‘ erfolgreich und wurde in der zeitgenössischen Kritik als ‚ebenso klug wie anmutig‘ gefeiert.“ Via Aviva Verlag
„In der Kleinstadt findet sich Loni zwischen Probe, Auftritt und ihrem turbulenten Privatleben wieder: Die Rolle muss gelernt, das Zimmer bezahlt und der Hunger gestillt werden. Dazu hat sie sich ausgerechnet in den hitzigen Regisseur verliebt, dessen Verflossene die umschwärmte Diva des Provinztheaters ist. Die EinwohnerInnen von Mährisch- Niedau, allen voran Notar Dr. Liebig, im Nebenberuf Theater kritiker des Mährischen Anzeigers, bilden das kritische Publikum, dem sich die bunte Truppe stellen muss. ‚Zum Theater!‘ erschien zum ersten Mal 1935. Zuvor war das Werk als Vorabdruck im ‚Wiener Tag‘ erfolgreich und wurde in der zeitgenössischen Kritik als ‚ebenso klug wie anmutig‘ gefeiert.“ Via Aviva Verlag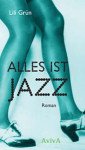 „Gemeinsam mit einem bunten Trüppchen gleichgesinnter, mittelloser junger Künstler und Künstlerinnen hat Elli das Kabarett gegründet – aus der Not, aber mit viel Idealismus und noch mehr Hoffnung auf den großen Sprung. Aber werden sie auch wirklich alle in das kleine Café am Kurfürstendamm kommen – die einflussreichen Leute von der Presse, die allmächtigen Theaterregisseure und die eingebildeten Filmfatzkes, kurz: ‚das Publikum von Berlin‘?“ Via Aviva Verlag
„Gemeinsam mit einem bunten Trüppchen gleichgesinnter, mittelloser junger Künstler und Künstlerinnen hat Elli das Kabarett gegründet – aus der Not, aber mit viel Idealismus und noch mehr Hoffnung auf den großen Sprung. Aber werden sie auch wirklich alle in das kleine Café am Kurfürstendamm kommen – die einflussreichen Leute von der Presse, die allmächtigen Theaterregisseure und die eingebildeten Filmfatzkes, kurz: ‚das Publikum von Berlin‘?“ Via Aviva Verlag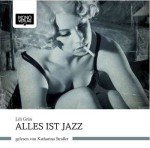 „Berlin 1930: Wirtschaftskrise und Armut beuteln die Metropole an der Spree. Die junge Schauspielerin Elli zieht es dennoch von Wien nach Berlin. Zusammen mit Gleichgesinnten gründet sie das Kabarett ‘Jazz’ – immer in der Hoffnung auf den großen Erfolg. Doch Geldsorgen und Armut machen das Leben schwer. Aber da ist ja noch Ellis neue Liebe, der Jura-Student Robert.
„Berlin 1930: Wirtschaftskrise und Armut beuteln die Metropole an der Spree. Die junge Schauspielerin Elli zieht es dennoch von Wien nach Berlin. Zusammen mit Gleichgesinnten gründet sie das Kabarett ‘Jazz’ – immer in der Hoffnung auf den großen Erfolg. Doch Geldsorgen und Armut machen das Leben schwer. Aber da ist ja noch Ellis neue Liebe, der Jura-Student Robert.