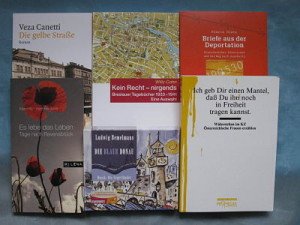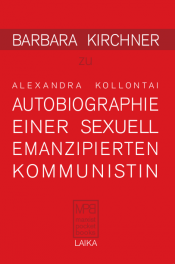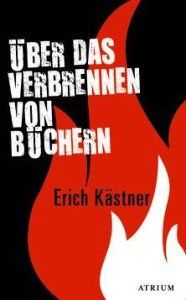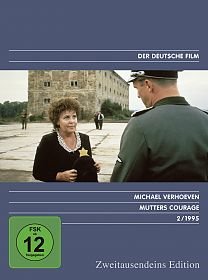Irmgard Keun
Dienstag, 4. Juni 2013Literaturquiz anlässlich 80 Jahre Bücherverbrennung
Die Antworten auf das 9. literarische Rätsel
In dieser Quizrunde wurde nach Irmgard Keun gesucht.
Neben dem Namen der Schriftstellerin und dem Titel ihres Debutromanes wollten wir wissen, wie die Protagonistin im zweiten Roman der gesuchten Autorin heißt.
- Irmgard Keun
- „Gilgi – eine von uns“
- Doris
Erinnerung:
Wenn Sie an die jeweils aktuelle Quizrunde erinnert werden möchten, senden Sie bitte einfach ein leeres Mail mit dem Betreff „Literaturquiz Erinnerung“ an das Literaturblog Duftender Doppelpunkt.
Falls die Informationen, die wir für Sie über Irmgard Keun im literarischen Rätsel vom „Duftenden Doppelpunkt“ zusammengetragen haben, nicht ausreichen, sind Sie eingeladen, in folgenden Sites zu blättern:
FemBio – Irmgard Keun
Linksammlung der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
Alle bisherigen Fragen, Antworten und die das Quiz begleitenden Beiträge finden Sie auf der Seite „Literaturquiz zur Bücherverbrennung 1933″.
Die nächsten Quizfragen stellen wir am Mittwoch, dem 05. Juni 2013. Zu deren Beantwortung haben Sie bis Dienstag, dem 18. Juni 2013 um 12:00 Uhr Zeit.
Die Preise und ihre GewinnerInnen
Brigitta Eisenreich: Celans Kreidestern aus dem Suhrkamp Verlag geht an Jutta D.
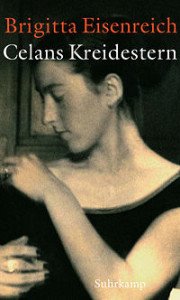 „Als Paul Celan Brigitta Eisenreich kennenlernt, hat sie ihre österreichische Heimat und ihre katholische Umgebung verlassen und lebt als Au-pair-Mädchen und Studentin in Paris. Sie ist 25, Celan 33 Jahre alt. Die zehnjährige Beziehung beginnt kurz nachdem Celan Ende 1952 Gisèle de Lestrange geheiratet hat. Bei der Geliebten findet Celan, der im Alltag Französisch spricht, die Sprache seiner Mutter wieder. Sprach- und Liebesakt werden eins – in vieler Hinsicht ist Brigitta Celans deutsche Frau in Paris.
„Als Paul Celan Brigitta Eisenreich kennenlernt, hat sie ihre österreichische Heimat und ihre katholische Umgebung verlassen und lebt als Au-pair-Mädchen und Studentin in Paris. Sie ist 25, Celan 33 Jahre alt. Die zehnjährige Beziehung beginnt kurz nachdem Celan Ende 1952 Gisèle de Lestrange geheiratet hat. Bei der Geliebten findet Celan, der im Alltag Französisch spricht, die Sprache seiner Mutter wieder. Sprach- und Liebesakt werden eins – in vieler Hinsicht ist Brigitta Celans deutsche Frau in Paris.
Diese Liebesbeziehung ist eine der längsten und verborgensten Celans: fast keine Briefe, in den Büchern Widmungssternchen, ein Kreidestern auf der Schiefertafel an der Tür, wenn Celan Brigitta nicht antrifft. Man liest zusammen oder findet sich zu einem festlichen Mahl. Celan schenkt Brigitta Bücher, ein Buch etwa über Erotik in der jüdischen Mystik, er möchte sie zu einer „Herzens-Jüdin“ machen.“
Via Suhrkamp Verlag
Erich Fried: Die Freiheit den Mund aufzumachen aus dem Wagenbach Verlag geht an Susanne W.
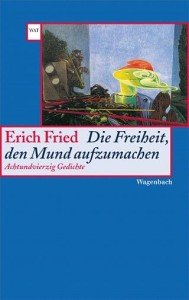 „Erich Fried, geboren 1921 in Wien, floh 1938 nach London, wo er bis zu seinem Tod 1988 lebte. Wegen seines Gedichtbands ‚und Vietnam und‘ (1966) noch heftig umstritten, wurde er später mit den Liebesgedichten (1979) zum meistgelesenen deutschsprachigen Lyriker seit Bertolt Brecht. Das Gesamtwerk Erich Frieds erscheint im Verlag Klaus Wagenbach.
„Erich Fried, geboren 1921 in Wien, floh 1938 nach London, wo er bis zu seinem Tod 1988 lebte. Wegen seines Gedichtbands ‚und Vietnam und‘ (1966) noch heftig umstritten, wurde er später mit den Liebesgedichten (1979) zum meistgelesenen deutschsprachigen Lyriker seit Bertolt Brecht. Das Gesamtwerk Erich Frieds erscheint im Verlag Klaus Wagenbach.
Erich Fried: Die Freiheit den Mund aufzumachen. Achtundvierzig Gedichte: Fragen nach den Bedingungen der Freiheit, nach den Reden und Taten derjenigen, die die Würde des Menschen zitieren und den Ermessensspielraum meinen.
Und Fragen an diejenigen, die immer schon alles gewusst haben.
‚Wir aber mögen uns stärken sogar an den Schwächen eines klugen, mutigen und integren Menschen, der unser Zeitgenosse ist.‘“ So Christa Wolf über Erich Fried.
Via Wagenbach Verlag
Oskar Panizza: Fränkische Erzählungen aus dem Kleebaum Verlag geht an Herbert H.
 „Oskar Panizza. Diesen Mann kennen heute nur noch ganz wenige, und auch seine Bücher sind größtenteils vergriffen, und er selbst lebt in Franken in einem Irrenhaus. Dahin brachte man im Jahre 1904 den Dr. Oskar Panizza, der wohl, als er noch bei Verstande war, der frechste und kühnste, der geistvollste und revolutionärste Prophet seines Landes gewesen ist. Einer, gegen den Heine eine matte Zitronenlimonade genannt werden kann und einer, der in seinem Kampf gegen Kirche und Staat, und vor allem gegen diese Kirche und gegen diesen Staat, bis zu Ende gegangen ist. (…) Für seine Komödie ‚Das Liebeskonzil‘ wanderte Oskar Panizza anderthalb Jahre wegen Gotteslästerung ins Gefängnis – und abgesehen davon, dass man den § 166 des deutschen Strafgesetzbuches, der da die Gotteslästerer verdammt, abschaffen sollte: dieses Urteil traf gewiß keinen Kleinen, denn er hatte die Faust zum Himmel hinauf geschüttelt und Gott wirklich gelästert –, weil der die Syphilis erfunden hatte. Es gibt keine Stelle in dem gesamten Schaffen Wedekinds, die an Kühnheit und Große an diese Szenen heranreicht.“ Kurt Tucholsky
„Oskar Panizza. Diesen Mann kennen heute nur noch ganz wenige, und auch seine Bücher sind größtenteils vergriffen, und er selbst lebt in Franken in einem Irrenhaus. Dahin brachte man im Jahre 1904 den Dr. Oskar Panizza, der wohl, als er noch bei Verstande war, der frechste und kühnste, der geistvollste und revolutionärste Prophet seines Landes gewesen ist. Einer, gegen den Heine eine matte Zitronenlimonade genannt werden kann und einer, der in seinem Kampf gegen Kirche und Staat, und vor allem gegen diese Kirche und gegen diesen Staat, bis zu Ende gegangen ist. (…) Für seine Komödie ‚Das Liebeskonzil‘ wanderte Oskar Panizza anderthalb Jahre wegen Gotteslästerung ins Gefängnis – und abgesehen davon, dass man den § 166 des deutschen Strafgesetzbuches, der da die Gotteslästerer verdammt, abschaffen sollte: dieses Urteil traf gewiß keinen Kleinen, denn er hatte die Faust zum Himmel hinauf geschüttelt und Gott wirklich gelästert –, weil der die Syphilis erfunden hatte. Es gibt keine Stelle in dem gesamten Schaffen Wedekinds, die an Kühnheit und Große an diese Szenen heranreicht.“ Kurt Tucholsky
Wolfgang Fritz: Die Geschichte von Hans und Hedi. Chronik zweier Hinrichtungen aus dem Milena Verlag geht an Waltraud P.
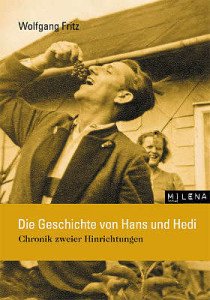 „Die Geschichte von Hans und Hedi dokumentiert die erschütternden Ausmaße der nationalsozialistischen Terrorjustiz am Beispiel des Lebens und Sterbens des Ehepaars Schneider.
„Die Geschichte von Hans und Hedi dokumentiert die erschütternden Ausmaße der nationalsozialistischen Terrorjustiz am Beispiel des Lebens und Sterbens des Ehepaars Schneider.
Der arbeitslose Malergehilfe Hans und die Hausgehilfin Hedi leben ein sehr einfaches Leben in der Erwerbslosensiedlung Leopoldau. Sie züchten Hasen, halten Hühner, pflegen ihre Obstbäume und das selbst gezogene Gemüse, um über die Runden zu kommen.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird Hans zur Zwangsarbeit in einer Munitionsfabrik im Harz verpflichtet und ein Jahr später aufgrund seiner schweren Vergiftungserscheinungen wieder nach Wien zurückgeschickt. Kaum angekommen, wird dem Ehepaar eine Bagatelle zum Verhängnis: Eine kaputte Abziehmaschine, die für widerständige KommunistInnen in ihrem Gartenhäuschen untergestellt war, kostet ihnen beiden das Leben.
Wolfgang Fritz gelingt es, die Lebensgeschichte des Ehepaars Schneider in den großen politischen und historischen Kontext einzuordnen und somit einen wichtigen und eindringlichen Beitrag in der Erinnerungsarbeit vorzulegen. Menschen, die sich abseits des politisch organisierten Widerstands gegen den Nationalsozialismus stellten, werden in der Erinnerungsarbeit oft ausgespart. Die mikrogeschichtliche Aufarbeitung des Schicksals Einzelner trägt dazu bei, die Grausamkeit dieses dunklen Kapitels der österreichischen Vergangenheit niemals zu vergessen.“
Via Milena Verlag
Jonny Moser: Nisko – Die ersten Judendeportationen aus der Edition Steinbauer geht an Cornelia R.
 Vor der „Endlösung der Judenfrage“ durch die Nazis gab es neben dem Druck auf Auswanderung kurzfristig auch eine Aktion, bei der man eine Ansiedlung ins soeben eroberte Gebiet rund um die ostpolnische Stadt Nisko in Angriff nahm.
Vor der „Endlösung der Judenfrage“ durch die Nazis gab es neben dem Druck auf Auswanderung kurzfristig auch eine Aktion, bei der man eine Ansiedlung ins soeben eroberte Gebiet rund um die ostpolnische Stadt Nisko in Angriff nahm.
Im Oktober 1939 führte Eichmann als Auftakt zur geplanten systematischen Deportation mithilfe der Zentralstelle für jüdische Auswanderung erste Transporte jüdischer Männer aus Wien, Mährisch-Ostrau und Kattowitz nach Nisko durch. Es sollte ein Judenreservat und das Auffanglager Zarzecze entstehen. Das Vorhaben scheiterte jedoch bald. Ein Teil der Männer wurde gleich nach der Ankunft verjagt und über die deutsch-sowjetische Demarkationslinie getrieben. Im sowjetischen Gebiet verhaftet und in Zwangsarbeitslager überführt, kamen die meisten von ihnen ums Leben. Die restlichen Männer wurden im Frühjahr 1940 nach Wien zurückgeschickt – und später ins KZ verschleppt.
Jonny Moser, Pionier der Holocaust-Forschung, legt nach langjährigen Recherchen eine erste umfassende Darstellung der Nisko-Aktion vor.