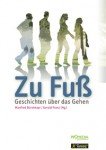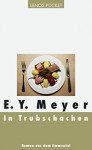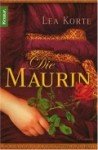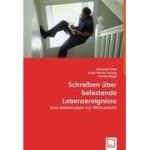Ohne Flugphase
Freitag, 23. Juli 2010Das von Manfred Bürstmayr und Gerald Franz herausgegebene Buch „Zu Fuß. Geschichten über das Gehen“, beschäftigt sich mit einer „Fortbewegungsart, bei der es im Gegensatz zum Laufen keine Flugphase gibt. Der Körper hat also in jeder Phase des Bewegungszyklus Kontakt zum Boden über Beine und Füße“.
Kaum läßt die „trockene“ Wikipedia-Definition ahnen, welch eine Vielfalt dieser (menschliche) Bodenkontakt über Bein und Fuß in sich birgt!
Ein paar Kostproben der Vielfalt.
Kommt der Zug ausnahmsweise pünktlich, der zum Zug eilende Pendler jedoch nicht, sind die Folgen ein „Daunenmeer“, auf dem eben dieser Mann „jeden Schritt neu probiert“. (Robert Kraner, „Loos geht“)
September 1945, fünf Kilometer zur Schule gehen, fünf Kilometer und „viele unvorhergesehene Zwischenstopps, denn es gab immer etwas Neues zu entdecken“. (Anneliese Wolf, „Ge[h]schichten aus meiner Kindheit“)
Ohne Ziel gehen, durch Wald und Stadt streifen, Wanderpoesie und Traumpfade, schrittweises Vorgehen als ideale Methode, „um an ein gesetztes Ziel zu gelangen (von gr. ‚meta‘, bei, neben hinter, und ‚hodos‘, Weg)“. (Auriel Schmidt, „Gehen als Selbsterfahrung“)
FußgeherInnen als blinde „Flecken im Hirn der Planer und die Gestaltung der Umwelt, die dem Auto eindeutig den Vorzug gibt“. (Hermann Knoflacher, „Planung für Fussgeher“)
Gehen als alltägliche Notwendigkeit, als sportliche Aktivität, als eine Form des Reisens, als Variable in einer wissenschaftlichen Studie über die Folgen von Arbeitslosigkeit, als ökologisch und sozial verträglichste Möglichkeit von A nach B zu gelangen, als Flucht vor Terror, als Inspiration zu Literarischem, als Leseform einer Stadt.
Eine zum Laufen, Wandern, Schlendern, Flanieren sehr anregende Mischung an Sprache und Inhalt facettenreicher Texte vielen Schwarz-Weiß-Fotos – herausgegeben als Buch, dessen Format und Gewicht erlauben, es auch auf Fußwegen bequem mitzunehmen.
Petra Öllinger
Manfred Bürstmayr & Gerald Franz (Hg.) – Zu Fuß. Geschichten über das Gehen. Promedia Verlag, Wien, 2010. 240 Seiten, € 14,90 (Ö).
Kategorie: Verkehrsmittel, allgemeine und einführende Schriften