Gehen, ging, gegangen – Jenny Erpenbeck konjugiert die Lage der Flüchtlinge
 Der Strom der Flüchtlinge reißt nicht ab, ebensowenig die Hilfsbereitschaft der vielen freiwilliger Helfer. Die Bilder, die uns die Nachrichtensendungen stündlich ins Haus liefern, bewegen und berühren. Das Thema, das derzeit Deutschlands Gemüter am meisten aufwühlt und beschäftigt, hat Jenny Erpenbeck in den Mittelpunkt ihres Romans Gehen, ging, gegangen gestellt. Manchmal kommt ein Buch zur richtigen Zeit, so scheint es.
Der Strom der Flüchtlinge reißt nicht ab, ebensowenig die Hilfsbereitschaft der vielen freiwilliger Helfer. Die Bilder, die uns die Nachrichtensendungen stündlich ins Haus liefern, bewegen und berühren. Das Thema, das derzeit Deutschlands Gemüter am meisten aufwühlt und beschäftigt, hat Jenny Erpenbeck in den Mittelpunkt ihres Romans Gehen, ging, gegangen gestellt. Manchmal kommt ein Buch zur richtigen Zeit, so scheint es.
Richard ist emeritierter Professor für Philologie, wohlsituierter Witwer mit ebenso wohlsituiertem Freundeskreis. Er ist, wie man so schön sagt, ein Mensch mit intaktem Lebensumfeld und mit ausreichend guten sozialen Kontakten. Und doch fühlt sich Richard unausgefüllt, mit zu viel freier Zeit gesegnet, in der er nur über sich, seine Lebensziele und seine Verluste sinniert. Obendrein hat ihn seine junge Geliebte betrogen und verlassen. Durch Zufall begegnet er den afrikanischen Flüchtlingen und Asylsuchenden, die auf dem Berliner Oranienplatz gestrandet sind, just in dem Moment, als das Camp, mit dem sie öffentlichkeitswirksam für Bleiberecht und Bewegungfreiheit demonstriert haben, abgerissen wird. Einige dieser Flüchtlinge werden in einem ehemaligen Altenheim einquartiert, das sich ganz in der Nähe von Richard schönem Haus am See befindet. Spontan beschließt er, diese dunkelhäutigen, fremden Männer zu besuchen und zu befragen. Vielleicht erfährt er von ihnen etwas über den Sinn seines Lebens. Denn auch Richard fühlt sich irgendwie in einem fremden Land gestrandet. Das Nachwendedeutschland ist ihm als ehemaligem Bürger der DDR immer noch unvertraut, immer noch zum Beispiel bewegt er sich im Westen Berlins wie auf unbekanntem Terrain.
Bereitwillig geben die Flüchtlinge Richard Auskunft, erzählen von Massakern, Verfolgung, ihren verschlungen Fluchtwegen, ihren Hoffnungen und Wünschen. Mehr und mehr identifiziert sich Richard mit den Männern, die er in seinen abendlichen Aufzeichnungen der Gespräche Tristan, der Blitzeschleuderer und Apoll nennt, weil er ihre richtigen Namen sich einfach nicht merken kann und durcheinanderbringt. Je länger Richard den Afrikanern zuhört, desto deutlicher stellt er fest, wie sehr ihr Leben von Vorschriften, Paragraphen, Papieren, Bescheinigungen und Akten bestimmt wird und wie illusorisch die Träume der Männer von Arbeit und von einem selbstbestimmten Leben sind. Das macht ihn wütend und ratlos (und den Leser).
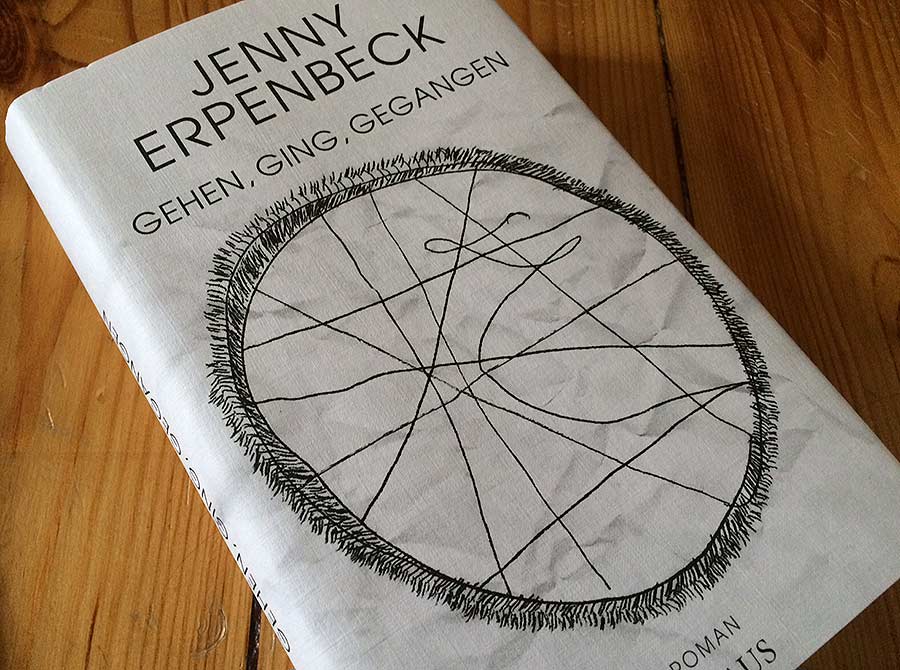
Jenny Erpenbeck nimmt in ihrem Roman ein aktuelles Thema auf, schmiedet ein sogenanntes heißes Eisen zu Fiktion, ohne sich dabei die Finger zu verbrennen. Sachlich, beiläufig und beinahe spröde ist ihr Erzählton, der sich bewußt jeder überzogenen (und anbiedernden) Emotionalität verweigert. Sie schürt kein Mitleid (vor allem kein falsches), sondern versucht Hintergründe aufzudecken, dem Leser die auswegslose Lebenssituation der Flüchtlinge ohne echte Zukunft zwischen Anerkennung, Duldung und Abschiebung deutlich zu machen, kurz, sie versucht zu erklären und aufzuklären. Das funktioniert wunderbar, aber nur bis zur Mitte des Buches, dann bricht das Konstrukt von Gehen, ging, gegangen merkwürdig still und leise in sich zusammen. So erhellend und komisch-absurd einzelne Szenen und Dialoge im Dschungel der formular-verkrusteten Bürokratie auch sein mögen, so sehr die sorgfältig recherchierten und zu Prosa verarbeiteten Tasachenberichte und Schicksalserzählungen der Flüchtlinge auch berühren, sie werden redundant.
Ab der Mitte krankt Gehen, ging, gegangen an zu wenig Abwechslung, die erwartete Zuspitzung bleibt ebenso aus, wie die tiefergehende Analyse des eigentlichen Problems hinter den vielen Einzelproblemen. »Gehen, ging, gegangen.« Im Raum. in dem die Flüchtlinge Deutschunterricht erhalten (der Senat finanziert dieses Fortbildungsangebot wie selbstverständlich für alle, auch für diejenigen, die ohne Aussicht auf Asyl sind), hängen Papptafeln mit unregelmäßigen Verben. Wie Verben an einer Wand konjugiert auch der Roman alle erdenklichen Tempi und Numeri seines Stammthemas durch, immer bemüht dem Leser Einsichten zu vermitteln ohne didaktisch einpauken zu wollen. Nah am Leben, aber auch immer beispielhaft und eingänglich muss das sein. Nicht selten sind deshalb Nebenfiguren unscharf gezeichnet und haben nur die Fumktion als Stichwortgeber die nächste Lektion einzuleiten, das nächste Problem in der Grammatik der Flüchtlingsexistenz aufzuzeigen, die nächste Verwaltungs- und Gesetzes-Absurdität in den Handlungsablauf zu hieven. Hinzu kommt, dass die Flüchtlinge beinahe wie mythische Figuren überhöht werden, ständig als Einzelne stellvertretend fürs Ganze stehen müssen und ihnen daher selten Brüche in der Identität zugebilligt werden. Auch Richard, der schrullige DDR-Retner, ist verurteilt, mehr und mehr als Funktions- und Bedeutungsträger denn als lebendiger Mensch durch die Handlung zu wandeln. (Obwohl: vieles, was er in beiläufigen Abschweifungen zu Alter, Vergänglichkeit, den Lauf der Zeit und den Sinn des Lebens äußert, gehört zu den wirklichen Perlen des Buches.) Die von Jenny Erpenbeck gewählte Konstruktion des Romans bedingt das, hier steckt das eigentliche Problem. Der Roman will zu viel und büßt dabei seine Vitalität ein.
Wohlgemerkt: Das ist alles richtig und gut. Das hebt niemals den moralischen Zeigefinger, das ist mit Fakten unterfüttert, erhellend und informativ. Der Roman briliert mit unendlich viel gutem Willen, aber es fehlt ihm an Schärfe, Kontur und Reibungsflächen. Im Versuch, einer guten Reportage und ihrem nüchtern-sachlichem Erzählstil möglichst nahezukommen, verschenkt der Text viele Chancen, die eine Fiktionalisierung dieses brisanten Themas herausfordernder, provokanter und streitbarer gemacht hätten. Unterm Strich bleibt Erpenbeck zu brav, zu blass und möchte es allen Recht machen. Gehen, ging, gegangen ist ein notwendiges und wichtiges Buch (und keinesfalls ein schlechtes); trotz seiner Schwächen empfehle ich es nachdrücklich, warne aber vor überzogenen Erwartungen.





11. September 2015 @ 22:46
Jetzt habe ich das Buch gelesen und glaube das Problem zu verstehen, denn es gilt ja leicht etwas als nicht literarisch, wenn zu realistisch ist und das hier Beschriebene ist auch noch brandtaktuell, wir befinden uns Mitten im Geschehen und da fehlt oder gibt es ja noch keine literarische Distanz.
Meiner Meinung nach ist Jenny Erpenbeck diesem Problem ganz bewußt entgegengetreten, in dem es am Anfang so scheinbar distanziert wirkt, dann wirds persönlicher und der Held bezieht ja eindeutig Stellung, spendet Geld, gibt Deutschunterricht, organisiert Demonstrationen, etwas was man auch im “Spiegel” finden könnte oder in Ö1 bei den “Geschichten vom Helfen” und dann kommen ganz bewußt eingesetzte literarische Szenen, wie die, wo der Afrikaner während er seine Geschichte erzählt, den Boden hektisch aufkehrt und Richard reflektiert das erst in seiner Wohnung oder die, wo sich alle aufputzen, um zum Deutschunterricht zu gehen oder die mit dem Anwalt mit Zylinder und Bratenrock, das ist dann eindeutig nicht mehr journalistisch realsozialistisch oder die vielen literarischen Anspielungen oder auch nur die ständigen Wiederholungen “gehen ging gegangen”.
Also mir hat es gefallen, ein bißchen war ich nur über die Weihnachtsszene irritiert, denn das ist jetzt schon die dritte, die ich lese, seit ich “Buchpreisblogge” und ich frage mich wieder etwas paranoid, ob das Zufall ist oder die Verlage, das von ihrem Autoren so verlangen, damit das Publikum zufrieden ist?
10. September 2015 @ 12:10
Lieber Jochen,
als ich im Frühjahr durch die Verlagsprospekte blätterte und diesen Titel gefunden habe, bin ich sehr neugierig auf das Buch gewesen, denn es gibt zum aktuellen Flüchtlings-Thema kaum oder gar keine deutsche Literatur. In Frankreich, in Italien finden sich ja schon eher Romane, vielleicht ist das “Problem” ja auch zeitversetzt zu uns gekommen.
Ich stimme Dir völlig zu, dass Erpenbecks Roman gut ist, dass er viele Einblicke in die unterschiedlichen Geschichten der Flüchtlinge gibt, immer wieder aufzeigt, dass sie nicht leben konnten in ihren Heimatländern, weil es keine Arbeit gab, keine Möglichkeit zu überleben, oder weil eine Regierung in den letzten Zukcungen einfach einmal alle Ausländer im Boot über das Mittelmeer schickt – als menschliche Bombe sozusagen. Das sind die Geschichten, die uns die vielen Flüchtlinge näher bringen, sie menschlicher werde lassen.
Aber: Du hast es so treffend als “Überhöhung” beschrieben: Diese Flüchtlinge sind alle sehr gute Charaktere. Außer einem, der abdriftet, verhalten sie sich alle vorbildlich, haben kaum Ecken und Kanten, kaum dunkle Stellen in ihrer Persönlichkeit. Es gibt auch in der engsten Enge keinen Streit, keinen Neid, kaum Ausbrüche, alle leben so friedlich und gemeinsam vor sich hin, dass es schon erstaunlich ist.
Ich habe den Eindruck, Erpenbeck will eher die bürokratische Unmenschlichkeit schildern, die Ausweglosigkeit, die der Paragrafendschungel diesen Menschen bereit hält (es ist ja wirklich teilweise wie im Panoptikum, und alle Regeln dienen nur der Abschottung und der Abschreckung). Mit scheinen die Gesetzte ein wesentlicher Protagonist zu sein, der böse Gegenspieler eben, hinter dem sich alle Menschen verstecken (das haben wir ja auch schon einmal erlebt). Dem stehen eben die recht angepassten Flüchtlinge gegenüber.
Viele Grüße, Claudia
9. September 2015 @ 13:55
Lieber Jochen,
ich finde es gut und wichtig, dass dieses Thema auch literarisch aufgenommen und verarbeitet wird, insbesondere von jungen deutschen Autoren. Wenn das dann eben literarisch nicht völlig gelungen ist, finde ich es erstmal halb so schlimm. Offensichtlich schien Dir ja zumindest in diesem Fall zumindest die erste Hälfte sehr gelungen. Bei Büchern mit weit über 352 Seiten zu aktuellen Themen ist es ja oft so (auch bei Sachbüchern ist das schon mal so), dass weniger mehr gewesen wäre.
Generell ist es in meinen Augen nicht völlig verwunderlich, dass Bücher, die solche Themen (wir kenne das vom 2.Weltkrieg, von der Verarbeitung der Nazizeit, vom Vietnamkrieg) aufgreifen, häufig mit grösserem zeitlichen Abstand geschrieben wurden – und dann auch mehr in der Lage sind, in die Tiefe zu gehen.
Auf jeden Fall würde das Buch auch prima zum Leseschwerpunkt II: Flucht und Entwurzelung https://dasgrauesofa.wordpress.com/2015/09/06/leseschwerpunkt-ii-flucht-und-entwurzelung/ von Claudia auf dem Grauen Sofa passen.
Danke für die profunde Besprechung und schöne Grüsse
Kai
9. September 2015 @ 15:40
Hallo Kai,
danke für Dein Feedback. Es ist, wie ich im letzten Absatz ja deutlich betont habe, ein richtiges und wichtiges Buch. Da es zum “Deutschen Buchpreis” nominiert ist, habe ich mir erlaubt, hohe literarische Kriterien anzulegen. Und da schwächelt Erpenbecks Text dann doch.
Aber, es ist lesenswert und lohnt.
lg_jochen
5. November 2018 @ 10:16
Hallo Kai,
danke für dein ideales Feedback.
Ich hoffe wir sehen uns bald.
Mit freundlichen Grüßen
Corinna
9. September 2015 @ 13:04
Habe gerade mit dem Lesen angefangen, bin gespannt, wie es mir mit diesem brandaktuellen Thema, das einem ja überall begegnet und nach “89/90” damit geht