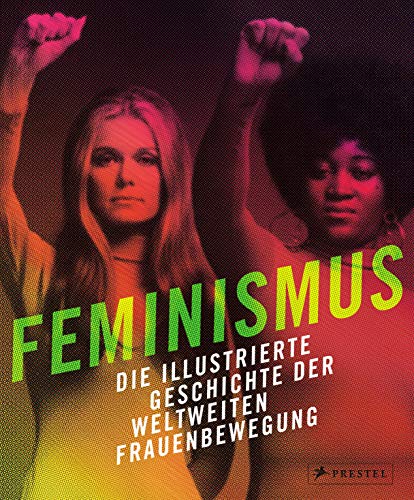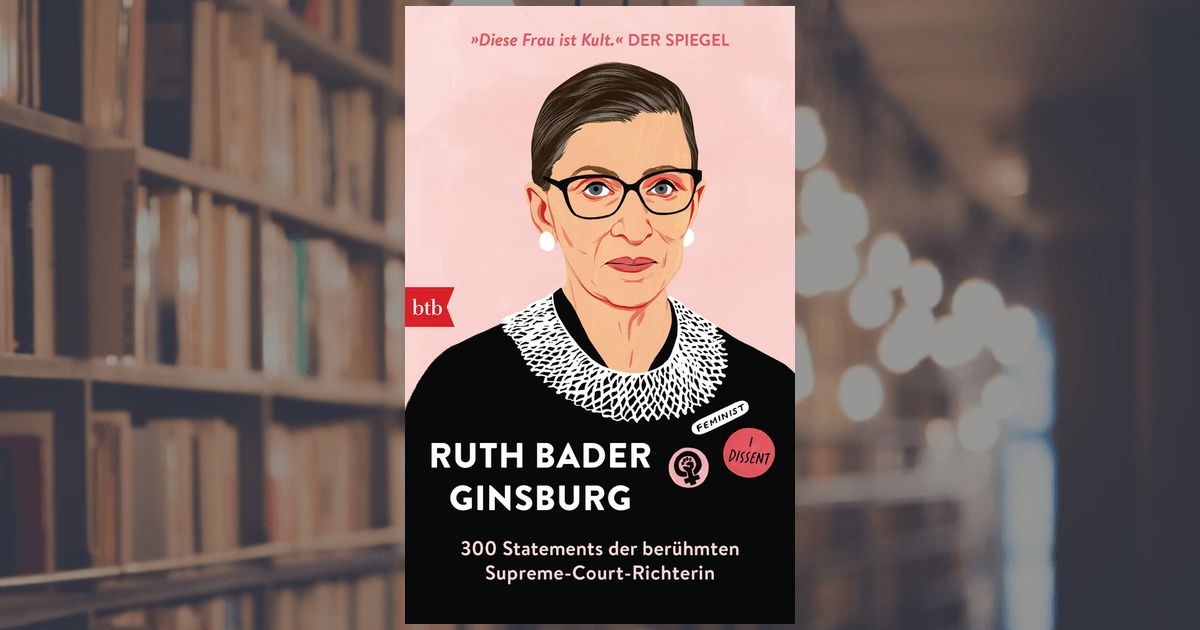Mit ihrem neusten Werk, das will ich direkt vorwegnehmen, ist Amélie Nothomb meiner Ansicht nach ein berührendes, intimes Portrait einer eigentlich überlebensgroßen, vollständig mythologisierten Figur geglückt. Jesus von Nazareth, der, ganz gleich ob er nun eine historische Person oder eine Metapher war (letzteres würde die Glaubwürdigkeit seiner Lehre nicht untergraben, ja, vielleicht sogar stärken), vielen als Erlöser gilt, als Inbegriff der Weisheit, des Glaubens und der Liebe, als menschgewordener Gott.
Genau so und doch ganz anders stellt ihn Nothomb dar, ja ich wage zu behaupten, in ihrem Buch „Die Passion“ ist Jesus menschlicher als in jeder anderen Darstellung (zumindest unter denen, die mir bekannt sind), ohne das die Autorin seine göttliche Abstammung und Mission negiert. Aber sie lässt die Passions- und darüber hinaus die Lebensgeschichte von Jesus in einem ganz neuen Licht erscheinen, ihn selbst zu Wort kommen, nicht nur als Sprachrohr Gottes.
Das Buch beginnt mit dem Prozess gegen Jesus, in dem all die Leute, an denen er Wunder gewirkt hat, Zeugnis gegen ihn ablegen:
„Der nun sehende Blinde klagte über die Hässlichkeit der Welt, der einst Aussätzige beschwerte sich, dass die Almosen ausblieben, der Fischereiverband vom See Genezareth warf mir vor, ich hätte ein paar Fischer bevorzugt behandelt, und Lazarus schilderte, wie grauenhaft es sich anfühlt, wenn einem der Leichengeruch an der Haut klebt.“
Nicht Dankbarkeit, sondern Misstrauen und Unverständnis schlagen ihm entgegen und er nimmt dies zwar hin, aber in seinem Innern, das er auf den folgenden 120 Seiten offenlegt, hadert er mit dieser Entwicklung, die er als unausweichlich ansieht, deren Wucht und Absurdität in ihm aber trotzdem Zweifel, Scham und Widerstände schüren.
„Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches ist mir fremd. Trotzdem begreife ich nicht, was in sie gefahren ist, dass sie mich derart mit Schmähungen überhäuften. Und dieses Unverständnis betrachte ich als Scheitern, ja als Verfehlung.“
Wir erleben im Folgenden einen Jesus Christus, der zwar in seiner Weisheit und seinem Plädoyer für Liebe und das einfache Leben sehr seinem Vorbild aus der Bibel gleicht, aber ungleich zerrissener ist, was seine Erfahrungen auf der Erde und sein Schicksal angeht. Er rekapituliert sein Wirken und erzählt von den Menschen, die seinen Weg begleitet haben, vom widerspenstigen Judas, seinem Ziehvater Joseph, seiner großen Liebe Maria Magdalena, seiner Mutter Maria – und seine Betrachtungen dieser Begegnungen sind voller Eingeständnisse.
„Meine Mutter ist auch ein viel besserer Mensch als ich. Das Böse ist ihr fremd, sie erkennt es nicht einmal, wenn sie darauf stößt. Ich beneide sie um dieses Unwissen. Mir ist das Böse nicht fremd. Um es bei anderen zu erkennen, muss ich es notwendig in mir tragen.“
Trotz dieser Entzauberung ist Nothombs „Passion“ ein zutiefst spirituelles, emphatisches Werk. Der große Unterschied zur biblischen Geschichte ist, dass Jesus keineswegs den Geist über den Körper stellt, sondern dem Körper (diesem Motiv, das Nothoms Werk wie kein zweites durchzieht) sogar besondere Bedeutung und Schönheit beimisst. So sieht er zum Beispiel die beste Entsprechung der Erfahrung von Gott nicht im Glauben oder der rein geistigen Liebe, sondern in körperlichen Empfindungen, allen voran im Durst.
„Es ist kein Zufall, dass ich mir diese Weltgegend ausgesucht habe: Politisch zerrissen war mir nicht genug, ich brauchte ein durstiges Land. Nichts ist der Empfindung, die ich erwecken will, ähnlicher als der Durst. […] Es gibt Menschen, die glauben, keine Mystiker zu sein. Sie irren sich. Wer einmal wahrhaft gedürstet hat, hat diesen Status schon erreicht. Wenn ein Dürstender den Wasserbecher an die Lippen setzt – dieser unbeschreibliche Moment ist Gott. […] Versucht, diese Erfahrung zu machen: Nachdem ihr ausdauernd gedürstet habt, trinkt ihr den Becher nicht auf einen Zug aus. Nehmt einen einzigen Schluck, den ihr für ein paar Sekunden im Mund behaltet. Ermesst das Entzücken. Dieses Wunder ist Gott.“
Und auch die Liebe, körperlich wie seelisch, bringt er mit dem Trinken zusammen:
„Liebe fängt immer damit an, dass man mit jemandem etwas trinkt. Vielleicht, weil keine andere Empfindung so wenig enttäuscht. […] Wer jener, die er bald lieben wird, zu trinken anbietet, verspricht, dass der Genuss nicht hinter der Erwartung zurückbleiben wird.“
Die Passion, das körperliche Leiden, bei dem wir ihn als Leser*innen am Ende des Buches begleiten, empfindet er zwar als seine Aufgabe, aber eine widersinnige. Er glaubt nicht das darin etwas Heilsames liegt und ertappt sich selbst über das ganze Buch immer wieder bei dem Wunsch, mit Maria Magdalena fortzugehen und ein normales, unscheinbares Leben fern seiner Bestimmung zu führen. Seinem Vater, Gott, wirft er vor, dass er seine eigene Kreation, die Menschen, nie wirklich verstanden hat, gar nicht verstehen könne, weil er keinen Körper habe. Und auch die Kreuzigung und ihre fatale Wirkung wirft er ihm vor.
„Denn was mein Vater mir auferlegt, zeugt von einer so tiefen Verachtung des Körpers, dass davon für immer etwas zurückbleiben wird.“
Man könnte die Figur, die Nothomb kreiert hat, als eine Art Verschmelzung des biblischen Jesus mit Epikur bezeichnen, mit einem Schuss mittelalterlicher Mystik. Sie ist in keinem Moment eine Parodie oder negative Verzerrung des biblischen Jesus, richtet aber seinen Fokus neu aus, verlagert seine Sicht, sodass er als Mensch unter Menschen etwas mehr von der menschlichen Seite der Geschichte versteht und nicht allein die göttliche Perspektive vertritt.
Er beschreibt die Menschheit als genau jene Mischung aus Abgründen und Tugenden, die sie ist. Menschen sind eigensinnig, misstrauisch, schwerfällig, auch dumm und kleinlich, aber eben auch selbstlos, spontan, können überraschen und sich überwinden.
„Eine merkwürdige Art, die mein Vater da erschaffen hat: auf der einen Seite Niedertracht mit Meinungen, auf der anderen Großherzigkeit, die nicht denkt.“
Gläubige werden/würden wohl dennoch Anstoß nehmen dieser Jesus-Figur, allein schon deshalb, weil er seinen Vater für fehlbar und in mancherlei Hinsicht für unwissend hält. Aber das Plädoyer, welches dieses Buch vorbringt, zeichnet dennoch ein wunderbar genaues Bild einer Menschheit, die immer hin und her gerissen ist zwischen spirituellen und körperlichen Bedürfnissen. Ein Bild auf dem sich sehr viel leichter ein Glaube aufbauen lässt als auf der unfehlbaren Gestalt der Bibel, denn es hat ein durch und durch menschliches Antlitz.