.
Die 20 Bücher, die ich möglichst vielen Menschen empfehlen kann:
meine Entdeckungen 2015.
Favoriten 2014 | Favoriten 2013 | Favoriten 2012 | Favoriten 2011
Lieblingscomics 2015 hier (Link), weitere Buchtipps hier (Link).
Und: Songs 2015 (Link)!
.
.
20: KOU YAGINUMA, „Twin Spica“, Manga-Reihe, 2001 bis 2009.
.
 [mehr] Asumis Mutter starb 2010 – als die Lion, das erste Space-Shuttle Japans, auf ihre Heimatstadt stürzte. Trotzdem will Asumi Astronautin werden; unterstützt von ihrem depressiven Vater – und dem Geist eines verglühten Lion-Astronauten.
[mehr] Asumis Mutter starb 2010 – als die Lion, das erste Space-Shuttle Japans, auf ihre Heimatstadt stürzte. Trotzdem will Asumi Astronautin werden; unterstützt von ihrem depressiven Vater – und dem Geist eines verglühten Lion-Astronauten.
„Twin Spica“ wirkt simpel und süßlich. Die kleine, kindliche Asumi sieht aus wie Heidi, jede Figur hat ein rührseliges Trauma, kurz dachte ich: für Zehnjährige, höchstens – oder Fans vom „kleinen Prinz“. Doch Leitmotive, Bildsprache, Psychologie und Stimmungen werden so geschickt verwebt… mit jedem Band (ich kenne sechs von 16) wird diese zarte Coming-of-Age-Geschichte trauriger, ernster, klüger, subtiler.
Mut zum Melodrama: das Kitschig-Schönste, das ich seit Jahren las. Hach!
.
19: CHRISTOPH SCHMITZ, „Das Wiesenhaus“, deutscher Roman, 2012
.
 Ein einfacher, recht passiver Kleinstadt-Junge im Rheinland der 60er, 70er… und die Lebenslügen, Rituale, Versäumnisse und rührenden Gesten von Großvater, Mutter und einem entfernteren Hallodri-Verwandten – erzählt in ruhiger, simpel-aber-kunstvoller Sprache und mit genauem Blick auf Alltäglichkeiten, kleine Abgründe.
Ein einfacher, recht passiver Kleinstadt-Junge im Rheinland der 60er, 70er… und die Lebenslügen, Rituale, Versäumnisse und rührenden Gesten von Großvater, Mutter und einem entfernteren Hallodri-Verwandten – erzählt in ruhiger, simpel-aber-kunstvoller Sprache und mit genauem Blick auf Alltäglichkeiten, kleine Abgründe.
Andreas Maier schreibt autobiografische Romane über die Wetterau bei Frankfurt – doch richtig gepackt hat er mich bisher nicht. Schmitz‘ kurzer Roman ist sanfter, weniger verbissen: ein gediegenes, kluges, konventionelles Stück Provinz- und Zeitgeschichte. Schenkt das dem Onkel, Vater, Freund, der in den 50ern geboren wurde und „eigentlich keine Romane liest“.
Einfach, aber authentisch, sympathisch, entspannt: ein Suhrkamp-Underdog/-Geheimtipp.
.
18: WARREN ELLIS, „Injection“, Sci-Fi-Graphic-Novel, bisher ein Band, USA 2015 (britischer Autor).
.
 [mehr] Ein ambitioniertes Sci-Fi- und Mystery-Comic für Fans von „Akte X“, von dem bisher erst 5 kurze Hefte erschienen. Wie immer bei Warren Ellis wird viel geschossen und gestorben, geflucht, gesoffen und geblutet. Noch mehr aber geht es ums Altern und Beten, Wandern und Meditieren, Hoffen und Resignieren: Fünf Wissenschaftler*innen haben die Welt verändert, mit einer geheimen „Injektion“. Jetzt, Jahre später, zahlt die Welt den Preis – und ein Dana-Scully-Lookalike über 50 humpelt und flucht durch eine mystische Regierungsverschwörung.
[mehr] Ein ambitioniertes Sci-Fi- und Mystery-Comic für Fans von „Akte X“, von dem bisher erst 5 kurze Hefte erschienen. Wie immer bei Warren Ellis wird viel geschossen und gestorben, geflucht, gesoffen und geblutet. Noch mehr aber geht es ums Altern und Beten, Wandern und Meditieren, Hoffen und Resignieren: Fünf Wissenschaftler*innen haben die Welt verändert, mit einer geheimen „Injektion“. Jetzt, Jahre später, zahlt die Welt den Preis – und ein Dana-Scully-Lookalike über 50 humpelt und flucht durch eine mystische Regierungsverschwörung.
Tolle Figuren, verquaste Esoterik: Bisher überzeugen mich Stil, Atmosphäre, Psychologie. Könnte aber schlimmer Märchen- und Pagan-Kitsch sein.
[Eine weitere aktuelle Reihe von Ellis, die ich mochte: „Trees“ – über einen missglückten ersten Kontakt mit Aliens und die geopolitischen und identitären Krisen, die Staaten und Menschen erschüttern, sobald klar ist: Wir sind nicht die Krone der Schöpfung.]
.
.
17: TONY KUSHNER, „Angels in America, Pt. 1: Millennium Approaches“, US-Theaterstück, 1992.
.
 2005 lief die HBO-Verfilmung dieses schwulen New Yorker Theater-Klassiker über die AIDS-Krise und mehrere Mormonen und jüdische Männer in Glaubens- und Beziehungskrisen im ARD-Programm: Ich sah Al Pacino als feisten Politiker, Sarah Jessica Parker als schwülstigen Engel (…es war Emma Thompson: Ich bin gesichtsblind), mir schien das unbeholfen, prätenziös, konservativ, möchtegern-crazy – nicht frecher oder mutiger als „Will & Grace“.
2005 lief die HBO-Verfilmung dieses schwulen New Yorker Theater-Klassiker über die AIDS-Krise und mehrere Mormonen und jüdische Männer in Glaubens- und Beziehungskrisen im ARD-Programm: Ich sah Al Pacino als feisten Politiker, Sarah Jessica Parker als schwülstigen Engel (…es war Emma Thompson: Ich bin gesichtsblind), mir schien das unbeholfen, prätenziös, konservativ, möchtegern-crazy – nicht frecher oder mutiger als „Will & Grace“.
Im Sommer 2015 las ich endlich den ersten Teil, „Millennium Approaches“ – und war begeistert: keine große Literatur… doch so wendungs- und bezugsreich, clever, wütend und mit Pointen, Jahrzehnte ihrer Zeit voraus – mich hat das überraschend oft zum Lachen gebracht, begeistert. Leider braucht man beide Teile; und Band 2, „Perestroika“, wiederholt nur alle Tricks und Kniffe: Was auf 150 Seiten Spaß machte, wird auf 300 Seiten dünn, bemüht, banal.
5 Sterne für Teil 1 – doch dramaturgisch klappt hier nichts: kein kluger Bogen. Sondern Ideen, Schwung, Figuren, die sich tot laufen.
.
16: JILLIAN TAMAKI, MARIKO TAMAKI, „This one Summer“, Young-Adult-Graphic-Novel, Kanada 2014.
.
 Rund um Toronto liegen Hunderte kleiner Seen; und über den Sommer ziehen reichere Familien oft wochenlang in ihre simplen Ferienhäuser. Ich mochte „Skim“ (2008), eine sperrige, oft unbeholfene, unbequeme Graphic Novel der Tamaki-Schwestern über ein Schulmädchen, das ihren Körper hasst – und bin überrascht, wie viel heller, softer, zugänglicher (und trotzdem: gelungener und reifer) diese neuen 300 Seiten über ähnliche Teenager sind (Deutsch: „Ein Sommer am See“, Reprodukt):
Rund um Toronto liegen Hunderte kleiner Seen; und über den Sommer ziehen reichere Familien oft wochenlang in ihre simplen Ferienhäuser. Ich mochte „Skim“ (2008), eine sperrige, oft unbeholfene, unbequeme Graphic Novel der Tamaki-Schwestern über ein Schulmädchen, das ihren Körper hasst – und bin überrascht, wie viel heller, softer, zugänglicher (und trotzdem: gelungener und reifer) diese neuen 300 Seiten über ähnliche Teenager sind (Deutsch: „Ein Sommer am See“, Reprodukt):
Zwei Freundinnen und Feriendorf-Nachbarinnen – eine Siebt- und eine Achtklässlerin – leihen sich Horrorfilme, belauschen die älteren Kiffer und müssen neu austarieren, wofür sie noch zu jung sind – und wofür langsam zu alt. Detailverliebte, aber still-uneitle Zeichnungen. Schöne Charakter-Momente. Kaum Plot. Zu lapidar, um mich besonders zu rühren oder zu erschüttern – aber ein toller Zwischenschritt zweier Erzählerinnen, die besser und besser werden.
Wenn ich jetzt einen „Dirty Dancing“-Vergleich mache, weckt es falsche Erwartungen: ein ruhiges, kluges, kanadisch-unspektakuläres I’m-not-a-girl-not-yet-a-woman-Sommerbuch.
.
15: ED BRUBAKER, „The Fade Out“, Noir-/Krimi-Graphic-Novel, 2 von 3 Bänden sind erschienen, USA ab 2014.
.
 [mehr] Charlie Parish ist Drehbuchautor – heimlich: Er macht den Job, für den sein Alkoholiker-Kumpel Gil bezahlt wird. Bei einer Party stirbt Hauptdarstellerin Valeria Summers. Charlie verliebt sich in Maya Silver – den jungen Star, der sie ersetzen soll. Während viele Szenen neu gedreht, das Drehbuch ständig ausgebessert wird, versucht er, sich an die Mordnacht zu erinnern.
[mehr] Charlie Parish ist Drehbuchautor – heimlich: Er macht den Job, für den sein Alkoholiker-Kumpel Gil bezahlt wird. Bei einer Party stirbt Hauptdarstellerin Valeria Summers. Charlie verliebt sich in Maya Silver – den jungen Star, der sie ersetzen soll. Während viele Szenen neu gedreht, das Drehbuch ständig ausgebessert wird, versucht er, sich an die Mordnacht zu erinnern.
Ich liebe Ed Brubaker seit „Gotham Central“. Seit 15 Jahren erzählt er immer wieder gefeierte historische Noir-Dramen um Detektive und Killer. „Fatale“ brach ich schnell ab: Was als Krimi begann, wurde zu schnell von trashigen Lovecraft-Tentakeln erwürgt. „The Fade Out“ bleibt den klassischen Farben, Motiven, Tricks des Krimi-Genres treu: Hollywood 1948. Kaputte Stars, Auf-, Absteiger. Bittere Geheimnisse. Verrat und Sünde. Ein glänzend recherchierter, toll gezeichneter Comic zweier Profis.
Nicht bahnbrechend, ambitioniert – aber stimmig, fesselnd, smart, detailverliebt… und wunderbar traurig.
.
.
14: YUKI KODAMA, „Sakamichi no Apollon“, Manga-Reihe, 2008 bis 2012.
.
 [mehr] Im August las ich die ersten Seiten von über 150 Mangas – und merkte: Oft brauchen sie viel länger, um Stimmung und Ton zu treffen. Die Eröffnung bleibt meist unbeholfen. Überfrachtet.
[mehr] Im August las ich die ersten Seiten von über 150 Mangas – und merkte: Oft brauchen sie viel länger, um Stimmung und Ton zu treffen. Die Eröffnung bleibt meist unbeholfen. Überfrachtet.
Bei „Kids on the Slope“ (englischer Titel der Anime-Adaption) war ich nicht sicher, ob ich in einer schwulen Romanze stecke, einer Pennäler-Komödie im Retro-Look oder mitten im Kampf zweier ungleicher Schüler – ein verzärtelter Nerd, ein bettelarmer Raufbold – um das selbe Mädchen. Alle (männlichen) Figuren spielen in einer Jazzband. Doch Jazz-Exkurse bleiben nebensächlich.
Nein. „Sakamichi no Apollon“ (nur als Fan-Übersetzung online lesbar) ist die Geschichte einer (lebenslangen?) Freundschaft. Die späten 60er Jahre in der japanischen Provinz. Enge Rollenbilder. Armut. Der Mut, von etwas zu träumen. Zu jemandem zu stehen – behutsam inszeniert im simplen Retro-Zeichenstil.
Ein langsames, zärtliches, schlichtes Coming-of-Age – oft witzig und zum Heulen schön. Ohne große Abgründe, Effekte, Pomp.
.
13: JASON FRY: Band 3 und 4 von „Star Wars: Rebels – Servants of the Empire“, Young-Adult-Sci-Fi-Romane, USA 2015.
.
 Im Oktober, sechs Wochen vor der Premiere von „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ [Text von mir], las ich für Deutschlandradio Kultur durch neue „Star Wars“-Comics und -Romane. Mich überraschte die Qualität zweier kurzer Middle-Grade-Novels (Kurzromane für 11- bis 14jährige) zur Kinder-Serie „Star Wars: Rebels“. „Servants of the Empire“ erzählt von Zare, Kadett einer Nachwuchs-Akademie des Imperiums, dessen Heimatplanet langsam zum Überwachungsstaat wird. Als zweite Hauptfigur versucht seine Freundin, eine Schülerin und Hackerin („Slicerin“), durch Deals mit Schmugglern und Gangstern ihre digitalen Fußabdrücke zu verwischen.
Im Oktober, sechs Wochen vor der Premiere von „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ [Text von mir], las ich für Deutschlandradio Kultur durch neue „Star Wars“-Comics und -Romane. Mich überraschte die Qualität zweier kurzer Middle-Grade-Novels (Kurzromane für 11- bis 14jährige) zur Kinder-Serie „Star Wars: Rebels“. „Servants of the Empire“ erzählt von Zare, Kadett einer Nachwuchs-Akademie des Imperiums, dessen Heimatplanet langsam zum Überwachungsstaat wird. Als zweite Hauptfigur versucht seine Freundin, eine Schülerin und Hackerin („Slicerin“), durch Deals mit Schmugglern und Gangstern ihre digitalen Fußabdrücke zu verwischen.
Ich liebe Cory Doctorows Datenschutz-Jugend-Thriller „Little Brother“ (2008, leider ist die Fortsetzung „Homeland“ geschwätzig und fad)… und bin überrascht, dass der zweitklügste, -schmissigste, -komplexeste Roman über Whistleblower, digitalen Widerstand und Bügerrechte ausgerechnet ein „Star Wars“-Jugendbuch ist. Band 1 und 2 habe ich übersprungen – und für Leser über 16 sind die Figuren und Aciton-Szenen teils zu holzschnittartig. Trotzdem: Seit „Harry Potter“ hatte ich nicht mehr so viel klugen Jugendbuch-Action-Spaß.
Warmherzig, mitreißend, politisch: ein unerwartet subversives Kleinod.
.
12: JAMES BALDWIN, „100 Jahre Freiheit ohne Gleichberechtigung“, Essay, USA 1963.
.
 2015 schrieb Ta-Nehisi Coates ein elegisches Essay übers Schwarzsein in den USA, „Between the World and me“. Starke Thesen – aber stilistisch so schwülstig, polemisch und religiös-predigthaft-überdreht… ich warte auf die deutsche Übersetzung. Das Original liest sich wie Sirup-voller-Rasierklingen.
2015 schrieb Ta-Nehisi Coates ein elegisches Essay übers Schwarzsein in den USA, „Between the World and me“. Starke Thesen – aber stilistisch so schwülstig, polemisch und religiös-predigthaft-überdreht… ich warte auf die deutsche Übersetzung. Das Original liest sich wie Sirup-voller-Rasierklingen.
Eine schöne Überraschung: Wie zeitlos, packend, relevant dagegen James Baldwins biografisches, politisches Essay über missglückte Anpassung und schwarze Unterdrückung bleibt – auch noch nach 52 Jahren. Ich las eine deutsche Ausgabe (Achtung: das N-Wort wird durchgängig benutzt), und würde das kurze Buch am liebsten zur Schullektüre machen. Black Lives Matter, Identity Politics, die großen Debatten des Jahres 2015… Baldwin nimmt große Fragen vorweg, und gibt kluge Antworten.
[Ich mochte auch Harper Lees „Geh hin, stelle einen Wächter“: literarisch oft unbeholfen, viele Längen und schlechtes Timing – doch in Zeiten von PEGIDA und Donald Trump extrem relevant.]
Rhetorischer Volltreffer: zwei Stunden Lesen – mit angehaltenem Atem. Wichtige Debatte, wichtige Impulse und Thesen. Großer Gewinn!
.
.
11: HANS MAGNUS ENZENSBERGER (Hg.), „Europa in Trümmern“ (Taschenbuch-Titel: „Europa in Ruinen“), Augenzeugenberichte 1944-1948. Reportage-Reader, Deutschland 1990.
.
 Für die Andere Bibliothek sammelte Hans Magnus Enzensberger Reportagen über das Leben in den Städten Europas in der Endphase des zweiten Weltkriegs bis 1948. Literaten, Reporter, Diplomaten berichten (meist aus Ländern, in denen sie nur Besucher sind) über Zerstörung, Wiederaufbau, Unmenschlichkeit und nationale Wunden und Neurosen.
Für die Andere Bibliothek sammelte Hans Magnus Enzensberger Reportagen über das Leben in den Städten Europas in der Endphase des zweiten Weltkriegs bis 1948. Literaten, Reporter, Diplomaten berichten (meist aus Ländern, in denen sie nur Besucher sind) über Zerstörung, Wiederaufbau, Unmenschlichkeit und nationale Wunden und Neurosen.
Eine langsame, packende, abwechslungsreiche Textcollage mit Stig Dagerman, Alfred Döblin, Janet Flanner, Max Frisch, Martha Gellhorn, John Gunther, Norman Lewis, A.J. Liebling, Robert Thompson Pell und Edmund Wilson. [Gellhorn, Dagerman und Janet Flanner sind am besten/eindringlichsten.]
Ausführlicher journalistischer Reader – tolle Auswahl, viel gelernt. Aber: ein paar Beiträge sind eitel, effekthascherisch.
.
11b: NICHOLSON BAKER, „Human Smoke. The Beginnings of World War II, the End of Civilization“, Textcollage (20er Jahre bis 1941), USA 2008.
.
 „Europa in Trümmern“ ist literarischer: längere Texte, mehr Raum, um Atmosphären, Stimmung festzuhalten. Doch „Human Smoke“ riss mich mit: flüssig, kühn und oft überraschend sammelt Baker Textschnipsel, diplomatische und kulturgeschichtliche Anekdoten, Zitate über die politischen, weltanschaulichen und demagogischen Weichen, die in Deutschland, England, den USA, Japan, Italien, Frankreich etc. zwischen den 20er Jahren und 1941 gestellt wurden: ein Mosaik aus Tagebuch- und Presseschnipseln über den Verfall der Zivilsation, totalen Krieg und Holocaust, Waffenhandel, Brandbomen und nationalen Hass. Ich habe unglaublich viel gelernt – und hätte das 500-Seiten-Buch noch genossen, wäre es dreimal so lang.
„Europa in Trümmern“ ist literarischer: längere Texte, mehr Raum, um Atmosphären, Stimmung festzuhalten. Doch „Human Smoke“ riss mich mit: flüssig, kühn und oft überraschend sammelt Baker Textschnipsel, diplomatische und kulturgeschichtliche Anekdoten, Zitate über die politischen, weltanschaulichen und demagogischen Weichen, die in Deutschland, England, den USA, Japan, Italien, Frankreich etc. zwischen den 20er Jahren und 1941 gestellt wurden: ein Mosaik aus Tagebuch- und Presseschnipseln über den Verfall der Zivilsation, totalen Krieg und Holocaust, Waffenhandel, Brandbomen und nationalen Hass. Ich habe unglaublich viel gelernt – und hätte das 500-Seiten-Buch noch genossen, wäre es dreimal so lang.
Walter Kempowskis WW2-Textcollage „Das Echolot“ steht noch ungelesen im Regal: Ich glaube, mir geht es dort zu viel um hilflose kleine Leute und ihre schlichten, kaum politischen Kartoffel-, Tornister- und Bombenkeller-Sorgen. Ich liebe die postmodernen Collageromane von David Markson – doch die Schnipsel sind meist zu kurz, und man braucht zu viele Bildungsbürger-Vorkenntnisse, um Marksons schnelle, oft arrogante Pointen zu verstehen. Bakers Riesen-Textcollage ist die bisher beste Lösung, Mentalitätsgeschichte in Schnipseln zu erzählen: ein Kulturtagebuch der Entmenschlichung. Bittere, faszinierende, oft zynische Häppchen Zeitgeschichte, ideal pointiert, ideal gehaltvoll.
Fefes Blog… im zweiten Weltkrieg? SO viele Zusammenhänge und Konflikte, die ich zum ersten Mal verstehe. Großer Gewinn, großes, trauriges Lese-Vergnügen.
.
10: MASUJI IBUSE, „Schwarzer Regen“, dokumentarischer Roman, Japan 1965.
.
 Solide deutsche Übersetzung: Ibuse interviewte Überlebende des Atombombenabwurfs auf Hiroshima 1945 für einen sehr langen, gemächlichen Dokumentarroman über höfliche, anständige, kontrollierte Kleinbürger – vor denen sich die Hölle auftut. Ein hartes, aber ruhiges Buch voller Alltagskultur, Contenance, Stolz und Angst, ohne große Effekthascherei:
Solide deutsche Übersetzung: Ibuse interviewte Überlebende des Atombombenabwurfs auf Hiroshima 1945 für einen sehr langen, gemächlichen Dokumentarroman über höfliche, anständige, kontrollierte Kleinbürger – vor denen sich die Hölle auftut. Ein hartes, aber ruhiges Buch voller Alltagskultur, Contenance, Stolz und Angst, ohne große Effekthascherei:
Die Manga-Reihe „Barfuß durch Hiroshima“ begann solide, wurde aber ab Band 3 und 4 immer rührseliger, kalkulierter, dumm-didaktisch-seichter. Deshalb bin ich froh, noch einmal aus anderer Perspektive über die zwei Wochen nach dem Abwurf (und, in der Rahmenhandlung: die frühen 50er Jahre) zu lesen – literarisch kunstvoll, faktensatt, humanistisch, intelligent.
Eine literarische Reportage zeigt, was nur eine Reportage zeigen kann: kluger, empathischer Bericht über Alltag und Vernichtung.
.
.
09: FRANK WITZEL, „Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969“, deutscher Roman, 2015.
.
 [längerer Text hier] Wie gesagt: Ich kenne nur zwei, drei Menschen, denen ich empfehlen kann, alle 817 Seiten zu lesen. Wie bei David Foster Wallaces „Unendlicher Spaß“ wächst hier kein Spannungsbogen – sondern ein Thema, ein paar Leitmotive werden umkreist, in immer neuen Schlaufen. Das könnte 200 Seiten dauern – oder 2000. Egal. Die Einzelteile (bei Witzel: 98 Kapitel in wechselnden Tonlagen, Perspektiven) ergeben kein geschlossenes Bild.
[längerer Text hier] Wie gesagt: Ich kenne nur zwei, drei Menschen, denen ich empfehlen kann, alle 817 Seiten zu lesen. Wie bei David Foster Wallaces „Unendlicher Spaß“ wächst hier kein Spannungsbogen – sondern ein Thema, ein paar Leitmotive werden umkreist, in immer neuen Schlaufen. Das könnte 200 Seiten dauern – oder 2000. Egal. Die Einzelteile (bei Witzel: 98 Kapitel in wechselnden Tonlagen, Perspektiven) ergeben kein geschlossenes Bild.
Wer sich daran nicht stört, findet hier verspielte, beißend kluge, immer wieder überraschende Splitter, Tonlagen, Verdrängtes und Nie-Vergessenes zur BRD der späten 60er: Ein entspannter, selbstbewusster Zeit- und Generationenroman, der seitenweise Sprach-, Gedanken-, Unterdrückungs-Müll, TV-, Religions- und Pop-Rhetorik zu köstlich-hässlichen, bitteren kleinen Angstpralinen quetscht.
Toll, dass ein so sperriger Roman den deutschen Buchpreis gewinnt: ein ambitioniertes, überbordendes Archiv.
.
08: GERTRAUD KLEMM, „Muttergehäuse“, österreichische Memoir/literarisch-biografische Textcollage, erscheint am 1. Februar 2016.
.
 Ich habe „Herzmilch“ und „Aberland“, zwei sehr gut besprochene Romane Gertraud Klemms über unzufriedene Frauen/Mütter, angelesen… und mir ein drittes Buch von ihr (erscheint im Februar 2016) im Blog vorgemerkt (Link). Kremayr & Scherlau schickte mir ungefragt ein Leseexemplar. Vielleicht das Beste, was mir die Post 2015 zustellte:
Ich habe „Herzmilch“ und „Aberland“, zwei sehr gut besprochene Romane Gertraud Klemms über unzufriedene Frauen/Mütter, angelesen… und mir ein drittes Buch von ihr (erscheint im Februar 2016) im Blog vorgemerkt (Link). Kremayr & Scherlau schickte mir ungefragt ein Leseexemplar. Vielleicht das Beste, was mir die Post 2015 zustellte:
In „Mütter auf Papier“ (2010) schrieb Klemm über den boshaften, herablassenden, sexistischen, gehässigen Quatsch, den sich eine Frau mit Mutterwunsch anhören muss, die immer wieder Kinder in der Schwangerschaft verliert. Eine autobiografische Textcollage: Kurzprosa, Fragmente, viel Wut, Intimität, kluger Furor. „Muttergehäuse“ ist die überarbeitete Version dieses „Mütter auf Papier“-Berichts – ein kurzes, luzid formuliertes, wunderbar konkretes Buch über Frustrationen, schlechte Freunde, Angst, Druck… und Auswege.
Ich bin jetzt Klemm-Fan: feministisch, literarisch, spitz, ehrlich, reflektiert.
.
08b: ANN HOOD, „Comfort. A Journey through Grief“, Memoir, USA 2008.
.
 Schlechter (weil sprachlich konventioneller, erwartbarer, weniger politisch) als Gertraud Klemm – aber genauso ehrlich, persönlich, mitreißend: 2002 stirbt Ann Hoods fünfjährige Tochter Grace. In fast einem Dutzend Essays für Zeitschriften und Anthologien zeichnet sie eine Landkarte ihres Verlusts und aller Konsequenzen für ihre Ehe, ihren Sohn, ihr Selbstbild, ihren Lebenshunger und -willen. Das beste Buch über US-Mutterschaft, das ich kenne – doch an vielen Stellen sehr amerikanisch: eine Frau der Oberschicht – mit Kindermädchen, Kirchengemeinde, Karriere als Romanautorin, Haus mit 13 Zimmern… Privilegien.
Schlechter (weil sprachlich konventioneller, erwartbarer, weniger politisch) als Gertraud Klemm – aber genauso ehrlich, persönlich, mitreißend: 2002 stirbt Ann Hoods fünfjährige Tochter Grace. In fast einem Dutzend Essays für Zeitschriften und Anthologien zeichnet sie eine Landkarte ihres Verlusts und aller Konsequenzen für ihre Ehe, ihren Sohn, ihr Selbstbild, ihren Lebenshunger und -willen. Das beste Buch über US-Mutterschaft, das ich kenne – doch an vielen Stellen sehr amerikanisch: eine Frau der Oberschicht – mit Kindermädchen, Kirchengemeinde, Karriere als Romanautorin, Haus mit 13 Zimmern… Privilegien.
Punktuell wiederholen und überschneiden sich die einzelnen Essays. Schlechter als „Das Jahr magischen Denkens“, besser als „Blue Nights“, „Bad Mother“, „An Exact Replica of a Figment of my Imagination“. Gern und mit Gewinn gelesen – doch nur als Bonus hier auf der Liste, weil es so gut zu Gertraud Klemm passt. Im Zweifel: Klemm!
Abschied nehmen von einem Kind: Ein etwas eitles, angeberisches Buch – das trotzdem Seite für Seite neu erschüttert… und begeistert.
.
.
07: SLAVENKA DRAKULIC, „Als gäbe es mich nicht“, kroatischer Roman, 1999.
.
 Kitschiger Anfang, kitschiges Ende. Dazwischen: luzid, erschütternd, mitreißend – und psychologisch brillant: Eine junge bosnische Lehrerin zieht 1992 von der Stadt aufs Land, aus Angst vor Pogromen. Als der Bürgerkrieg ihr Dorf erreicht, braucht es nur wenige Tage, bis eine Gruppe entführter muslimischer Bauersfrauen jeder Sorte männlicher Gewalt ausgeliefert ist.
Kitschiger Anfang, kitschiges Ende. Dazwischen: luzid, erschütternd, mitreißend – und psychologisch brillant: Eine junge bosnische Lehrerin zieht 1992 von der Stadt aufs Land, aus Angst vor Pogromen. Als der Bürgerkrieg ihr Dorf erreicht, braucht es nur wenige Tage, bis eine Gruppe entführter muslimischer Bauersfrauen jeder Sorte männlicher Gewalt ausgeliefert ist.
Mich überzeugt die geradlinige Handlung – und eine Ich-Erzählerin, die sich noch in der Zivilisation glaubt, während schon jede Grenze, Hemmschwelle, Kontrollinstanz verschwunden ist. Die Rahmenhandlung (über eine kitschige Geburt und ein Asylverfahren) hat größere literarische Schwächen – aber wie sich Frauen/Geflüchtete abschotten, Traumata verstecken, sexuelle Gewalt verarbeiten… wird hier auf einem psychologischen Niveau beschrieben, das mich begeistert und beglückt.
Ein kluges, hartes Buch, überzeugend recherchiert – in Deutschland leider vergriffen.
.
06: CHRISTOPH KUCKLICK, „Die granulare Gesellschaft“, deutsches Sachbuch, 2014.
.
 Das Buchcover suggeriert: Alles zerstäubt. Verweht. Ein alarmistisches, FAZ-iges Angstmänner-Sachbuch über digitale Beschleunigung und Verfall? Nein.
Das Buchcover suggeriert: Alles zerstäubt. Verweht. Ein alarmistisches, FAZ-iges Angstmänner-Sachbuch über digitale Beschleunigung und Verfall? Nein.
„Granular“ meint hier: Technik macht Unterschiede sichtbar. Vermisst Welt, Bürger, Kunden so feinkörnig, dass die alten, groben Raster und Kategorien in Politik, Statistik, Recht nicht mehr gut greifen: Schubladendenken, Standard-Abfertigung, One Sitze Fits All.
Alles wird feiner… überwacht. Beziffert. Personalisiert. Maschinen stellen sich neu auf Menschen ein – und Menschen auf Maschinen. Zwei Sorten Intelligenz. Überraschende Wechselwirkungen, ethische Fragen, Konflikte. GEO-Chefredakteur Kucklick hopst recht simpel, kunstlos, hastig-aber-anschaulich durch alle größeren „Wie wirken Bürger, Staat und Programme auf- und gegeneinander?“-Baustellen der Gegenwart. Ein anekdotisches, an vielen Stellen flapsig-unentschiedenes Buch, das große Themen anreißt und verständlich macht… aber nicht immer klug zu Ende denkt. Trotzdem: 5 von 5 Sternen – ich wünschte, JEDER würde das lesen.
„Granular“ ist der nützlichste, beste neue Begriff für mich seit… demisexuell. Ich wünschte, Technik- und Fortschrittsdebatten würden auch im Feuilleton auf (mindestens) DIESEM Niveau geführt.
.
05: ANNA WIMSCHNEIDER, „Herbstmilch. Lebenserinnerungen einer Bäuerin“, deutsche Memoir, 1989.
.
 Eine Briefmarke kaufen? Einen Teller abspülen? Hunde ausführen? Blumen gießen? Sobald ich Energie mit kleinen Handgriffen verliere, die meine Schreib- und Lesezeit einschränken, werde ich wütend: Das Leben auf einem Bauernhof wäre für mich Folter.
Eine Briefmarke kaufen? Einen Teller abspülen? Hunde ausführen? Blumen gießen? Sobald ich Energie mit kleinen Handgriffen verliere, die meine Schreib- und Lesezeit einschränken, werde ich wütend: Das Leben auf einem Bauernhof wäre für mich Folter.
Für Anna Wimschneider auch: Statt zu lernen, zu sprechen, sich zu bilden und zu wachsen, statt JEMALS ihren Kopf einsetzen zu dürfen, muss die Halbwaisin, geboren 1919, zuerst ihre Geschwister wickeln, füttern, bedienen – und später die gebrechlichen Verwandten ihres Soldaten-Ehemannes. Eine triste, geistlose, verrohte, furchtbar stupide Hof-Welt, von Wimschneider nüchtern-aber-effektvoll beschrieben – in ihrer ganzen Armseligkeit, Langeweile, Gehässigkeit, Tristesse. Move over, Thomas Bernhard: SO überzeugt mich Anti-Heimatliteratur!
Nicht-sehr-kluge Gedanken und Anekdoten über gar-nicht-kluge Konflikte, Einschränkungen, Klassismus: 150 dumpfe, aber eindringliche Seiten Bauern-Horror.
.
.
04: DANIEL KEYES, „Flowers for Algernon“, Science-Fiction-Roman, USA 1966.
.
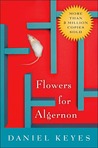 Ich hatte eine seichte, lapidare „Wie gewonnen, so zerronnen“-Science-Fiction-Parabel erwartet… und freue mich, mit wie viel literarischer, psychologischer und philosophischer Sorgfalt dieser US-Klassiker stattdessen arbeitet: Ein Bäckereigehilfe mit sehr geringem IQ wird durch eine experimentelle Enzym-Therapie zum Hochbegabten. In Tagebuch-Protokollen beschreibt er, wie sich seine Welt weitet… und das Verhältnis zu seinen „Rettern“ und Beobachtern immer problematischer wird.
Ich hatte eine seichte, lapidare „Wie gewonnen, so zerronnen“-Science-Fiction-Parabel erwartet… und freue mich, mit wie viel literarischer, psychologischer und philosophischer Sorgfalt dieser US-Klassiker stattdessen arbeitet: Ein Bäckereigehilfe mit sehr geringem IQ wird durch eine experimentelle Enzym-Therapie zum Hochbegabten. In Tagebuch-Protokollen beschreibt er, wie sich seine Welt weitet… und das Verhältnis zu seinen „Rettern“ und Beobachtern immer problematischer wird.
Toll geschrieben, toll gedacht – und stets auf Augenhöhe mit dem Leser: Bei vielen Sci-Fi-Texten habe ich Einwände, Fragen, Probleme, auf die der Text nicht eingehen kann oder will. Daniel Keyes hat WIRKLICH gründlich über die Konsequenzen, moralischen Fragen, Fallstricke seines Szenarios nachgedacht. An keiner Stelle musste ich meine Erwartungen zügeln, ein Auge zudrücken.
Fast 50 Jahre alt – doch bis heute plausibel, zeitgemäß, unterhaltend, relevant.
.
03: JENNY ERPENBECK, „Gehen, ging, gegangen“, deutscher Roman, 2015.
.
 Kein aktuelles Buch passt besser zu 2015 – und keinem wünsche ich mehr Leserinnen und Leser: Jenny Erpenbeck erzählt recht kunstlos, didaktisch, trocken und reportagehaft von einem Professor in Rente, der spontan beschließt, sich über Geflüchtete zu informieren. Er führt Gespräche, knüpft vorsichtig erste Kontakte, begreift nur langsam das paradoxe, oft menschenunwürdige Asyl-System Deutschlands.
Kein aktuelles Buch passt besser zu 2015 – und keinem wünsche ich mehr Leserinnen und Leser: Jenny Erpenbeck erzählt recht kunstlos, didaktisch, trocken und reportagehaft von einem Professor in Rente, der spontan beschließt, sich über Geflüchtete zu informieren. Er führt Gespräche, knüpft vorsichtig erste Kontakte, begreift nur langsam das paradoxe, oft menschenunwürdige Asyl-System Deutschlands.
Als Roman hat „Gehen, ging, gegangen“ große Schwächen: eine blasse Hauptfigur, kaum literarischer Gestaltungswille, seitenweise Fakten- und Reportage-Bla, recht kunstlos und dozierend. Doch diese Asyl-Fakten sind SO interessant, gut aufgearbeitet, leicht verständlich… dass ich das Buch am liebsten stapelweise verschenken würde.
Lest das! Und schenkt es euren Angst- und Wutbürger-Freunden und -Verwandten: 300 Seiten, die mir mehr brachten als drei Wochen Tageszeitungs-Lesen.
.
02: JOSEF HASLINGER, „Phi Phi Island – ein Bericht“, deutscher Roman, 2015.
.
 2004 flog Haslinger, Leiter des deutschen Literaturinstituts in Leipzig, mit seiner Frau und seinen 18jährigen Kindern nach Thailand. Am Morgen nach der Ankunft wird Phi Phi Island von einem Tsunami getroffen – und Haslinger erinnert die großen und kleinen Ängste, Verluste und Konsequenzen der nächsten Tage und Stunden.
2004 flog Haslinger, Leiter des deutschen Literaturinstituts in Leipzig, mit seiner Frau und seinen 18jährigen Kindern nach Thailand. Am Morgen nach der Ankunft wird Phi Phi Island von einem Tsunami getroffen – und Haslinger erinnert die großen und kleinen Ängste, Verluste und Konsequenzen der nächsten Tage und Stunden.
„Er schreibt ständig über Leichen und verzweifelte Einheimische – aber ohne Mitleid oder besonderes Interesse“, klagte Freund M.. Das stimmt: Haslinger bleibt ein reicher, oft verständnisloser westlicher Tourist, der sich im Lauf der Katastrophe an seine Rolle als Ehemann und Vater klammert. „Kalt“? Oder ehrlich? Ich las hier eine mutige, konsequente, gestochen scharfe Selbst-Beobachtung. Ein Protokoll ohne Eitelkeiten, in dem jeder Satz sitzt.
Unvergessliches Buch – geradlinig und ohne Survival-Kitsch. Aber es stimmt: Thailand bleibt eine Kulisse, die Thailänder Fremde, die Haslinger nicht versteht.
.
.
01: KENGO HANAZAWA, „I am a Hero“, Manga-Reihe, seit 2009.
.
 [mehr] Die ersten 200 Seiten sind hart: Ein misogyner, phlegmatischer, recht dumpfer Manga-Assistent steckt im Alltag fest – und redet unsympathischen Stuss. Die nächsten 200 Seiten, Band 2, sind wirr: Passanten beißen sich gegenseitig, Zombies überrennen Tokio, alles bricht zusammen. Noch in Band 3 war mir nicht klar, ob ich einen Zombie-Thriller lese, über eine Zombie-Komödie und -Parodie lachen soll oder nur die Fehler einer verpeilten, passiven, selbstmitleidigen Hauptfigur zählen: eine Art „Girls“ oder „Louie“, ein Woody-Allen-Film… mit Zombies?
[mehr] Die ersten 200 Seiten sind hart: Ein misogyner, phlegmatischer, recht dumpfer Manga-Assistent steckt im Alltag fest – und redet unsympathischen Stuss. Die nächsten 200 Seiten, Band 2, sind wirr: Passanten beißen sich gegenseitig, Zombies überrennen Tokio, alles bricht zusammen. Noch in Band 3 war mir nicht klar, ob ich einen Zombie-Thriller lese, über eine Zombie-Komödie und -Parodie lachen soll oder nur die Fehler einer verpeilten, passiven, selbstmitleidigen Hauptfigur zählen: eine Art „Girls“ oder „Louie“, ein Woody-Allen-Film… mit Zombies?
„I am a Hero“ ist langsam. Oft hässlich, unsympathisch, grotesk. Alle Figuren sind überfordert und distanziert. Nichts gelingt. Man schwimmt bis zu 800 Seiten am Stück mit neurotischen, fremden Menschen in stillen, bedrohlichen, verwirrenden Szenen – in denen jederzeit alles eskalieren kann.
Fotorealistisch gezeichnet. An vielen Stellen zum Schreien spannend. Ein toller Blick auf Alltagskultur, Moral, Ethos, Sexismus, Twenty- und Thirtysomething-Defekte, Versagensängste in Japan. Ein Freund las die ersten Bände und sagte: „Ich sehe da nichts als Trash.“
Ich sehe: eine unerträgliche Figur in einer unerträglichen Geschichte – die mich begeistert, überfordert, angeekelt und beglückt hat wie keine andere Erzählung seit Jahren. Vergleichbar vielleicht mit „Geister“ von Lars von Trier. Aber eben: schleppend, langsam, viel richtungsloser.
Ich bin in Band 16. Ein Ende/Finale ist langsam absehbar (noch zwei, drei Jahre?).
Wenn es auf diesem Niveau endet, ist es ein Meisterwerk.
.
.
Meine Comic-Entdeckungen 2015 rezensierte/empfahl ich hier (Link). Seit ca. 2008 lese ich vor allem DC-Superheldencomics (Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern etc.); 2013 und 2014 übersetzte ich ein Marvel-Superheldenlexikon in Deutsche (Link). Leider gibt es aktuell kaum DC-Reihen, die mich überzeugen (2016 bin ich gespannt auf „Black Canary“, „Omega Men“, „Superman: American Alien“ und vielleicht „Superman: Lois & Clark“ und „Prez“).
Marvel hat zu viele „X-Men“- und „Avengers“-Reihen mit zu vielen Figuren. Ich mag die Charakterzeichnung, Liebe zum Detail in vielen kleineren Reihen: „Ms. Marvel“, „She-Hulk“, „Silk“ und, mit Abstrichen, „Storm“ und „Squirrel Girl“. 2016 probiere ich „The Vision“, „Hellcat“, „Silver Surfer“ und „Moon Girl & Devil Dinosaur“.
Weitere Favoriten 2015: „Saga“ und „Lazarus“ (beide Reihen werden immer besser) und (deutlich schwächer) „Gotham Academy“, „Planetes“, „High Crimes“.
Der Manga „A Bride’s Story“ – über Ehe-Rituale, Jagd und Brauchtum entlang der Seidenstraße im 19. Jahrhundert – hat unsympathische Schlenker: Band 1 bis 3 waren wunderbar; doch hin und wieder fehlen die Hauptfiguren, der Fokus liegt 400 Seiten am Stück auf neuen, flacheren Frauen/Eheleuten.
Eine Collage der meisten (gelungenen) Graphic Novels, die ich 2015 las – kein Ranking:
.
mehr unter:
- Bücher 2016: erste Entdeckungen
- Graphic Novels 2015
- Buchtipps und Empfehlungslisten [großes Register: ca. 50 Sammlungen]
.












Da sind schöne Tipps dabei. „Herbstmilch“ kenne ich noch aus der Zeit, als es bei meiner Oma auf dem Nachttisch gelegen hat. Wird Zeit, dass ich das auch mal lese.
Herbstmilch habe ich vor Jahren gelesen und das Buch hat mich eine ganze Weile beschäftigt. Reinlesen lohnt sich auf jeden Fall.