Im Wohnzimmer auf der Couch stehen und ohne den Boden zu berühren zum Sofatisch hüpfen; von dort auf einen Stuhl und dann auf die umgekippte Spielzeugkiste; von dort zum Teppich vor der Tür und dann in Sicherheit. Eine Spielidee, die wohl die meisten in irgendeiner Form aus ihrer Kindheit kennen und die auf Englisch “The Floor is Lava” heißt. Eine Netflix-Show nimmt jetzt die Prämisse dieses Kinderspiels auf und lässt in einer speziell dekorierten Halle jeweils drei Teams mit je drei Personen gegeneinander antreten. In den Medien fallen in der Beschreibung von Der Boden ist Lava oft Begriffe wie “hirnlos” oder “Trash-TV”, bei den Zuschauenden ist die Show jedoch ein großer Erfolg, mit ausgesprochen umfangreicher Resonanz in den sozialen Medien. Warum ist dieses absurd anmutende Konzept gerade jetzt so erfolgreich und hat diese Show wirklich die Stimmung im Lockdown gerettet, wie ein Guardian-Autor behauptet (“Floor Is Lava is great. It has saved lockdown.”) und wenn ja, warum?
Im deutschsprachigen Raum hat nur GQ der Show eine ausführlichere Kritik gewidmet, die vor allem auf den hohen Produktionswert der Show eingeht. Denn für die knapp 30-Minuten langen Folgen wird der Spielraum jedes Mal neu und aufwändig gestaltet und die zu bekletternden Gegenstände zwischen dem orange-roten Schleim, der als Lava den Boden bedeckt, sind thematisch aufeinander abgestimmt. Die Spielfläche in Der Boden ist Lava ist jeweils an ein spezielles Zimmer in einem Haus angelehnt, vom Büro bis zum Schlafzimmer – sogar ein Planetarium gibt es. Passend zu dem grundsätzlich komplett überdrehten Design findet sich im Keller eine Alien-Mumie im Sarkophag mit aufgespießten Insektenrahmen an den Wänden und in der Küche spielt ein großer Pizzaofen eine entscheidende Rolle für die Teilnehmenden. Zudem gibt es in jeder Folge verborgene Anspielungen und lustige Details zu entdecken: von den Rothko-inspirierten Wandgemälden in Folge 2 zu einem Buch mit dem Titel Pompeji in Folge 5.
Das ganze Setdesign spielt mit visuellen Tropen und erinnert, genau wie von der Produktion angepeilt, mal an Indiana Jones oder an den Film Nachts im Museum. Diese kindlichen Vorstellungswelten, aufgepumpt mit genau der richtigen Menge an Größenwahn und Humor, funktionieren weitestgehend sehr gut, bloß in der Gestaltung des Arbeitszimmers, das teilweise unangenehm an den Raum eines reichen Großwildjägers erinnert, hätte man sich etwas mehr Feingefühl gewünscht. Teilweise sind die Klettergegenstände einen Tick zu groß (manchmal auch zu klein), was dem ganzen Set eine leicht surrealen Eindruck verleiht und auch das passt zu dem Grundkonzept eine Spielsituation aus der Kindheit als Gameshow neu zu beleben.
Durch einen Produktionstrick wird der sonst in der kindlichen Imagination stattfindende Nervenkitzel ines möglichen Todes in der Lava für die Zuschauenden potenziert: Wenn die Spielenden abrutschen, schneidet die Kamera direkt im Anschluss auf die Lavaoberfläche, für die Zuschauenden sind sie tatsächlich in der Lava verschwunden und ihr Fall wird von ihren Mitspielenden dramatisch kommentiert. Damit keine zuschauenden Kinderseelen durch diesen zugegebenerweise etwas drastischen Effekt geschädigt werden, tauchen aber alle Teammitglieder am Ende der Runde zu einem kurzen Interview nochmal auf. Dennoch ist der daraus resultierende Spannungsaufbau für kleinere Kinder vielleicht etwas zu anstrengend. Eher nervig sind auch die bemühten Moderationskommentare, die in der deutschen Übersetzung unfreiwillig komisch sind und oft Klischees bedienen, denen sich die Serie sonst entzieht.
Die Frage nach dem großen Erfolg der Serie wird oft mit einem Verweis auf die Sehnsucht nach “Fun” oder richtig guter, simpler Unterhaltung beantwortet und was könnte unschuldiger (und auch unpolitischer) sein, als auf den Spaß aus Kindheitstagen Bezug zu nehmen und daraus eine absurd aufgekratzte Gameshow zu fabrizieren, auf die sich auch große Familien gut einigen können. Die gut gecasteten Teams fügen den Episoden einen eigenen Humor hinzu, der sich auch noch perfekt für Internet-Memes eignet, wie die Drillinge aus der ersten Folge, die versuchten den Parcours in Muskelshirts mit dem Muster der amerikanischen Flagge zu bewältigen. Das Serienformat spielt außerdem mit einer nostalgischen Sehnsucht nach Samstagabendgameshows, die von der ganzen Familie im Fernsehen geschaut werden konnten und die Kindheit der Eltern von heute prägten. Also beste Unterhaltung für die ganze Familie, die im Zweifel aufgrund der Pandemie sowieso mehr Stunden als gewöhnlich miteinander verbringen muss und mit dieser Show nicht nur einen weitestgehend konfliktfreien Unterhaltungsrahmen gefunden hat, sondern auch noch Anregungen für weitere Spielstunden mit den Kindern. Das Geheimrezept aus Spaß, Unterhaltung, Überdrehtheit und Nostalgie ist eine deutliches Argument für den Erfolg der Serie. Aber bei genauerem Hinsehen dürften noch einige andere Faktoren erklären, warum genau diese Showidee so erfolgreich für den Sommer 2020 ist.
Da wäre zuerst, dass die Ausgangssituation der Show mit dem Überschreiten von Regeln arbeitet. Spielende Kinder dürfen nämlich für gewöhnlich nicht den Kronleuchter in das Spiel einbeziehen oder auf den elterlichen Schreibtisch springen. Das immer am Spielanfang betonte “Everything is part of the game!” vermittelt so den Zuschauenden auch das Gefühl absoluter Freiheit. Das gemeinsame Spiel ist entscheidend. Dieser gemeinschaftliche Anspruch verstärkt sich nur dadurch, dass die Teams nacheinander antreten und sich deswegen nicht in direkter Konkurrenz befinden. Stattdessen sieht man Freunde, Familien oder Arbeitskollegen dabei zu, wie sie sich gegenseitig anfeuern, teilweise auf rührende Art und Weise unterstützen und gemeinsam versuchen einen sicheren Weg durch den Raum zu finden, ein erstaunlich von Gemeinschaftsgeist geprägter Ansatz für ein Spiel, in dem Menschen in Lava versinken.
Die Spielsituation selbst ist ein weiterer Verweis auf mögliche Gründe für den Erfolg der Show, denn die gesamte Ausgangssituation basiert darauf, dass die Spielenden einen fiktionalen Pakt miteinander und mit den Zuschauenden schließen, der durch das mehr oder weniger laut gebrüllte “Der Boden ist … Lava” betont wird. Das Spiel lebt davon, dass alle Teilnehmenden und auch die Zuschauenden sich darüber einig sind, dass der orangene Schleim als gefährliche Lava behandelt wird. Ein einfaches “Ich habe keine Angst vor dem Schleim, das ist ja gar keine Lava” würde diese geteilte Fiktion zerstören. Diese Form des Spielens ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Wir können uns miteinander auf einen Fiktionspakt einigen und darauf aufbauend ein Spiel spielen oder uns auf fiktive Welten einlassen. Menschen, die diesen Fiktionspakt in Frage stellen, verderben uns dann das Spiel.
Der Boden ist Lava lebt von der Prämisse gemeinsam an einem Spiel teilzunehmen, sich kollektiv auf eine Fiktion einzulassen, die den Teilnehmenden deutlich bewusst ist, wie die übertrieben expressiven Reaktionen auf das Versinken der Spielenden in der Lava zeigen. Hier wissen alle, dass gespielt wird, niemand hat Interesse die fiktive Welt des Spiels zu durchbrechen. Deswegen können wir für die Zeit des Spiels sonstige Differenzen, Sorgen und Probleme in den Hintergrund treten lassen. Aus genau diesem Grund hat das Spielen, neben vielen anderen Aspekten, immer auch eine Entlastungsfunktion für die Teilnehmenden. Während des gemeinsamen Spielens genau wie bei der Immersion in eine fiktive Welt kann der enge Rahmen der Realität überschritten oder vergessen werden. Eine Gruppe aus Erwachsenen kann gemeinsam beschließen, sich enthusiastisch auf die Fiktion einzulassen, dass der zähe Schleim in der Produktionshalle eines ehemaligen Ikea-Marktes gefährlich spritzende Lava sei. Und vielleicht liegt genau darin das Geheimnis von Der Boden ist Lava: In einer Zeit, in der wir uns nicht mehr auf gemeinsame Fakten verständigen können, einigen wir uns zumindest auf eine miteinander geteilte Fiktion, so absurd sie auch sein mag.
Photo by Ben Klea




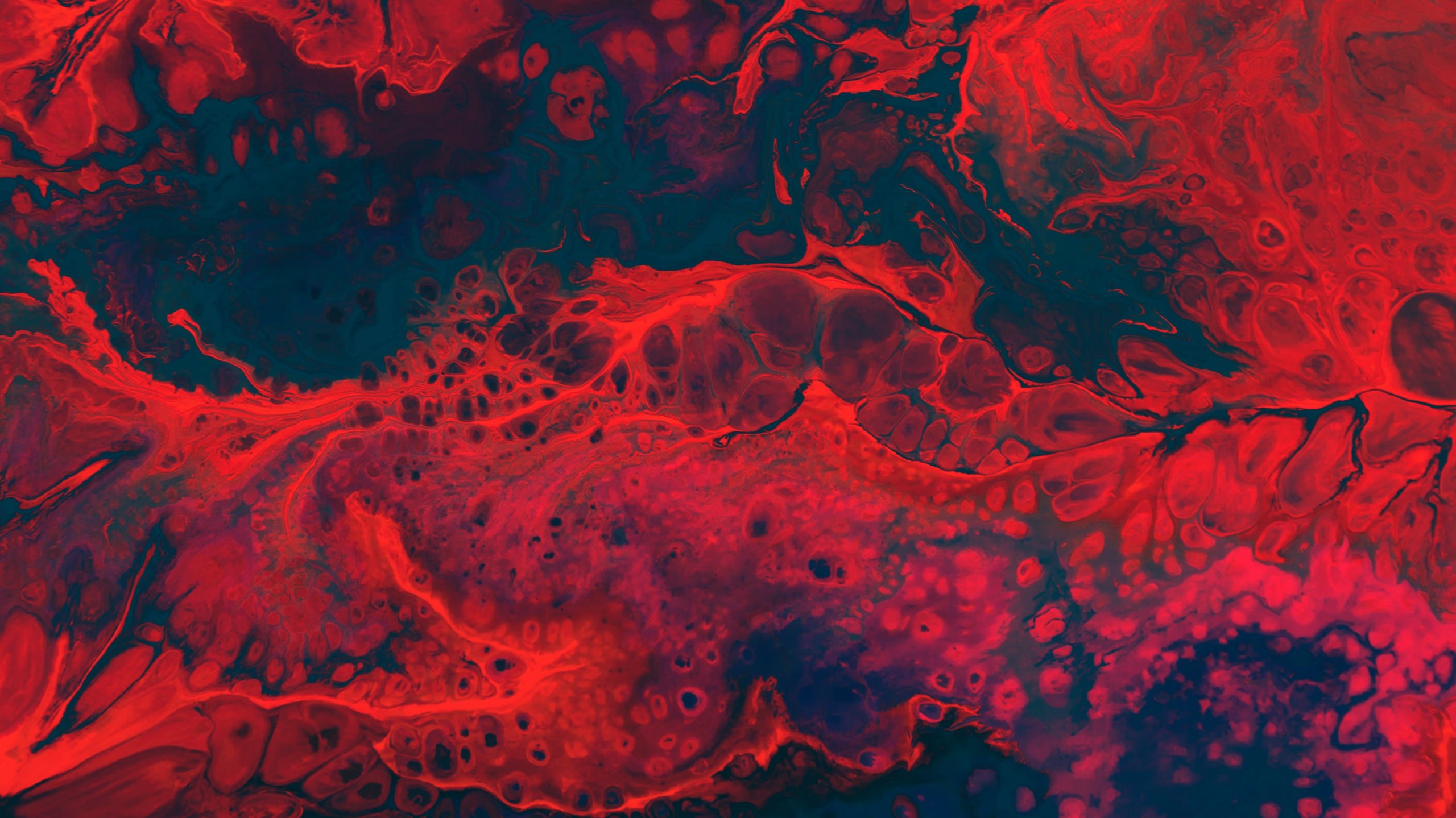

 Letzte Woche machte der Chefredakteur des
Letzte Woche machte der Chefredakteur des  Die Philippika Fredrichs liest sich, dem Genre geschuldet, etwas einseitig, macht aber auf das klassische Gefälle zwischen Urhebern und Verwertern aufmerksam. Auf der einen Seite sind die Produzenten von Inhalten und auf der anderen diejenigen, die diese Inhalte verkaufen. Das Gefälle entsteht dadurch, dass die einen in der Regel sehr viel mehr Geld und damit Verhandlungsmasse haben, als die anderen. Urheber sind dazu in der Regel sehr vorsichtig, man will ungern einen Verwerter verärgern, selbst dann nicht, wenn er einen schlecht behandelt. Nicht auszudenken, was einem entginge, wenn dieser Verwerter doch nochmal Lust hätte, einen gut zu behandeln. Also lieber Füße stillhalten. Zumal man auch Angst haben muss, dass andere Verwerter einen nicht mit offenen Armen aufnehmen werden, wenn man sich einmal einen Ruf als
Die Philippika Fredrichs liest sich, dem Genre geschuldet, etwas einseitig, macht aber auf das klassische Gefälle zwischen Urhebern und Verwertern aufmerksam. Auf der einen Seite sind die Produzenten von Inhalten und auf der anderen diejenigen, die diese Inhalte verkaufen. Das Gefälle entsteht dadurch, dass die einen in der Regel sehr viel mehr Geld und damit Verhandlungsmasse haben, als die anderen. Urheber sind dazu in der Regel sehr vorsichtig, man will ungern einen Verwerter verärgern, selbst dann nicht, wenn er einen schlecht behandelt. Nicht auszudenken, was einem entginge, wenn dieser Verwerter doch nochmal Lust hätte, einen gut zu behandeln. Also lieber Füße stillhalten. Zumal man auch Angst haben muss, dass andere Verwerter einen nicht mit offenen Armen aufnehmen werden, wenn man sich einmal einen Ruf als 




