Ich würde Moi les hommes, je les déteste (zu deutsch: Ich hasse Männer) von Pauline Harmange wahrscheinlich nicht kennen, hätte nicht ein Typ namens Ralph Zurmély das Verbot des Büchleins in Frankreich gefordert und den Verlag mit einer Strafe von 45.000 Euro bedroht. Auch wenn es den Anschein haben könnte, Ralph Zurmély ist nicht der klassische sexistische Kommentar-Typ aus dem Netz, mit dem sich jede Frau herumschlagen muss, die etwas äußert, das auch nur entfernt nach Feminismus klingt. Nein, Ralph Zurmély ist Referent im französischen Ministerium für die Gleichstellung von Mann und Frau.
Mit einem Schreiben vom E-Mail-Account seines Ministeriums forderte er die Verantwortlichen beim Verlag Monstrograph zum Erscheinungstermin des Büchleins ultimativ auf, die Veröffentlichung zu unterlassen. Es handele sich hier um einen Aufruf zur Gewalt gegen ein Geschlecht und zu dessen Diskriminierung. Das sei in Frankreich strafbar. Er drohte dem Kleinverlag mit einer Strafzahlung von 45.000 Euro. Als der Verlag die Drohung öffentlich machte, bekräftigte Zurmély in Stellungnahmen gegenüber verschiedenen französischen Medien, man werde gegen das Buch vorgehen.
Natürlich hatte Zurmély das Buch nicht gelesen. Bei dieser Art Text sei das schließlich nicht nötig. Organisationen zum Schutz der Presse- und Kunstfreiheit schalteten sich ein. Unter dem zunehmenden Druck der Öffentlichkeit distanzierte sich dann das Ministerium von Élisabeth Moreno von seinem Mitarbeiter: Die ganze Aktion sei seine private Initiative. Das Ministerium habe damit absolut nichts zu tun und werde sich auch nicht in der Sache engagieren. Das war Ende August, Anfang September dieses Jahres. Wie belastend die Ereignisse für Monstrograph und die Autorin Pauline Harmange gewesen sind, lässt sich auch in den Einträgen ihres Blogs nachlesen.
Eine von Privilegien geschützte mediokre Gestalt
Aber die Auseinandersetzung mit einem Funktionär der Staatsverwaltung, der sich dazu berufen fühlt, die Ehre der französischen Männer gegen eine 25-jährige Bloggerin und politische Aktivistin zu verteidigen, hat auch ihr Gutes: Die erste Auflage, 400 Exemplare, von Moi les hommes, je les déteste war innerhalb weniger Tage ausverkauft, ein Nachdruck nur wenige Stunden später. Der renommierte Verlag Éditions du Seuil übernahm die Rechte an Harmanges Buch. Seit Anfang Oktober ist es nun in allen französischen Buchhandlungen, im Versandbuchhandel und als E-Book erhältlich. Am 17. November wird die deutsche Übersetzung bei Rowohlt erscheinen, im Januar nächsten Jahres eine englische Übersetzung. Dazu kommen Übertragungen in weitere Sprachen.
französischen Buchhandlungen, im Versandbuchhandel und als E-Book erhältlich. Am 17. November wird die deutsche Übersetzung bei Rowohlt erscheinen, im Januar nächsten Jahres eine englische Übersetzung. Dazu kommen Übertragungen in weitere Sprachen.
Für das zentrale Argument, das Harmange in ihrem knapp hundert Seiten langen Essay ausführt, könnte Ralph Zurmély Beweisstück Nummer Eins sein: Der vom Patriarchat produzierte Standard-Mann ist eine von Privilegien geschützte mediokre Gestalt. Er saugt die sozialen, kreativen und intellektuellen Energie von Frauen (und anderen Nicht-Männern) ab, im Privatleben, im Beruf und in der Öffentlichkeit. Denkfaul, aggressiv, misogyn belastet er das Leben von Frauen. Und in vielen Fällen belästigt er sie auch, übt routinemäßig Gewalt gegen sie aus und tötet sie. Der Mann ist eine Gestalt, der Frauen so wenig Platz wie irgend möglich in ihrem Leben einräumen sollten. Männer sind abzulehnen. Sie haben kein Recht auf die Zeit, das Interesse, die Gegenwart oder gar die Zuwendung von Frauen. #AllMenAreTrash. Misandrie, der Hass gegen Männer, ist für Frauen eine Form der Selbstsorge und sie wirkt ermächtigend. Wenn Frauen sich in Bezug auf Männer erst einmal selbst ihren Frust, ihre Wut, ihre Verachtung und ihren Abscheu eingestehen und sich von ihnen abwenden, entstehen die Freiräume, mental und sozial, in denen Frauen sich selbst entdecken und entwickeln – gemeinsam und in Auseinandersetzung mit anderen Frauen. Soweit zunächst Pauline Harmange.
Auch wenn in den letzten Jahren im öffentlichen Diskurs wieder öfter feministische Stimmen zu Wort kommen, die mehr fordern als Fairness im Rattenrennen um die erfolgreichste Karriere, sind Pauline Harmanges Thesen und Forderungen in Moi les hommes je les déteste von einer Radikalität und Direktheit, die sich gegenwärtig so außerhalb von Aktivistinnen-Gruppen und feministischen Social Media-Bubbles kaum finden lassen. Auch nicht oder schon gar nicht in Frankreich, auf dessen Staatsfeminismus mit Ganztags-Kinderbetreuung ab den frühesten Lebensjahren und positivem Bild von arbeitenden Müttern viele westdeutsche Frauen immer noch neidisch blicken. Harmange weiß um die Radikalität ihres Feminismus, und sie weiß, was sie an Reaktionen von Männern zu erwarten hat, auch von solchen, die sich selbst als links bezeichnen. Ihr Essay beginnt mit genau dieser Szene:
Eines Tages schrieb ich auf meinem Blog, dass mich die Faulheit der Männer, ihr Widerwillen sich mit der Sache der Frauen zu beschäftigen müde macht. Ruckzuck kommentierte einer von den Wohlmeinenden anonym: „Du solltest dich vielleicht fragen, warum die Männer nicht davon sprechen wollen. Ein paar Hinweise: die aggressive, um nicht zu sagen hasserfüllte Haltung von Feministinnen gegenüber jedem Mann, der nicht sagt: „Ich schäme mich ein Mann zu sein! Tod den Männern!“ Der Tag, an dem ihr endlich die Beziehungen zwischen Mann und Frau so seht, wie sie wirklich sind, […] , dann werden wir euch zuhören. Bis dahin sieht man euch als frustrierte Weiber mit Bart und ihr tut eurer Sache keinen Gefallen.“
Ein Klassiker der avancierten Feminismus-Kritik also, beliebt mindestens seit Schiller 1789 feststellte: „Da werden Weiber zu Hyänen!“
Bekenntnis zur Misandrie
Statt diesen Vorwurf zu entkräften, wie es vor allem liberale, bürgerliche Feministinnen seit den Anfängen des Feminismus zu tun versuchen, zeigt Harmange, welche Funktion er für die Aufrechterhaltung des Patriarchats hat: Die Forderung nach einem gleichberechtigten, freien und sicheren Leben als Frau wird als Misandrie, als Männerhass diskreditiert; der Mann wird wieder zum Ziel und Gegenstand weiblicher Arbeit an sich selbst etabliert.
Harmange zieht daraus die quasi logische Konsequenz: Sie bekennt sich zur Misandrie, sie plädiert für die Abschaffung des Mannes als relevantem Faktor feministischem Engagements und für ein gutes Leben als Frau. Moi les hommes, je les déteste ist der Text, der diese Abkehr begründet. Dazu setzt sich Harmange vor allem mit den Strukturen auseinander, die Frauen davon abhalten, sich der patriarchalen gewaltvollen Realität der eigenen Beziehungs- und Lebensverhältnisse zu stellen. Gleichzeitig feiert sie die emotionale und intellektuelle Befreiung, die es für sie selbst und ihr weibliches Umfeld bedeutet hat zu erkennen, dass nicht sie selbst irgendwie falsch sind, „hysterisch“, unweiblich, sondern die Situation, in der sie leben. Dass das Ganze im wörtlichen Sinne nicht nur System hat, sondern auch eines ist:
Ich glaube, dass mich nur kontinuierliche feministische Praxis dahin gebracht hat, die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen zu entwickeln, um zu dieser Haltung (der offenen Misandrie; CD) zu kommen. Man gewinnt an Unerschrockenheit, weil die Zahlen zur Gewalt gegen Frauen in einem soziologischen Rahmen betrachtet und analysiert werden. Man begreift, dass das, was man selbst in den eigenen Beziehungen empfindet, und das so oft als persönliches, individuelles Problem abgewertet wird, eine politische Dimension hat, einen systematischen Charakter. Dass das nicht nur wir sind, die uns da in unserem Kopf was zusammenphantasieren, weil Frauen bekanntlich ja so gerne Dramen provozieren.
Später im Text fällt dann auch der Slogan, der die Frauenbewegung von Beginn an prägte „Das Private ist Politisch!“ – eine Aussage, die auch Harmanges Vorgehensweise beschreibt, die eigenen, individuellen Erfahrungen immer wieder auf deren sozialen und geschlechterdynamischen Kontext zu beziehen und deren Funktion darin zu analysieren. Sie schreibt nicht nur darüber, ihre langjährige Unfähigkeit, Wut und Zorn nicht artikulieren zu können, sondern sie überhaupt erst einmal als solche empfinden zu lernen. Sie reflektiert ihre Sozialisation in die Rolle der empathischen, emotionalen und sozialen Care-Arbeiterin, ohne die im heteronormativen Patriarchat weder Beziehungen, noch Familien, noch der Berufsalltag funktionieren können.
Über die Unterwerfung der Frauen unter das Diktat der Heterosexualität: die äußerliche und innerliche Selbstzurichtung zur für Männer sexuell attraktiven Frau und Sozialstatus-Markern mit Yoga, Fitness Studio, Kosmetik und plastischer Chirurgie, Psychotherapie und Kommunikationskursen, Diäten und Wellness-Wochenende. Über die permanente psychische Überlastung, die damit einhergeht im Patriarchat eine Beziehung mit einem Mann zu führen, weil man selbst an alles denken muss, vom Geburtstag der Mutter bis zum Wäsche aufhängen und dem Müll rausbringen. Über den Mechanismus, die aus diesen Asymmetrien entstehenden Konflikte, Streitigkeiten und Auseinandersetzungen als eigenes Versagen, als eigene Schuld zu interpretieren, während der Mann cool bleibt.
Er spricht von einer Position der Vernunft aus, weil ihn das alles ja nichts angeht,– und damit auch bestimmt, was in einer Beziehung als wichtig gilt und was niedliche oder nervige Petitessen der Partnerin sind. Mental Load, heterosexuelle Partnerschaft als signifikanter Negativfaktor für die psychische und körperliche Gesundheit von Frauen und ihrem Selbstvertrauen – Harmange untermauert mit typischen Szenen aus dem Leben einer Frau in einer heterosexuellen Partnerschaft ihre These, dass Heterosexualität und Patriarchat zusammengehören. Und dass die Heterosexualität eine Falle ist, nicht nur für die Frauen. (In einer längeren Passage schreibt Harmange darüber, wie die heterosexuellen Machtverhältnisse es Jungen und Männern unmöglich machen, über eigene Verletzlichkeiten, Ängste und weiblich codierte Bedürfnisse zu reden – und damit auch die Gewalt unter Männern, vor allem sexualisierte Gewalt und Übergriffe unaussprechbar macht.) Unter Heterosexualität versteht Harmange vor allem den Zwang zur Mann-Frau-Paar-Bildung, die Sexualisierung von Reproduktions- und Care-Arbeit sowie von emotionalen Beziehungen bereits in früher Kindheit.
Ein Raum für Frust, Wut und eigene Ängste
Leser*innen, die alt genug sind, um sich an die Frauenbewegung der 60er und 70er Jahre zu erinnern oder einige Texte dieser Jahrzehnte gelesen haben, wird das bekannt vorkommen: Moi les hommes je les déteste ist die Rückkehr des radikalen Consciousness Raising- und Empowerment-Textes in die aktuelle feministische Debatte. Kate Millet, Shulamith Firestone, Andrea Dworkin, Audre Lorde, Adrienne Rich, Gloria Steinem, Monique Wittig – auf fast jeder Seite des Buches meint man Echos ihrer Stimmen zu hören, ihrer Argumente und ihrer Hoffnung, jenseits der Männer eine freiere, gleichberechtigte und liebevolle Welt zu schaffen. Dahin führt auch für Harmange die Fokussierung des eigenen Blicks auf andere Frauen und vor allem die Fokussierung des eigenen Handelns auf den solidarischen Umgang mit anderen Frauen im eigenen Umfeld und den Aufbau stabiler weiblicher Netzwerke.
Dass eine junge Frau aus Lille 2020 einen Essay schreiben kann oder vielleicht sogar schreiben muss, der in großen Teilen bereits vor fast fünfzig Jahren schon einmal geschrieben worden ist, das kann man traurig und deprimierend finden. So wenig hat sich also in der Sozialisation und im Leben von Frauen geändert. Man kann sich darüber ärgern, dass die Traditionsbildung unter Frauen so schlecht funktioniert, dass alle fünfzig Jahre fast dasselbe wieder gesagt werden muss. Man kann sich wundern, dass in Moi les hommes je les déteste fast keine der großen Mütter, weder des französischen, noch des amerikanischen Feminismus explizit genannt wird oder die Autorin sich auf sie bezieht.
Für die Leser*innen, die Pauline Harmange vermutlich eher im Kopf hatte, als sie ihren Essay für Monstrograph schrieb, sind diese Einwände einer Leserin über 50 wahrscheinlich egal – und das ist gut so. Sie schreibt, wie auf ihrem Blog un invincible été, für junge Frauen, die am Anfang ihrer Karriere als Frauen und Mütter im Patriarchat stehen, also am Anfang ihrer Laufbahn als Sex-, Gefühls-, Versorgungs- und Koch-Dienstleisterinnen, und die sich fragen, warum sie jetzt schon so ein schlechtes Gefühl dabei haben, obwohl doch in Frankreich alles so gut eingerichtet ist, um Kind, Mann und Karriere unter einen Hut zu bringen.
Für die jungen Frauen, deren Energie, Selbstvertrauen und Optimismus, sich ein gutes Leben zu gestalten, bereits in der Schule die ersten Rückschläge erlitten hat und die glauben, das läge an ihnen. Sie strengten sich nicht genug an. Für die ist es am Anfang ihrer feministischen Selbst-Bewusstwerdung egal, ob Harmange die richtigen Theoretikerinnen, die richtigen Begriffe und Konzepte verwendet. Für die ist es wichtig, dass Pauline Harmange ihnen in ihrem Text einen Raum schafft, in dem sie ihren eigenen Frust, ihre Wut, ihre Ängste wiederfinden können – und der ihnen zeigt, dass eine Welt jenseits der Männer nicht nur möglich ist, sondern in Augenblicken weiblicher Solidarität und Freundschaft auch schon da. Und dass Frauen durch praktische Solidarität untereinander diese Welt realer werden lassen – und nicht, in dem man Männer versucht davon zu überzeugen, ihren Arsch in Richtung Gleichberechtigung zu bewegen. Das müssen Männer schon untereinander ausmachen. Das nächste Mal, wenn die Kumpels einen sexistischen Witz machen, ihnen Kontra zu geben, wäre schon mal ein Anfang.
Die Übersetzung der Zitate stammt von Christina Dongowski.
Photo by Sinitta Leunen on Unsplash





 vergangenen Jahr in Ein Mann seiner Klasse beschrieben, wie ein Kind aus einer Arbeiterfamilie, das Gewalt, Verwahrlosung und Vernachlässigung durch Familie und Gesellschaft ausgesetzt ist, seinen Weg aus diesem Umfeld findet. Die Protagonistin in Streulicht wächst auf den ersten Blick in ähnlichen Umständen auf. Vater und Mutter streiten viel und manchmal kommt es zu Gewalt. Dann muss sie zum Großvater, der in der Wohnung im Erdgeschoss wohnt. Die Wohnung ist oft schmutzig, Hausaufgaben macht sie, während nebenher Talkshows laufen, und der Vater muss nachts aus der Kneipe abgeholt werden. Doch zu diesen Umständen, in denen die Erzählerin aufwächst, kommt zusätzlich die Diskriminierung, der sie aufgrund der Herkunft ihrer Mutter und des Vornamens, den ihre Eltern ihr gegeben haben, ausgesetzt ist. All diese Lebensumstände signalisieren für die deutsche Mehrheitsgesellschaft einen bestimmten Platz, an den die Erzählerin gehört. Dass sie an diesem Ort aber nicht bleibt, davon handelt Streulicht.
vergangenen Jahr in Ein Mann seiner Klasse beschrieben, wie ein Kind aus einer Arbeiterfamilie, das Gewalt, Verwahrlosung und Vernachlässigung durch Familie und Gesellschaft ausgesetzt ist, seinen Weg aus diesem Umfeld findet. Die Protagonistin in Streulicht wächst auf den ersten Blick in ähnlichen Umständen auf. Vater und Mutter streiten viel und manchmal kommt es zu Gewalt. Dann muss sie zum Großvater, der in der Wohnung im Erdgeschoss wohnt. Die Wohnung ist oft schmutzig, Hausaufgaben macht sie, während nebenher Talkshows laufen, und der Vater muss nachts aus der Kneipe abgeholt werden. Doch zu diesen Umständen, in denen die Erzählerin aufwächst, kommt zusätzlich die Diskriminierung, der sie aufgrund der Herkunft ihrer Mutter und des Vornamens, den ihre Eltern ihr gegeben haben, ausgesetzt ist. All diese Lebensumstände signalisieren für die deutsche Mehrheitsgesellschaft einen bestimmten Platz, an den die Erzählerin gehört. Dass sie an diesem Ort aber nicht bleibt, davon handelt Streulicht.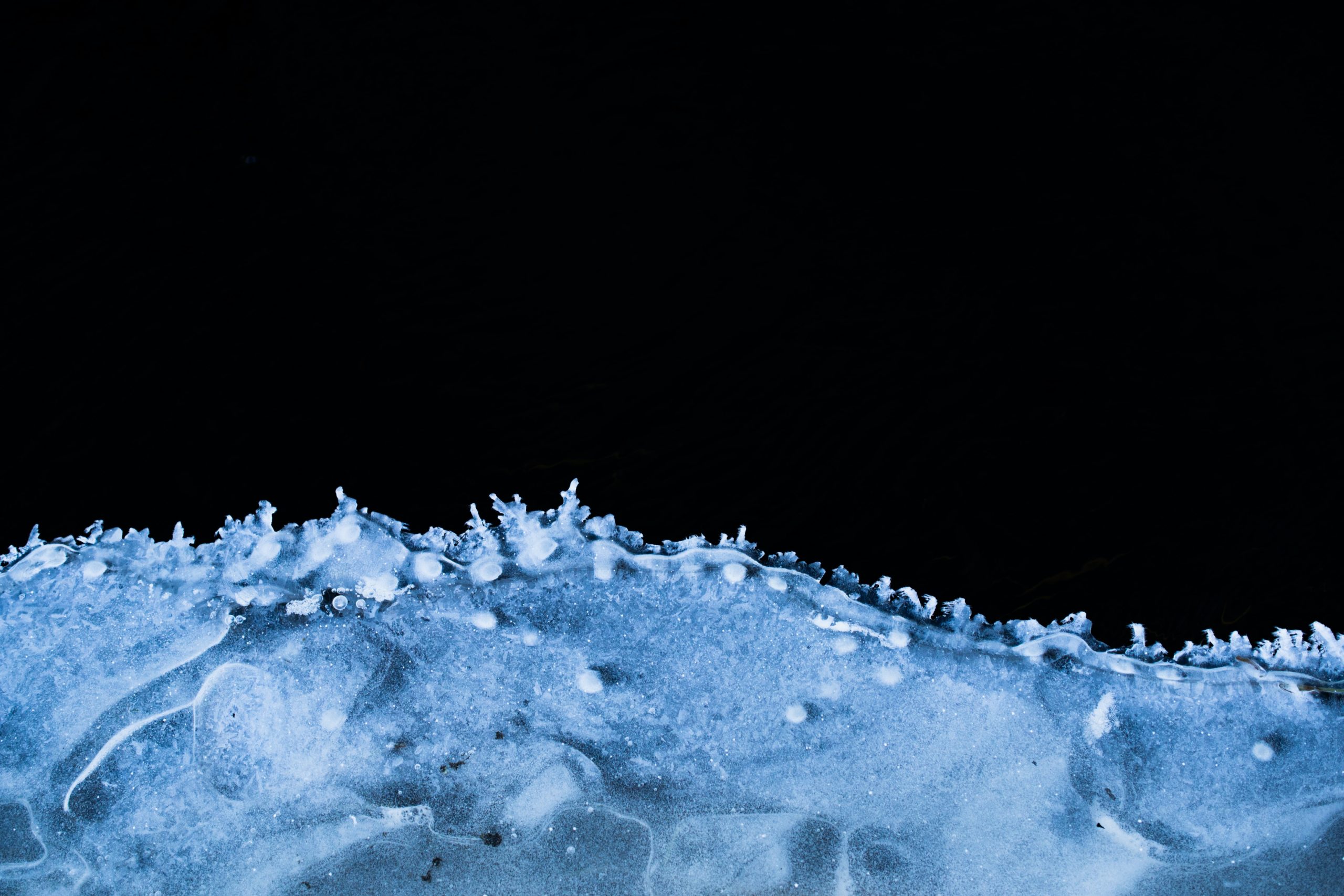

 Popliteratur widmet und insbesondere das Magazin Tempo, seine Leser*innenschaft und seinen Anspruch, eine Generation abzubilden, näher betrachtet. Das entscheidende Attribut lautet dabei postheroisch. Während der Popkultur der 60er/70er Jahre ein heroischer Selbstanspruch im Sinne eines Widerstands attestiert werden kann, zeichneten sich Tempo und die Popliteratur der 90er Jahre durch eine postheroische Haltung aus, die durch einen zunehmenden Bedeutungsverlust von Subkulturen und eine Verbindung von Popkultur und Konsum entstanden war. Dabei kam es zu einer „Lösung des Popdiskurses vom linksalternativen Deutungsmonopol“ und zu einer Ablehnung des linken ebenso wie des konservativen Kulturverständnisses. Daraus entstand ein Generationsgefühl, das nicht mehr durch das gemeinsame Erleben politischer Ereignisse erzeugt wurde, sondern durch kollektive Konsum- und Freizeiterfahrungen. Anhand der Kategorien Generation, Gender, Nation und Konsum zeigt Steenbock auf, wie Tempo durch Stil, Themensetzung und Darstellungsweise vor allem in Bezug zu den vier Bereichen einen Zeitgeist affirmierte und gleichzeitig erzeugte.
Popliteratur widmet und insbesondere das Magazin Tempo, seine Leser*innenschaft und seinen Anspruch, eine Generation abzubilden, näher betrachtet. Das entscheidende Attribut lautet dabei postheroisch. Während der Popkultur der 60er/70er Jahre ein heroischer Selbstanspruch im Sinne eines Widerstands attestiert werden kann, zeichneten sich Tempo und die Popliteratur der 90er Jahre durch eine postheroische Haltung aus, die durch einen zunehmenden Bedeutungsverlust von Subkulturen und eine Verbindung von Popkultur und Konsum entstanden war. Dabei kam es zu einer „Lösung des Popdiskurses vom linksalternativen Deutungsmonopol“ und zu einer Ablehnung des linken ebenso wie des konservativen Kulturverständnisses. Daraus entstand ein Generationsgefühl, das nicht mehr durch das gemeinsame Erleben politischer Ereignisse erzeugt wurde, sondern durch kollektive Konsum- und Freizeiterfahrungen. Anhand der Kategorien Generation, Gender, Nation und Konsum zeigt Steenbock auf, wie Tempo durch Stil, Themensetzung und Darstellungsweise vor allem in Bezug zu den vier Bereichen einen Zeitgeist affirmierte und gleichzeitig erzeugte.




