In den letzten Jahren hört man immer wieder von „kultigen“ oder „authentischen“ Milieus, in denen literarische Handlungen angesiedelt sind – zuletzt im Roman Große Freiheit von Rocko Schamoni. Für gewöhnlich betrachtet darin eine sich selbst als hochkulturell definierende Szene einen sozialen Bereich, der ihr in irgendeiner Form fern ist. Oft wird eine Mischung aus maskuliner Authentizität und Nostalgie für Zustände gewählt, die man aus guten Gründen nicht mehr haben will, deren Charme man sich aber auch nicht vollkommen erwehren kann. Jemand, der mit Kultpatina auf sozial schwierige Verhältnissen nichts anfangen kann, ist die Schriftstellerin und Comedy-Autorin Giulia Becker. Das machte sie im November 2018 unmissverständlich auf Twitter und Facebook klar, als sie sich durchaus wütend und exakt beobachtend über „den“ norddeutschen Mann lustig machte, der sogenannte Zuhältertypen kultig finde, in Kneipen viel trinken und rauchen würde, Lieder über Regen und das Leben schreibe und sich für einen Feministen halte, weil er an drei Tagen in der Woche seine kleine Tochter hat (siehe Thread).
Norddeutsche Männer, einfach KULTIG
— Schwester Ewald (@hashcrap) September 19, 2018
Das kultige Potenzial dieses Milieus voller Männer, die vermeintlich sensibel mit den harten Umständen des Mannseins in einer immer „unmännlicheren“ Welt zu kämpfen haben und sich aufreiben zwischen dem Wunsch nach der Authentizität von verrauchten Kiezkneipen und dem Vater-Sein, hat die Kulturbranche von Film über Musik bis hin zur Literatur inzwischen weitgehend ausgereizt. Die Kiezromane von Rocko Schamoni und Heinz Strunk, die Verfilmung von Strunks Roman Der Goldene Handschuh im letzten Jahr durch Fathi Akin; Musiker wie Olli Schulz und Thees Uhlmann füllen diesen Rahmen stetig mit neuen Geschichten.
Dieser gesellschaftliche Bereich, der leicht mit diesem Firnis aus stereotyper kultiger Echtheit überzogen werden kann, ist ein Bereich, in dem sich die deutsche Gegenwartsliteratur nicht selten ansiedelt. Auch das kreative Bildungsmilieu oder ein sozial schwieriges Milieu, das in der literarischen Darstellung häufig entweder kultig oder sozial interessant ist, haben literarische Konjunktur: Sinnfrage und horror vacui einer gebildet-kreativen Schicht, sozial schwache Milieus als Kultroman, Sozialstudie oder Emanzipationsgeschichte und historische Stoffe füllen die Regale der Buchhandlungen.
Irgendwo zwischen diesen literarisch hochfrequentierten sozialen Bereichen findet sich eine große Gruppe an Menschen, die in Kleinstädten in Einfamilienhäusern, mittelgroßen Wohnungen und Neubaugebieten wohnen, und den Berufen nachgeht, die das Literaturmilieu für gewöhnlich argwöhnisch beäugt: Verwaltung und mittlere Angestelltenberufe. Menschen, denen die meisten Schriftsteller*innen weder die intellektuelle Kompetenz noch die authentische materielle Notlage zutrauen, die es als Zutaten für große (zwischen)menschliche Dramen offenbar braucht. Was diesen Menschen aus der Perspektive der tendenziell hochkulturellen Branchen fehlt ist der scheinbar raue Charme und das Elend der sogenannten Arbeiterklasse, das sich in Kult verwandeln ließe.
 Es ist die Welt, in der Willy-Martin, ein Protagonist in Giulia Beckers Debütroman Das Leben ist eins der härtesten (Rowohlt 2019), abends nach Hause kommt, eine Pizza Hawai bestellt, sich mit seiner E-Zigarette mit Multifrucht-Liquid an seinen Medion-PC setzt und unter dem Pseudonym HäuptlingRaimundo gegen DieKnochenbrecherin Online-Kniffel spielt. Willy-Martin ist mit Silke befreundet, die bei einem psychischen Zusammenbruch vor etlichen Jahren, die Notbremse eines Regionalzuges betätigt hat und dadurch in Schulden gestürzt wurde, jetzt in der Bahnhofsmission in Borken arbeitet und gerne einen Spendenlauf für den krebskranken Obdachlosen Zippo organisieren möchte. Ihre Freundin Renate, die sie einmal unterstützt hat, muss nun selbst den Verlust ihrer Hündin Mandarine Schatzi und die Rechnung nach einem Berg von Impulskäufen verkraften. Gemeinsam beschließen die drei der 97-jährigen Nachbarin von Silke einen letzten Wunsch zu erfüllen und in die Fake-Tropen Tropical Island in einem alten Flugzeughangar nach Brandenburg zu fahren. Allein wie Becker durch die Erwähnung bestimmter Orte, Produkte und Menschentypen und durch gut beobachtete Details ein Kleinbürgermilieu entstehen lässt, macht dieses Buch schon lesenswert.
Es ist die Welt, in der Willy-Martin, ein Protagonist in Giulia Beckers Debütroman Das Leben ist eins der härtesten (Rowohlt 2019), abends nach Hause kommt, eine Pizza Hawai bestellt, sich mit seiner E-Zigarette mit Multifrucht-Liquid an seinen Medion-PC setzt und unter dem Pseudonym HäuptlingRaimundo gegen DieKnochenbrecherin Online-Kniffel spielt. Willy-Martin ist mit Silke befreundet, die bei einem psychischen Zusammenbruch vor etlichen Jahren, die Notbremse eines Regionalzuges betätigt hat und dadurch in Schulden gestürzt wurde, jetzt in der Bahnhofsmission in Borken arbeitet und gerne einen Spendenlauf für den krebskranken Obdachlosen Zippo organisieren möchte. Ihre Freundin Renate, die sie einmal unterstützt hat, muss nun selbst den Verlust ihrer Hündin Mandarine Schatzi und die Rechnung nach einem Berg von Impulskäufen verkraften. Gemeinsam beschließen die drei der 97-jährigen Nachbarin von Silke einen letzten Wunsch zu erfüllen und in die Fake-Tropen Tropical Island in einem alten Flugzeughangar nach Brandenburg zu fahren. Allein wie Becker durch die Erwähnung bestimmter Orte, Produkte und Menschentypen und durch gut beobachtete Details ein Kleinbürgermilieu entstehen lässt, macht dieses Buch schon lesenswert.
Wenn der Kleinstadthorror im Spiegel lauert
Kleinstädte wie den Handlungsort Borken gibt es zwischen den größeren und größten Städten Deutschlands zuhauf und Giulia Becker, die laut eigener Aussage in „einem Dorf hinter einer Kleinstadt hinter Siegen“ aufgewachsen ist, kennt sie vermutlich aus eigener Anschauung. So kann sie in ihrem Roman ein Sammelsurium an Figuren zum Leben erwecken, über das man sich leicht lustig machen könnte. Menschen, die bei Home-Shopping-Kanälen Küchengeräte en masse einkaufen, die Kerstin Ott hören und sich von ihr „verstanden“ fühlen, deren Lieblingsradio-Sender „das Beste aus den Achtzigern, Neunzigern und von heute“ spielen und die ihre Hunde eben Mandarine Schatzi nennen. Vielleicht lassen sich die Figuren am besten mit einem Satz von Willy-Martin charakterisieren, mit dem er Silke Kaffee anbietet: „Willste auch einen? Ist der feine Milde von Tchibo.“ (159)
Die Autorin stellt die Leser*innen damit vor eine heikle Aufgabe und begibt sich dabei selbst auf einen wackligen Untergrund, auf dem sie nicht immer sicher steht. Indem sie ihre Figuren stereotypisiert und überzeichnet, spricht sie zunächst einmal die Vorurteile an, die über das beschriebene Kleinstadtsoziotop bestehen. Giulia Becker ist vorrangig bekannt als Autorin und Teammitglied des Neo Magazin Royale von Jan Böhmermann, erschienen ist ihr Roman bei Rowohlt und sie wurde unter anderem mit dem Newcomer-Preis der lit.Cologne ausgezeichnet. Ihr Zielpublikum ist ein junges, meist gebildetes Großstadtmilieu: Menschen, die all das, was die Figuren in Das Leben ist eins der härtesten ausmacht, nicht verkörpern wollen. Die bewusste Überzeichnung der Romanfiguren entlarvt diese als Klischeetypen und führt den Leser*innen damit ihre eigenen Vorurteile gegenüber dieser Gruppe von Menschen vor Augen. Damit werden diese Vorurteile und Klischees aber auch reproduziert und stellenweise zieht der Roman auch seine Komik daraus.
Gleichzeitig stattet Becker ihre Charaktere aber mit den klassischen Problemen der Literatur aus: Sinnfragen, zwischenmenschliche Probleme und Krankheit und Tod. Man spricht dann häufig in solchen Fällen davon, dass ein*e Autor*in die Figuren liebevoll beschreiben würde. Meistens ist liebevoll ein Euphemismus dafür, dass mit einem mitleidigen Lächeln auf die Charaktere hinabgeschaut wird. Genau das vermeidet Becker aber, indem sie den Leser*innen immer wieder die Gemeinsamkeiten mit den Figuren vor Augen führt und ihnen klarmacht, dass vermutlich viele selbst aus diesen Kleinstädten kommen. Da ist nämlich unter anderem Sascha, der im Tropical Island arbeitet und aussieht
„wie jemand, der sein Work and Travel-Jahr in Australien frühzeitig abgebrochen hat, weil es ihm doch ein bisschen zu viel Work und zu wenig Travel war.“ (101)
und damit vermutlich gar nicht so weit entfernt von einigen Männern aus dem Zielpublikum des Romans ist. Der Kleinstadthorror lugt immer wieder aus dem Spiegel hervor und verhindert, dass sich man sich als Leser*in allzu genüsslich über die Figuren amüsiert. Der Grund, aus dem man sich über die Figuren lustig machen möchte und schnell dem Reiz der intellektuellen Überheblichkeit erliegt, liegt in ihrer Einfachheit gegenüber den Angeboten und Klischees des sogenannten guten Lebens begründet. Es sind Menschen, die auf jedes Sonderangebot hereinfallen, die jeder Werbung folgen und ansonsten alles so machen wollen, wie das Vorabendfernsehen und der EDEKA-Prospekt es ihnen vorleben. Das Lachen bleibt dem großstädtisch-kreativen Lesepublikum jedoch im Halse stecken, wenn es kurz den Kopf aus dem Buch hebt und auf die fünf MacBooks im Hinterhofcafé mit Craft-Beer-Auswahl blickt.
Wer noch keinen Otto-Katalog in der Hand hatte, werfe den ersten Stein
Giulia Becker löst daher bei ihren Leser*innen ähnliches aus, wie Rainald Grebe in seinen Songtexten, nur dass sie andere Strategien dabei anwendet. Während Rainald Grebe durch das Hervorholen von milieuspezifischen Klischees und einer gebrochenen BRD-Nostalgie bei den Hörer*innen eine ungute Gänsehaut auslöst, weil sie sich selbst in ihren kleinbürgerlichen und spießigen Sehnsüchten wiedererkennen, zeigt Becker einem vermeintlich hippen Großstadtlesepublikum, dass sein Leben sich in der Struktur gar nicht so sehr vom Kleinstadtleben ihrer Protagonisten unterscheidet:
„Also aßen sie und schwiegen, und im Radio lief leise Lighthouse Family“ (47)
Solche Sätze in der Balance zwischen einer unwiderstehlichen Situationskomik und einem leichten Erschaudern, finden sich in Beckers Roman ebenso wie in Grebes Songtexten. In beiden Fällen wird schnell klar, dass man selbst gar nicht so wenig spießig und kleinstädtisch ist, wie man das vielleicht gerne hätte.
Diese zweite Ebene hinter dem manchmal kalauernden Humor unterscheidet diesen Roman von den meisten Beispielen deutscher Literatur aus dem Comedybereich. Während der Witz der millionenfach verkauften Romane von Tommy Jaud auf dem gleichen Niveau daherkommt wie Mario-Barth-Shows und Oliver Pochers Sprüche, verbindet Giulia Becker ihr hintergründiges Spiel mit Klischees mit einem Humor, bei dem man sich manchmal wünscht, dass die Stand-up-Nummern von Jan Böhmermann am Anfang des Neo Magazin Royales genauso intelligent zünden würden. Gut ist dieser Humor, weil er den Leser*innen die eigenen Klischees vor Augen führt, aufzeigt, dass sie manche davon selbst erfüllen und das in so komische Situationen verpackt, dass man dennoch über sich selbst und andere gleichzeitig lachen kann:
„Silke musste ihr dann mit einem Otto-Katalog Luft zufächern und ein Glas Aperol Spritz an ihren Mund halten, damit sie bei Bewusstsein blieb.“ (111)
„Willy Martin fährt gemächlich auf der rechten Spur, Silke isst ein Brot nach dem anderen, Renate schreibt Nachrichten bei WhatsApp. Kurz findet Silke die Reise schön, irgendwie abenteuerlich.“ (94)
Es ist ein sehr deutsches Milieu, das Becker hier zeichnet und damit zielt sie auch auf die Klischees der deutschen Reihenhausmentalität und deckt diese schadenfroh auf, wenn beispielsweise Kerstin zu Kartoffeln immer noch ein anderes Kartoffelgericht als Beilage macht und das Kartoffelmesser zur gefährlichen Waffe wird. Diese Spielerei mit Selbstironie macht den Roman dann auch noch sympathisch.
Giulia Becker hat mit Das Leben ist eins der härtesten etwas geschafft, das nur wenige auf diese Weise hinbekommen: Einen Roman zu schreiben, der lustig (und das kann nicht stark genug betont werden), absurd und gleichzeitig intelligent ist, den man in wenigen Stunden lesen kann und der die Leser*innen mit eigenen Klischees und Fragen der Selbstwahrnehmung konfrontiert. Dass er gleichzeitig mit zahlreichen boshaften Seitenhieben auf die Medienwelt gespickt ist, die Becker vermutlich aus eigener Anschauung zur Genüge kennt, ist ein zusätzliches Plus.



 bewegen und darüber schreiben: „Heute lieber Hose. Heute lieber unsichtbar.“ (Mirjam Aggeler), „Ich verspeise die Stadt“ (Halina Mirja Jordan), „Flanieren heißt sich um nichts zu kümmern.“ (Anke Stelling), „Ich versuche so zu tun, als liefe ich hier jeden Tag lang.“ (Leyla Bektaş). Es wirkt, als schiene durch alle diese Sätze eine Art gemeinsames Bedürfnis hindurch, zunächst einmal Aussagen zu treffen, Fragen zu stellen, prägnante Sentenzen zu finden, um etwas zu umreißen, das bisher in der kulturellen Repräsentation nicht vorgesehen war: Menschen, die nicht männlich, weiß, cis und straight sind, bewegen sich ohne festes Ziel durch einen urbanen Raum und schreiben darüber. Sie flanieren – oder?
bewegen und darüber schreiben: „Heute lieber Hose. Heute lieber unsichtbar.“ (Mirjam Aggeler), „Ich verspeise die Stadt“ (Halina Mirja Jordan), „Flanieren heißt sich um nichts zu kümmern.“ (Anke Stelling), „Ich versuche so zu tun, als liefe ich hier jeden Tag lang.“ (Leyla Bektaş). Es wirkt, als schiene durch alle diese Sätze eine Art gemeinsames Bedürfnis hindurch, zunächst einmal Aussagen zu treffen, Fragen zu stellen, prägnante Sentenzen zu finden, um etwas zu umreißen, das bisher in der kulturellen Repräsentation nicht vorgesehen war: Menschen, die nicht männlich, weiß, cis und straight sind, bewegen sich ohne festes Ziel durch einen urbanen Raum und schreiben darüber. Sie flanieren – oder?
 Bekannten sind selten Quell der Befriedigung und der erfüllenden Ekstase, sondern meist der erzwungene Versuch, dem ätzenden Alltag eine verbotene, rauschhafte Alternative gegenüberzustellen. Entscheidend ist, dass der Versuch hilflos bleibt. Die Grundausrichtung des Romans mit einer Frau, die aus den familiären Zwängen ausbricht und ihre Sexualität heimlich und verboten auslebt, könnte die Basis für eine Emanzipationsgeschichte sein. Adèle jedoch begibt sich von einem Gefängnis in das nächste. Was sie nicht findet, sind Vergnügen und Freiheit.
Bekannten sind selten Quell der Befriedigung und der erfüllenden Ekstase, sondern meist der erzwungene Versuch, dem ätzenden Alltag eine verbotene, rauschhafte Alternative gegenüberzustellen. Entscheidend ist, dass der Versuch hilflos bleibt. Die Grundausrichtung des Romans mit einer Frau, die aus den familiären Zwängen ausbricht und ihre Sexualität heimlich und verboten auslebt, könnte die Basis für eine Emanzipationsgeschichte sein. Adèle jedoch begibt sich von einem Gefängnis in das nächste. Was sie nicht findet, sind Vergnügen und Freiheit.






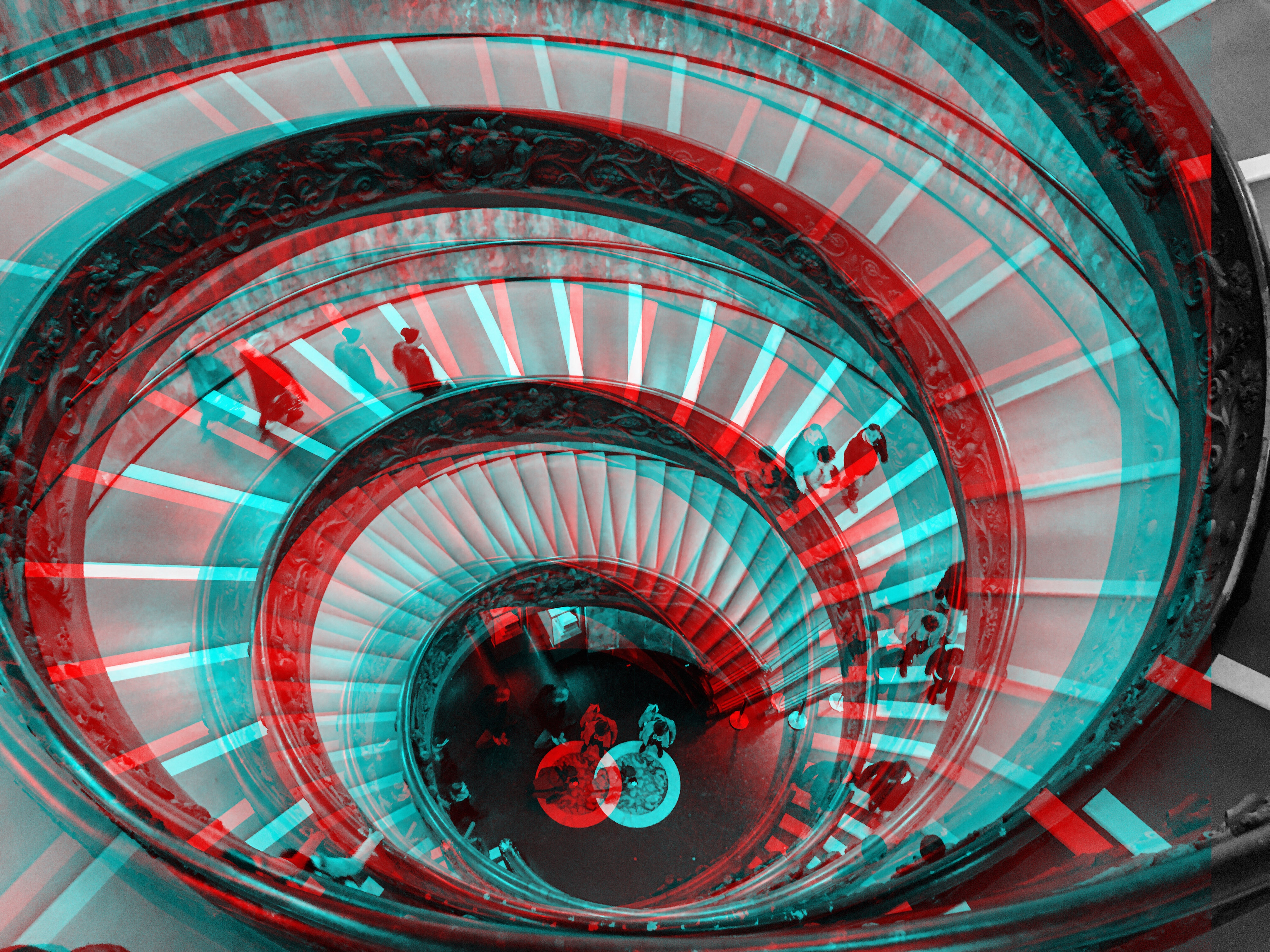
 so zu er
so zu er

