Es bleiben dennoch einige Dilemmata bestehen. Zum einen ist es der von dir benannte Vergleich mit dem Original, der oftmals schon an den begrenzten Sprachkenntnissen eines jeden Kritikers scheitert. Zum anderen ist es der Aspekt der »professionellen Pragmatik«, will man nicht bei einer Kurzkritik des wunderbaren Romans »Horcynus Orca« von Stefano d’Arrigo in ein völlig abwegiges Aufwand-Nutzen-Verhältnis rutschen. Wie geht man mit solchen Missverhältnissen im Alltag bestenfalls um?
Ein Kritiker sollte die rhetorisch auffälligen Merkmale eines Textes – Erzählstil, Erzählstimme, Techniken und so weiter – benennen können, unabhängig davon, ob er den gesamten Roman oder nur einen Teil gelesen hat. Diese sind in der Übertragung aber auf Techniken zurückzuführen, die der Übersetzer angewandt hat. Statt vom Autor sollten Kritiker daher besser vom Übersetzer sprechen, wenn sie einen Text auf der stilistischen Ebene bewerten. So würden sie auch transparent machen, dass es noch eine vermittelnde Stimme zwischen Autor und Leser gibt und das erforderliche Moment an Skepsis gegenüber der Übertragung berücksichtigen. Nur im Wissen um diese Vermittlungsinstanz kann sich jeder Leser selbst ein Bild machen, ob er die Stimme des Autors wiedererkennt oder eine neue – adäquate oder inadäquate – Stimme des Übersetzers wahrnimmt. Journalisten könnten aber auch ruhig mal an uns Übersetzer herantreten und uns zur Übersetzung befragen. Wieland Freund von der Literarischen Welt hat sich mit mir wiederholt über Wallace und die Herausforderungen der Übersetzung unterhalten. Das ist meiner Meinung nach absolut legitim und beweist nur journalistische Sorgfaltspflicht. Uns Übersetzenden bleibt zuletzt das Mittel, Nachworte zu unserer Arbeit zu schreiben, in denen wir uns selbst ins Rampenlicht stellen und über die Herausforderungen der konkreten Übertragung sprechen können.
Was du zuerst gefordert hast, dass man nicht mehr vom Autor, sondern vom Übersetzer sprichst, würde die Literaturkritik ein Stück weit revolutionieren.
Ja, aber warum nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir Übersetzenden damit eine Position für uns usurpieren, die uns nicht zusteht. Ich würde ja niemals behaupten, dass mir eine Erzählung, ein Sujet oder die Plot-Entwicklung zu verdanken ist. Aber das, was wir daraus bei der Rekonstruktion machen, das könnte in den Kritiken auf den tatsächlichen Urheber zurückgeführt werden.
Beeinflussen dich Kritiken gleich welcher Art in deiner Arbeit?
Ich kann mich davon nicht völlig frei machen. Ich bin ein- oder zweimal richtig verrissen worden, das ist zum Glück viele Jahre her. Das ging mir damals richtig nah, weil ich das Gefühl hatte, vor tausenden Menschen demontiert worden zu sein. Inzwischen lese ich Kritiken sehr selektiv beziehungsweise diagonal. Ich freue mich bei wirklich komplexen Kritiken. Als »The Pale King« von Wallace noch gar nicht übersetzt war, hat Clemens Setz in der FAZ einen wahnsinnig guten Rezensionsessay geschrieben, der mich sehr begeistert hat. Ich stand kürzlich mit ihm in Kontakt, und natürlich kennt er auch Cohens Werk. Er habe sogar versucht, »Witz« zu lesen, erzählte er, sei daran dann aber gescheitert. Er scheint mir ein wahnsinnig belesener Autor zu sein, der sich in der angelsächsischen Literatur bestens auskennt und dann auch noch ansteckend darüber zu schreiben versteht. Rezensionen wie die von Setz, die eher essayistischen Charakter haben, die lese ich wahnsinnig gern, weil sogar ich dann immer noch etwas über die Bücher erfahre, die ich selbst gelesen und übersetzt habe. Die eher abstrakten Rezensionen lese ich kursorisch natürlich auch, um die Rezeption meiner Übersetzung zu erfassen und mir Einzelbeispiele der Übersetzungskritik noch einmal anschauen zu können.
Wobei die bewusste Übersetzungskritik zuweilen in eine Art Egotrip der Autoren oder in Buchfledderei ausarten kann, bei der Kritiker anhand von zwei willkürlich bewerteten Einzelsätzen eine Übersetzungsleistung bemessen.
Das kann ich für mich nicht bestätigen, aber ich kenne Kollegen, die das beklagen. Bei der Übersetzungskritik scheint mir oftmals aus dem Auge zu geraten, dass man sich als Übersetzer seine Gedanken macht, warum man Passagen so und nicht anders übersetzt. Natürlich wird auch abweichend vom Original übersetzt, meist gibt es dafür aber auch werkberechtigte Gründe. Ein typisches Beispiel ist der Umgang mit Wortspielen, die man nicht in jedem Fall erhalten kann. Wenn man an einer Stelle ein Wortspiel verliert, weil es in der Übersetzung einfach nicht umsetzbar ist, neigen Übersetzer dazu, an anderer passender Stelle ein ausgleichendes Wortspiel einbauen. Dann sagt der Kritiker, der das natürlich nicht in Relation setzt und setzen kann, dass sich die oder der Übersetzende eine Eigenmächtigkeit herausgenommen hat. So ein schnell gesprochenes Urteil lastet dann auf dem ganzen Text.
Der renommierte Shakespeare-Übersetzer Frank Günther berichtet in einem Essay über Amazon-Rezensionen, wie er mit viel Aufwand den von Shakespeare intendierten falschen Sprachgebrauch rekonstruiert hat. Und was sagen die Amazon-Leser? »Der Übersetzer kann kein Deutsch!« So etwas nervt natürlich, vor allem, wenn derartig pauschale Vorurteile bei Profikritikern vorkommen und diese nicht merken, dass sich der Übersetzer etwas dabei gedacht hat. Ich selbst habe mal davon gesprochen, dass es darum geht, das Falsche richtig zu übersetzen. Diese Intention müssen Kritiker zu erkennen fähig und willens sein.
Neben hochliterarischen Werken wie Wallace’ »Unendlicher Spaß«, Cohens »Witz« oder »Der Garten der Dissidenten« von Jonathan Lethem übersetzt du auch gern im Team, zuletzt etwa die »Signifying Rappers« von David Foster Wallace und Mark Costello oder den bereits angesprochenen Tschetschenien-Roman »Die niedrigen Himmel« von Anthony Marra. In beiden Fällen hast Du mit jungen Kolleginnen zusammengearbeitet. Was reizt dich an solchen Kooperationen?
Mit Maria Hummitzsch und Stefanie Jacobs wollte ich einfach diese Bücher machen, und andere Projekte mit ihnen kommen noch. Bei der Übersetzung von Marra kam es übrigens zu einem Paradebeispiel der konstruktiven Kritik, weil ein Rezensent in einem Brief an den Verlag seinen Unmut über einige Übersetzungsentscheidungen begründete; und er hatte mit fast allem Recht. Aber zurück zur Frage: mir geht es grundsätzlich darum, junge und talentierte Übersetzende, die mir auf verschiedenen Wegen begegnen, in Jobs zu bringen. Hannes Meyer gehört zu diesen wunderbaren Nachwuchsübersetzern; er hat im letzten Herbst Phil Klays Erzählungen »Wir erschossen auch Hunde« für Suhrkamp übersetzt. So etwas freut mich, weil er mit seinen Übersetzungen zuvor nicht so glänzen konnte, da es ihm an einem Autor dieses Formats gefehlt hat. Ich hoffe, dass das auch der Verlag zur Kenntnis genommen hat und er weitere solcher Aufträge bekommt. Was die Förderung und Unterstützung von Nachwuchsübersetzerinnen und -übersetzern betrifft, bin ich ein großer Idealist. In einer Kolumne zur Nachwuchsförderung habe ich beschrieben, dass mir immer wieder das Argument begegnet ist, dass dem von mir empfohlenen Nachwuchs die Erfahrung der Übersetzung anspruchsvoller Werke fehle. Da kann ich nur sagen: wenn sie nie die Chance bekommen, ein anständiges Werk zu übersetzen, dann können sie auch nicht besser werden. Lektoren und erfahrene Übersetzer müssen meines Erachtens gemeinsam Entwicklungschancen für die nächste Generation der Übersetzenden entwickeln und ihnen das Handwerkszeug beibringen.
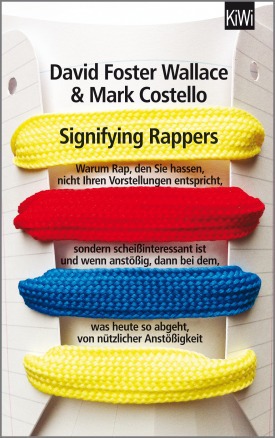
Gibt es unter Übersetzerinnen und Übersetzern viele Ressentiments oder herrscht da eher eine solidarische, schicksalhafte Verbundenheit?
Das ist komischerweise sprachabhängig. Die Englischübersetzer sind verhältnismäßig kollegial, hilfsbereit und loyal, weil der Markt so groß ist. Je kleiner die Marktpräsenz einer Sprachgruppe aber wird, desto umkämpfter ist das Feld. Hinsichtlich der Nachwuchsförderung habe ich mich in der Vergangenheit auch mit dem ehrenamtlichen Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Übersetzerfonds e.V. (DÜF) Thomas Brovot und mit dem 1. Vorsitzenden des Verbands deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke e.V. (VdÜ) Hinrich Schmidt-Henkel unterhalten. Beide übersetzen aus im Vergleich zum Englischen kleinen Sprachen und waren tendenziell zurückhaltend, als es darum ging, das eigene Replacement durch den Nachwuchs vorzubereiten. Ich als Übersetzer aus dem Englischen muss da keine Angst vor Konkurrenz haben, da der Markt groß genug ist. Übersetzende aus den kleineren Sprachen finden sich aber in einer anderen Situation.
Wie würdest Du die Situation auf dem Markt im Moment bezeichnen, was das Verhältnis von erfahrenen und Nachwuchsübersetzern betrifft?
Lektoren gehen eher auf Nummer Sicher und wählen die 50-jährigen, erfahrenen Übersetzer, statt ihrerseits konsequent eine Nachwuchsförderung zu betreiben. Nach uns, den aktuellen Fünfzigern, klafft aber eine riesige Lücke, und absehbar laufen wir einer Katastrophe entgegen, denn mit siebzig Jahren werden auch wir den Staffelstab weitergeben wollen. Und wenn dann kein Nachwuchs da ist, dann stehen die deutsche Literaturszene und die deutschsprachigen Verlage dumm da. Das zu verhindern, ist Aufgabe von Übersetzern und Verlagen, auch wenn Übersetzer dabei in die schizophrene Lage geraten, möglicherweise an ihren eigenen Stühlen zu sägen.



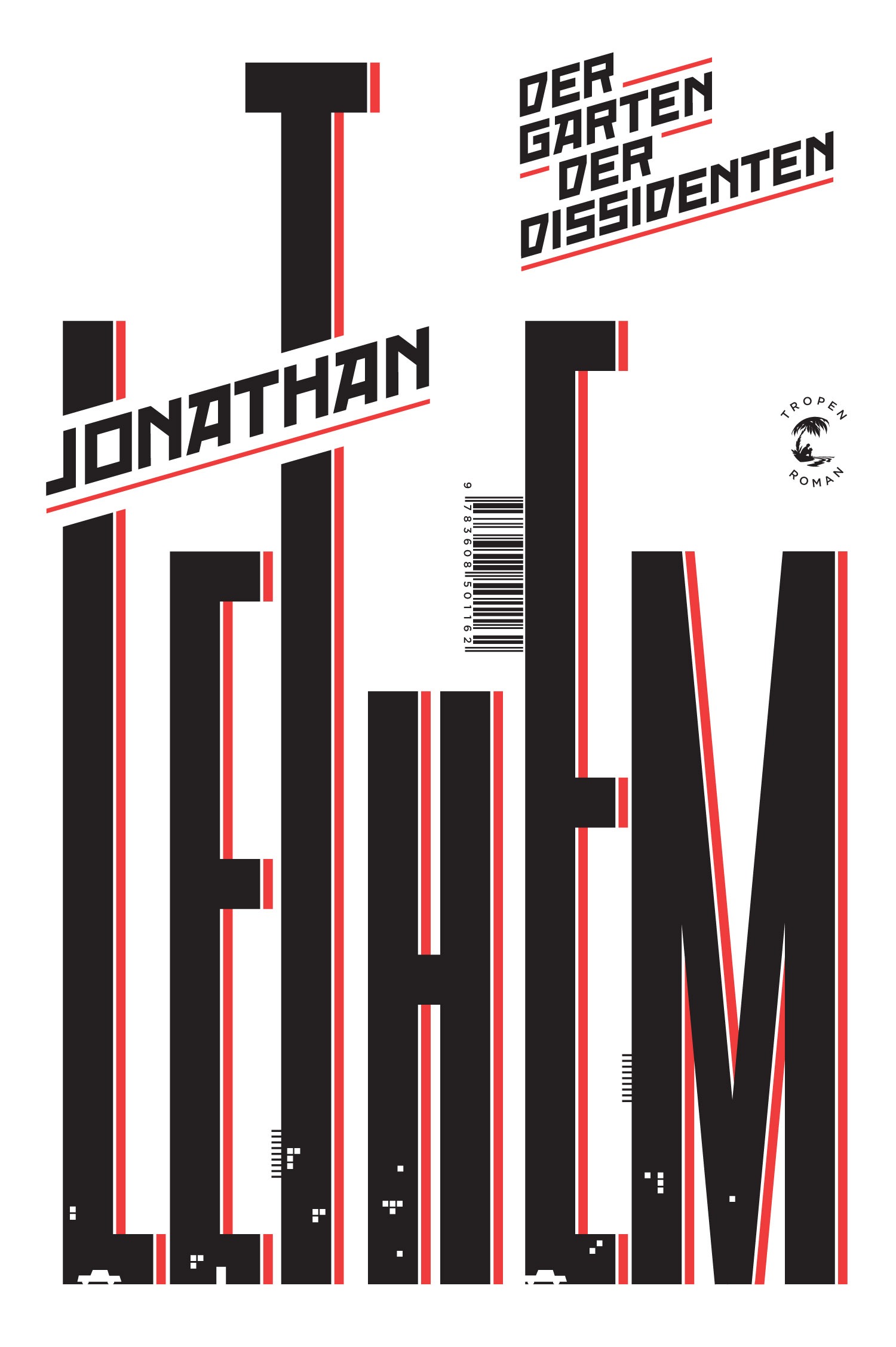
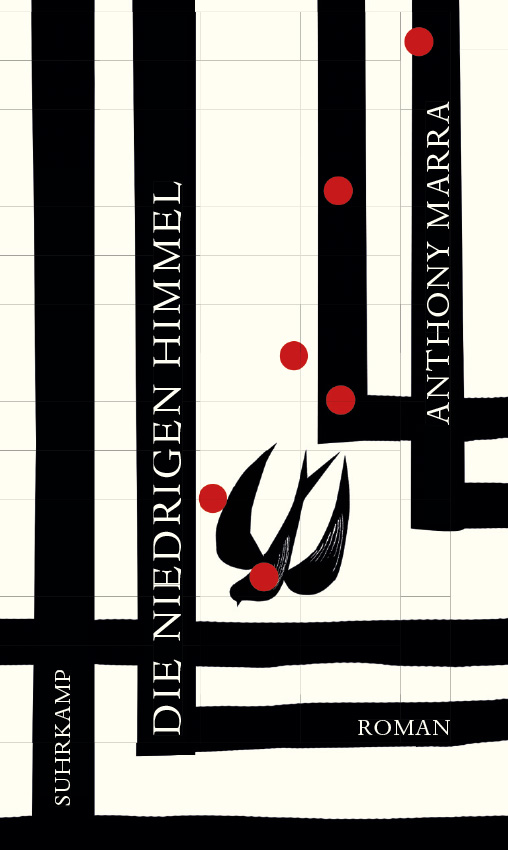
[…] Die Geheimniskrämerei um seine Person erinnert an die Mythen, die an Namen wie Thomas Pynchon und David Foster Wallace geknüpft sind. Wie wir dort von den zwei ehrgeizigen Leserforschern Eric und Jen erfahren, […]
[…] Der Traum von ewiger »Pralinen-Prosa« […]
[…] ist kein Zufall, dass der renommierte und mit dem Leipziger Übersetzerpreis bereits ausgezeichnete Ulrich Blumenbach im Gespräch die Kenntnis der Originalsprache bei Rezensenten und Lektoren einforderte, »denn erst dann können […]
[…] zuvor ein gewisser George Lucas mit dem ersten Star Wars-Film die Messlatte weit nach oben schob. David Foster Wallace schrieb in dem Essay »David Lynch bewahrt kühlen Kopf«, dass der Film dennoch wegweisend für […]
[…] sie, die Wirklichkeit, selten so gut eingefangen, wie in Pynchons komplexen Welten, der noch vor David Foster Wallace und Don DeLillo als die Ikone der postmodernen amerikanischen Literatur gilt. Dass er seit 1953 die […]