Kommen wir zurück zu deinen Übersetzungen. Offenbar tun es dir auch Klassiker an, ob Agatha Christies »16 Uhr 50 ab Paddington«, Anthony Burgess »Clockwork Orange« oder Jack Kerouacs Hipsterbibel »On the Road«. Was reizt dich an einer Neuübersetzung?
Ganz ehrlich? Nichts. Ich möchte es nicht mehr machen. Es gibt so viele gute Bücher, die noch nicht übersetzt sind, denen möchte ich meine Zeit widmen. Bislang habe ich auch erst drei- oder viermal einen Roman neu übersetzt. Bei Agatha Christies »4.50 from Paddington« war eine Neuübertragung dringend nötig, weil die alte Übersetzung aus den fünfziger Jahren einfach nur schlecht war, flach und völlig ohne Witz. Bei Kerouac war das etwas anders. Die zweite Übersetzung von 1998 ist tendentiell eher schlecht, aber die erste Übertragung aus den Sechzigern ist verdammt gut. Die hat natürlich historisch bedingt sprachliche Schwächen, etwa wenn eine attraktive Frau noch als »steiler Zahn« bezeichnet wird, aber ansonsten gibt es an der wenig auszusetzen. Für ihre Zeit ist das eine grandiose Übersetzung. Für »Clockwork Orange« gilt das noch mehr. Die zweite von nun insgesamt drei Übersetzungen ist klasse, das musste schlichtweg nicht neu gemacht werden. Deshalb möchte ich mich von Neuübersetzungen eher freihalten und lieber gute neue Gegenwartsliteratur übersetzen.
Das heißt, Solitäre wie James Joyce reizen dich gar nicht?
Doch, aber das meiste ist schon in neuen Übersetzungen erschienen. »Ada oder Das Verlangen« von Nabokov hätte ich zum Beispiel gern neu übersetzt. Natürlich ist es immer noch ein Traum – und bleibt vielleicht einer –, »Finnegans Wake« von Joyce ins Deutsche zu bringen. Was mich reizt und wo ich schon einmal die bisherigen Übersetzer angefragt habe, sind Richard Powers »The Gold Bug Variations«, die ich gern übersetzen möchte. Das kann ich jetzt aber gerade nicht machen, da auch das ein Buch ist, das man nur in ganz kleinen Portionen lesen kann. Pralinen-Prosa nenne ich das, denn jeder Satz ist eine Kostbarkeit. Die Übersetzung hier würde viel Zeit in Anspruch nehmen, da braucht es erst einmal ein überbrückendes Finanzierungsmodell.
Ich kenne Dich als Vielleser und Vielarbeiter. Du sitzt aktuell sicher nicht nur an »Witz«. Woran arbeitest Du gerade noch?
Einiges erwähnte ich ja schon. Neben »Witz« sind es die Essays von David Foster Wallace und die Erzählungen von Anthony Marra.
Was liest Ulrich Blumenbach, wenn er mal nicht übersetzt?
Gar nichts. Ich komme, siehe »Witz«, kaum mit den Büchern hinterher, die ich übersetze. Ansonsten lese ich viel zu viel Feuilletons.
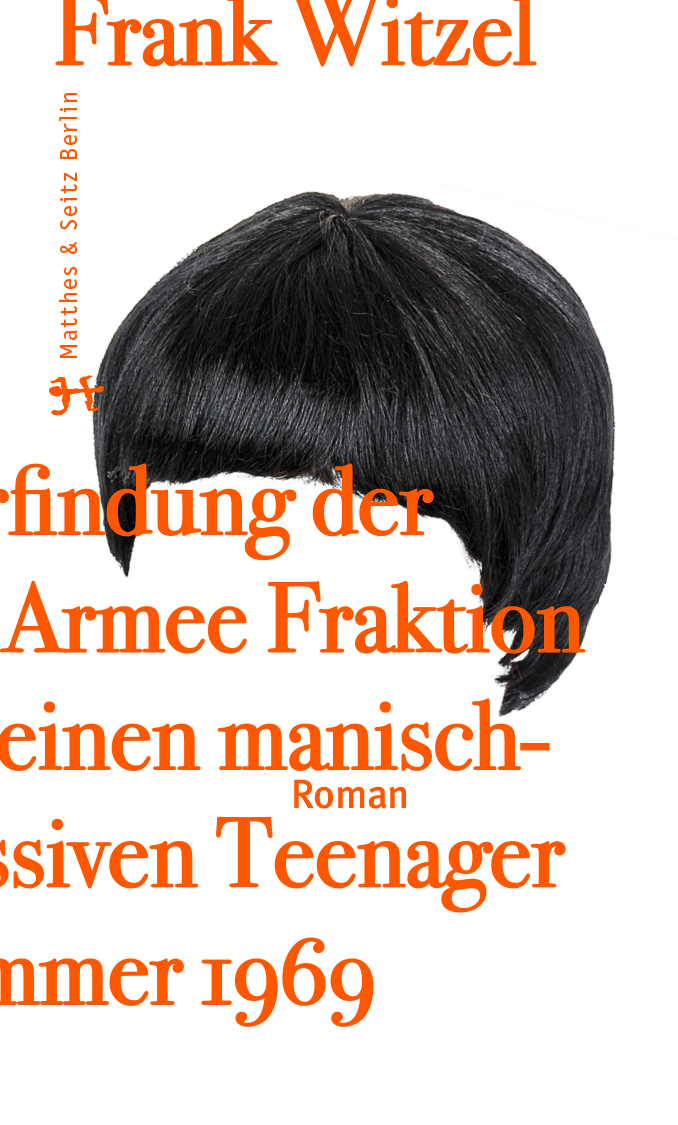
Liest du auch deutsche Literatur?
Wenn ich dazu komme, dann sogar recht viel, um zu sehen, wohin sich die deutsche Literatursprache entwickelt. Wegen der üppigen, neobarocken Sprache möchte ich schon seit Monaten Clemens Meyers letzten Roman »Im Stein« lesen.
Ich lege dir sehr Frank Witzels postmodernes und wie ich finde Wallace-ähnliches Meisterwerk »Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969« ans Herz, in dem der Erzähler zwischen historisierender Sachlichkeit, manischer Theorielastigkeit und der Aufhebung allen Ernstes durch kindliche Naivität changiert.
Das klingt verlockend, aber ganz ehrlich: die 800 Seiten schrecken mich ab. Ich sollte beschließen, ab sofort nur noch 200-Seiten-Krimis zu übersetzen. Nein, kleiner Scherz, aber neben »Infinite Jest«, »The Pale King« und eben jetzt »Witz« habe ich gar nicht so viele dicke Bücher übersetzt; zumal »Der Bleiche König« nur 600 Seiten hat. Aber vielleicht habe auch nur ich solch schräge Relationen.
Wenngleich es einen Unterschied zwischen dem Übersetzen dicker Bücher und gewichtiger Bücher gibt.
Ja, das wäre auch meine Kritik an so mancher Jury, die diesen Unterschied immer mal wieder zu vergessen scheint. Ein dickes Buch muss nicht auch ein gewichtiges Buch sein. Dicke, aber weniger gewichtige Bücher werden eher prämiert als schmale, aber gewichtige Werke. Aber auch letzteres passiert, wie ich selbst schon erlebt habe. Als ich mich 2007 das erste Mal mit »Infinite Jest« um das Zuger Übersetzerstipendium beworben habe, ging es an die inzwischen leider verstorbene Polnisch-Übersetzerin Doreen Daume, die sich mit Bruno Schulz’ Erzählzyklus »Die Zimtläden« beworben hatte. Das Buch selbst hat nur etwas mehr als 200 Seiten [später erschien noch Daumes Übersetzung von Schulz Roman »Das Sanatorium zur Sanduhr«; T.H.] und damals fand ich, dass 50.000 Franken dafür schon eine stolze Förderung sind. Aber klar, Bruno Schulz ist ein gewichtiger Autor und steht mit seinen beiden relativ schmalen Romanen neben Autoren wie Kafka, Proust, Mann und Joyce. Da wurde die Übersetzung eines schmalen, aber überaus gewichtigen Werkes der Übertragung eines Schwergewichts der Gegenwartsliteratur vorgezogen. Etwas Ähnliches hatte ich 2010 auch erwartet. Deswegen hatte ich in Leipzig auch keine vorbereitete Dankesrede, weil ich felsenfest davon überzeugt war, dass der Preis an Hubert Witts Übertragung von Abraham Sutzkevers »Wilner Getto 1941-1944: Gesänge vom Meer des Todes« aus dem Jiddischen gehen würde.
Beim diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse hat nicht Moshe Kahn mit seiner Übertragung von Stefano d’Arrigos »Horcynus Orca«, sondern Mirjam Pressler mit ihrer Übersetzung von Amos Oz’ Roman »Judas« in der Sparte Übersetzung gewonnen. Ein vergleichsweise schmales Werk, was in der Historie des Übersetzerpreises etwas aus der Reihe fällt. Wurde hier auch ein gewichtiges Buch einem dicken Buch vorgezogen?
Ich würde das erst einmal erweitern, denn Miriam Pressler ist nicht nur für die Übertragung von »Judas«, sondern verdientermaßen für ihre Lebensleistung ausgezeichnet worden. Es gibt auch nichts dagegen einzuwenden, wenn ein schmales Werk mit einem hochdotierten Übersetzerpreis ausgezeichnet wird. Ich hätte es im Falle des diesjährigen Übersetzerpreises aber für die bessere Entscheidung gehalten, Moshe Kahn für die Übersetzung von »Horcynus Orca« auszuzeichnen, weil er deutlich mehr investiert und die deutsche Literatursprache weit mehr vorangebracht hat als Mirjam Pressler. Mit der Übersetzung dieses Jahrzehnt-Buchs, mit den Neologismen, Innovationen und Sprachspielen, die er da geschaffen hat, hat Moshe Kahn Einmaliges für die deutsche Literatur geleistet.
Moshe Kahn hat mit seiner Übertragung von Stefano d’Arrigos Lebenswerk eine ähnlich schwierige Zeit hinter sich wie du bei deiner Übersetzung von David Foster Wallace. Als Du 2010 den Übersetzerpreis gewannst, war neben Dir unter anderem Christian Hansen für seine sprachgewaltige Übersetzung von Roberto Bolaños großem Roman »2666« nominiert, dem Du den Preis sicher auch gegönnt hättest. Hast Du eine Idee, wie sehr eine solche Niederlage an einem Übersetzer nagt?
Ich weiß bei Moshe Kahn sehr konkret, was diese Entscheidung bedeutet hat. Er hat für die Übersetzung dieses Romanungetüms enorme finanzielle Belastungen in Kauf genommen, die ein hoch dotierter Preis wie der der Leipziger Buchmesse natürlich zumindest teilweise auffangen kann. Die Entscheidung wird deshalb eine sehr schwierige für Kahn gewesen sein; deutlich schwieriger als für Mirjam Pressler, wenn sie den Preis nicht bekommen hätte. Inzwischen hat er glücklicherweise den deutsch-italienischen Übersetzerpreis und den Jane-Scatcherd-Preis bekommen. Aber das kann natürlich nicht der Maßstab sein, den Eindruck will ich auch gar nicht entstehen lassen. Beim Deutschen Übersetzerfonds e.V. haben wir die Grundregel, Stipendien nicht nach der sozialen Bedürftigkeit der Übersetzer sondern nach den Anforderungen an die Übersetzung zu vergeben. Bei Kahn wird aber wohl kaum jemand daran zweifeln, dass seine »Horcynus Orca«–Übersetzung ebenso preiswürdig gewesen wäre wie Mirjam Presslers »Judas«-Übertragung.
Was noch einmal zu der Frage führt, welchen Ausschlag der Fleiß einer Übersetzung bei der Prämierung haben soll.
Tatsächlich ist das schwer, hier grundsätzlich zu antworten, aber greift man diesen Aspekt heraus, ist dieser bei Kahn ungleich höher – sowohl quantitativ als auch qualitativ. In der besten aller Welten würde man bei der Verleihung von Übersetzerpreisen auch berücksichtigen, was das übersetzte Werk für die Weiterentwicklung der deutschen Literatursprache leistet. Und nur deshalb poche ich so darauf, dass in diesem Jahr »Horcynus Orca« mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung hätte ausgezeichnet werden müssen.
Ulrich, vielen Dank für das Gespräch.
Ulrich Blumenbach ist für seine Übersetzungen des Werks von David Foster Wallace mehrfach ausgezeichnet worden. Gerade hat er die frühen Erzählungen von Truman Capote übersetzt, die im Herbst bei Kein & Aber erscheinen. Für Schöffling & Co. übersetzt er in den nächsten Jahren sukzessive das Gesamtwerk von Joshua Cohen.


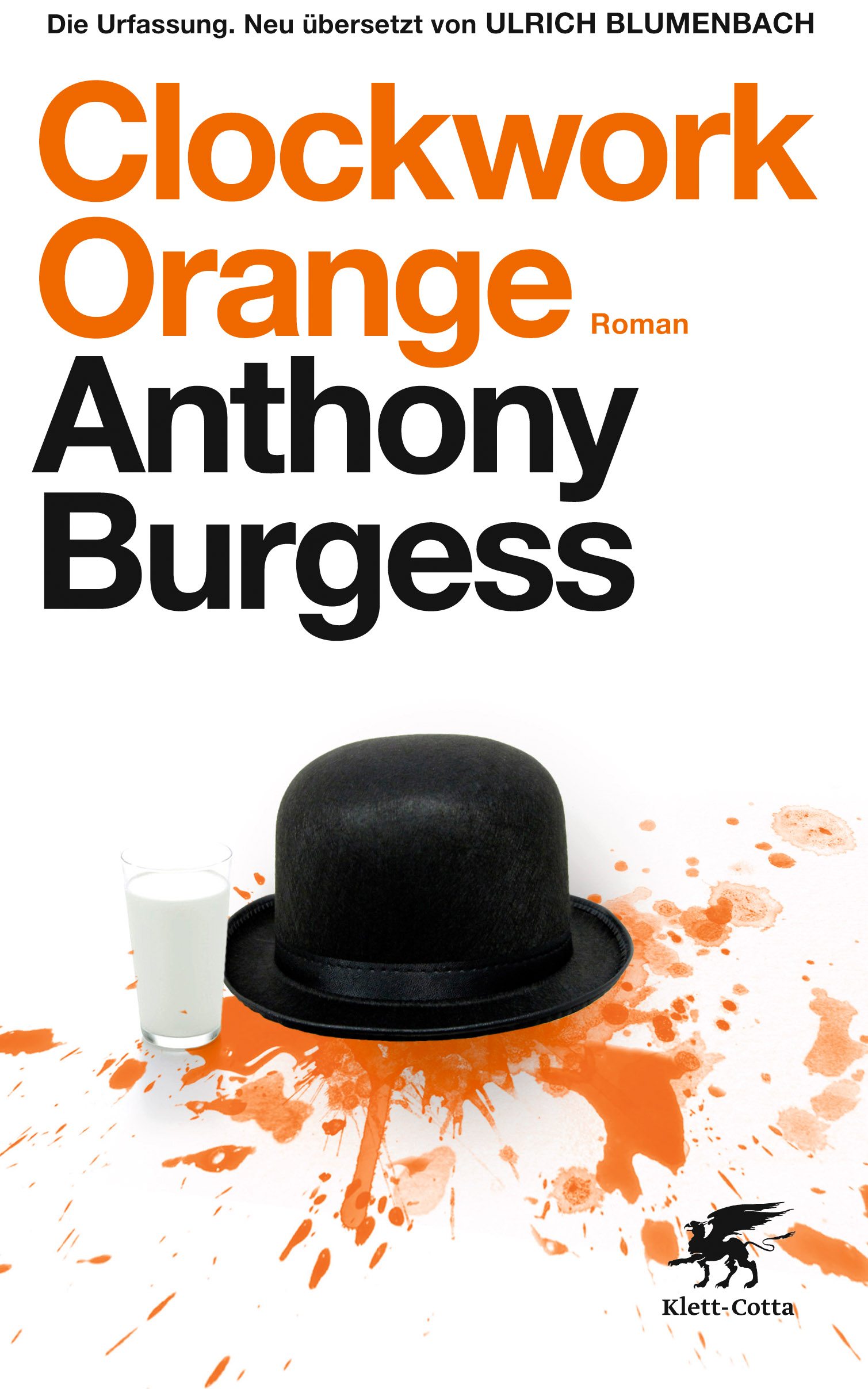
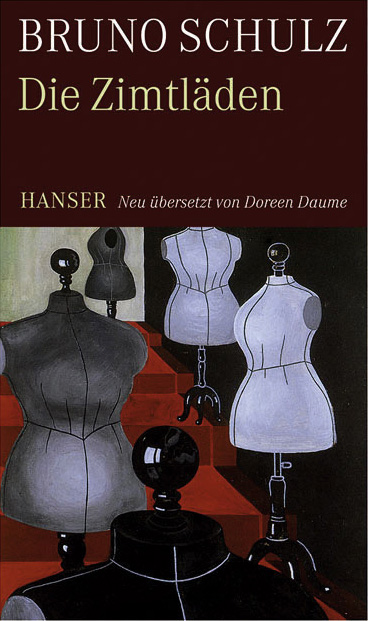

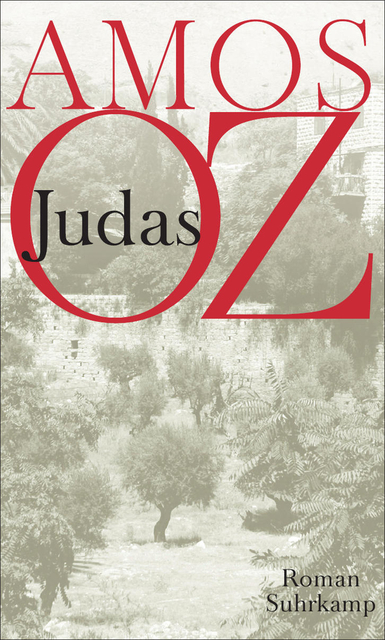
[…] Die Geheimniskrämerei um seine Person erinnert an die Mythen, die an Namen wie Thomas Pynchon und David Foster Wallace geknüpft sind. Wie wir dort von den zwei ehrgeizigen Leserforschern Eric und Jen erfahren, […]
[…] Der Traum von ewiger »Pralinen-Prosa« […]
[…] ist kein Zufall, dass der renommierte und mit dem Leipziger Übersetzerpreis bereits ausgezeichnete Ulrich Blumenbach im Gespräch die Kenntnis der Originalsprache bei Rezensenten und Lektoren einforderte, »denn erst dann können […]
[…] zuvor ein gewisser George Lucas mit dem ersten Star Wars-Film die Messlatte weit nach oben schob. David Foster Wallace schrieb in dem Essay »David Lynch bewahrt kühlen Kopf«, dass der Film dennoch wegweisend für […]
[…] sie, die Wirklichkeit, selten so gut eingefangen, wie in Pynchons komplexen Welten, der noch vor David Foster Wallace und Don DeLillo als die Ikone der postmodernen amerikanischen Literatur gilt. Dass er seit 1953 die […]