Mit diesem Verhältnis zwischen französischen Offizieren und flämischen Soldaten erzählen Sie am Rande ein Stück Emanzipationsgeschichte von Flandern.
Das ist sehr komplex, weil hier immer die Frage nach dem Nationalen aufkommt. Aber wer war das flämische Volk? War das ganz Belgien oder nur Flandern? Tatsächlich hat der flämische Nationalismus in den Schützengräben begonnen, weil es die flämischen Soldaten nicht mehr ertragen haben, von den französischen Offizieren angebrüllt zu werden. Ihnen fehlte der Respekt gegenüber ihrer Kultur und Sprache, entsprechend radikalisierten sie sich und fanden eine Art Nationalismus. Ich glaube, dass auch das flämische Bewusstsein meines Großvaters mit dem Krieg begonnen hat. Dieser innere Widerstand gegen die französischen Offiziere muss in hohem Maße zu Schizophrenie geführt haben, auch bei meinem Großvater. Am Ende hat er, meine ich, nur für sich selbst gekämpft, für seine Moral. Ohne Nationalismus, aber aus Pflichtgefühl. Ein Jahr vor seinem Tod wurde er wegen seiner Verdienste im Krieg vom belgischen König zum Ritter geschlagen. Die Urkunde hat er in einen Umschlag gesteckt und auf dem Dachboden versteckt; wir haben sie erst Jahre später gefunden. Sein Pflichtgefühl galt keiner Nation, sondern nur ihm selbst. Im Grunde war er emotional ganz allein in den Gräben.
Die Dreiteilung Ihres Romans hat etwas Ikonisches, erinnert an ein Triptychon, ein Altarbild. Ist Ihr Großvater für Sie ein heiliger Mann?
In der Tiefe ist der Roman tatsächlich eine leichte Parodie auf eine Hagiographie, das haben Sie gut erkannt. Einer meiner ersten Arbeitstitel lautete »Der kleine heilige Martinus im großen Krieg«. Indem ich den Roman so aufgebaut habe, wurde ich selbst auch ein Kopist. Ich kopiere meinen Großvater als Künstler und fertige ein Altarsstück an: der heilige Martinus in seiner Kindheit – der heilige Martinus als Soldat – der heilige Martinus in der Wüste. Diese ganze katholisch-ikonografische Schicht ist in meinem Roman angelegt.
Sie werden also zum Nachahmer ihres Großvaters, nur dass Sie mit Worten malen.
Ja, aber im Grunde sprechen wir permanent miteinander. Denn beim Schreiben habe ich gemerkt, dass mein Großvater ein literarisches Talent hatte. Wenn er beschreibt, wie die Aale über das Land zum Meer hin kriechen und sich über die feuchten Wiesen schlängeln – das ist eine zutiefst apokalyptische Szene, in die er alles Grauen des Krieges packt. Die Tiere fliehen vor der im Schlamm versinkenden Kriegsmaschinerie und lassen die Menschen allein zurück. In diesem Bild steckt doch der Gedanke, dass es mit allem zu Ende geht.
Was haben die Aufzeichnungen Ihres Großvaters bei Ihnen persönlich ausgelöst?
Sie haben mich mit meiner Abstammung versöhnt. Ich entstamme der Post-68er-Generation, habe Free-Jazz gespielt, eigenen Pott geraucht, die Frankfurter Schule entdeckt. Das ist meine Generation. Neben meiner linken Militanz war da aber auch immer die Seite der caritas catholica. Ich war einer der jetzt so verabscheuten Linken, die auch über Empathie und Einfühlung sprachen. Das war linker Humanismus, dessen Ursprünge von meinen Ahnen kamen. Ich habe, um es anders zu sagen, gelernt, meine eigene Heteronomie zu entdecken. Ich habe mich nicht selbst gemacht, sondern bin von anderen zu dem gemacht worden, der ich heute bin. Das habe ich erst mit diesem Buch verstanden; es hat mich bescheidener gemacht.
Sie schreiben mit einer großen Zärtlichkeit von der Verehrung, die Ihr Großvater seinem Vater hat zukommen lassen. Hat sie das Schreiben über dieses Verhältnis etwas mit Ihrem Verhältnis zu Ihrem Vater, das sie als komplizierter beschreiben, etwas versöhnt?
Meine Eltern waren einfache katholische Menschen, aber sehr tolerant. Ich kann mich erinnern, dass ich in den 80er Jahren wie Jimmy Hendrix aussah und in der Kirche immer alle über mich tuschelten. Mein Vater nahm mich dann zur Seite und sagte, dass er immer stolz auf mich sein werde. Das hat mich sehr berührt. Es gab daher nicht so viel zu versöhnen, was meinen Vater betrifft. Aber ich glaube, dass das Buch mich mit meiner Herkunft und meiner Familie allgemein versöhnt hat. Denn natürlich habe ich meine Eltern mit Nietzsche und dem Abgesang auf Gott und die Kirche verletzt. Dazu kommt, dass mein Vater ein schwieriges Verhältnis zu seinem Schwiegervater hatte. Deshalb glaube ich auch, dass er etwas eifersüchtig war, als er merkte, dass ich ein Buch schreiben werde, in dem mein Großvater ein Held ist. Aber er hat mir als letzter Zeuge sehr geholfen, deshalb habe ich ihm dieses Buch auch gewidmet.
Es widerspricht der Bescheidenheit Ihres Großvaters, dass Sie ihn nun zum Helden machen. Würde ihm das Buch gefallen?
Ich glaube, er wäre sehr empört, weil ich seine erotischen Geheimnisse und seine künstlerische Sehnsucht verraten habe. Manchmal denke ich aber auch, dass er vielleicht auch ein wenig stolz wäre, dass man seine Geschichte jetzt auch in Amerika oder China lesen kann. Wahrscheinlicher aber ist, dass er von dem Rummel um seine Person überfordert wäre. Er wollte nie im Mittelpunkt stehen.
Vor »Der Himmel meines Großvaters« haben Sie vor allem Essays und Lyrik veröffentlicht. Wie geht es für Sie jetzt weiter?
Ich habe gerade einen Roman beendet, der im kommenden Frühjahr erscheinen wird. Es ist eine Geschichte über eine Proselytin, eine Christin, die sich in einen Juden verliebt und mit ihm 900 Kilometer in ein Dorf in der Provence flieht. Ihr Vater verfolgt sie mit seinen Truppen, um sie auf dem Scheiterhaufen büßen zu lassen. Sechs Jahre nach der Flucht ziehen die Kreuzfahrer durch das Land und meucheln alle jüdischen Bewohner. Ihr Mann wird ermordet, ihre Kinder von den Kreuzfahrern verschleppt. Sie flieht mit dem Brief des örtlichen Rabbiners in der Tasche, in dem er alle Juden der Welt bittet, ihr zu helfen. Diesen Brief hat man mit 250.000 anderen Manuskripten aus der Synagoge in Kairo gefunden.
Wie sind Sie zu dieser Geschichte gekommen?
In dem Dorf, in dem sich all das abgespielt hat, habe ich seit Jahren ein kleines Haus, im letzten Jahr habe ich dort die Ruinen der Synagoge wiedergefunden. In meinem Roman erzähle ich nun die verdrängte Geschichte dieses Ortes sowie die der Frau, die über Palermo und Alexandria bis nach Kairo floh. Diese Geschichte ist so modern, dass sie sich ebenso gut in unseren Tagen ereignen könnte. Meine Hauptfigur ist ein Boatpeople ihrer Zeit.
Ich bin gespannt, diese Geschichte zu lesen. Stefan Hertmans, vielen Dank für das Gespräch.
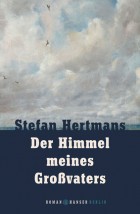 Stefan Hertmans: Der Himmel meines Großvaters
Stefan Hertmans: Der Himmel meines Großvaters
Aus dem Niederländischen von Ira Wilhelm
Verlag Hanser Berlin 2014
320 Seiten. 21,90 Euro
Hier bestellen


[…] »Der kleine heilige Martinus im großen Krieg« (Thomas Hummitzsch, 30. August 2016) In Brüssel hatte Thomas die Möglichkeit, Stefan Hertmans zu interviewen, einen der wichtigsten niederländischsprachigen Autoren der Gegenwart. Schwerpunkt des Interviews ist der Roman Der Himmel meines Großvaters, der im Herbst 2013 in Flandern zum Bestseller avancierte und im Jahr darauf bei Hanser in deutscher Übersetzung erschien. […]
[…] und Jan Cleijne gefeierte Lyrikerinnen und Lyriker wie Anneke Brassinga, Ilja Leonard Pfeiffer oder Stefan Hertmans. Einige Illustratoren bleiben mit ihren Zeichnungen recht nah an der poetischen Vorlage, andere […]