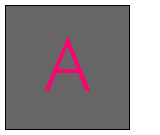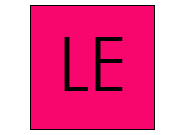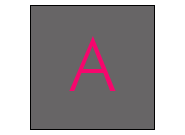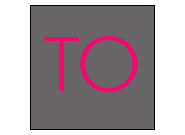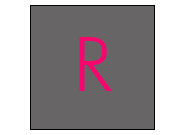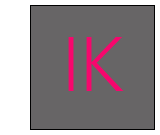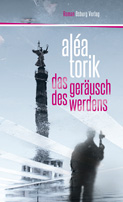Hier also das Interview, das ich auf aboutsomething gegeben habe.
1) Katja zu Fiktion vs. Wirklichkeit: Ein zentrales Thema Ihres Buches ist der Wirklichkeitsbegriff, nach dem Sie gleich zu Beginn (S. 23) fragen: „Wenn alle Wirklichkeit nur Konstruktion ist, können wir dann mutwillig alles konstruieren?“ … „Wirklichkeit ist, was wir dafür halten, was wir konstruieren.“ (S. 22) Die „neue“ Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts ist jene des Netzes und ihrer radikalen Projektionen. Ihr Wirklichkeitsbegriff bezogen auf die digitale Realität sagt aus, dass alles um unsere Identität herum konstruiert sei. Kann man daraus eine moralische Frage ablesen? Was ist dann mit denjenigen, die sich der virtuellen Wirklichkeit verweigern, keinen Blog haben und nicht per Facebook kommunizieren? Ist denn mit dieser Weigerung eine fundamentale Lebensverweigerung gleichzusetzen, da ich mich quasi dieser virtuellen Realität entziehe und in ihr nicht stattfinden will? Ist es überhaupt möglich, sich dieser zu entziehen, wenn man „vollwertig“ an der Realität partizipieren will?
Aléa Torik: Bevor ich die Frage beantworte, will ich mich für die Gelegenheit bedanken, mich zu meinem Text äußern zu können. Da ich nicht einfach nur einen Roman geschrieben habe, den man an vielen Orten rezensieren, erörtern oder befragen könnte, sondern einen Roman über eine Person, die über Jahre ein literarisches Blog im Netz führt, ein Blog, das es wirklich gibt; da ich gewissermaßen das Blog und den Roman zu einer Einheit verwebe, empfinde ich andere literarische Blogs geradezu als erste Adresse für eine Auseinandersetzung mit dem, was ich da gemacht habe. Ich war verwundert, vielmehr verärgert, weil es zwar viele Reaktionen seitens des Feuilletons gab, aber kaum ernstzunehmende aus der Bloggerszene – bis auf eine einzige Ausnahme, das Blog Aisthesis, wo beide Romane besprochen wurden und auch darüber hinaus versucht wird, dem Phänomen Aléa Torik eine Position in der Literatur zuzuweisen, hier, geschweige denn eine richtige Auseinandersetzung, wie sie hier offenbar stattgefunden hat. Das ist an Ihren Fragen zu erkennen, die vor allem um das Netz kreisen. Das hat bisher noch niemand so deutlich angesprochen und thematisiert. Weil das aber im Grunde der wesentliche Umstand meines Romans ist, antworte ich sehr ausführlich.
Der Roman ist der Versuch eine moderne Wirklichkeit zu beschreiben, in der das Netz eine wesentliche Rolle spielt. Also nicht das Netz selbst und auch nicht die Tatsache, dass wir bisweilen mal im Netz ein Buch bestellen oder eine Email schreiben. Ich meine, wenn ich von Netz rede, den fundamentalen Bruch in einem Gewebe namens Wirklichkeit durch den Cyberspace.
Ich frage gleich zu Beginn des Romans nach Wirklichkeit, sogar noch vor der zitierten Stelle. Die Autorin und Protagonistin dieses Romans, Aléa Torik nämlich, sitzt in der Bibliothek, im Lesesaal des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums in Berlin vor ihrem Rechner und schreibt nach Das Geräusch des Werdens an ihrem zweiten Roman. Dann schaut sie an die Decke und sieht eine Frau durch eines der Oberlichter durch die zwanzig Meter hohe Halle fallen und „mit einem entsetzlichen Geräusch“ unten auf den Boden aufschlagen. Die einzige Reaktion Aléas darauf sind einige Gedanken darüber, ob das wirklich geschehen ist. Jeder andere würde wohl erst einmal zu Hilfe eilen und sich danach Gedanken über die ontologische Wertigkeit machen. Man kann vermuten, dass dieses Ereignis lediglich in ihrer Fantasie stattgefunden hat, vielleicht weil das in ihrem Roman geschehen könnte. Oder weil sie eben Dinge sieht, die nicht wirklich geschehen. Sie hat möglicherweise eine kleine psychische Auffälligkeit. Das wird später durch das Motiv des Verfolgungswahns auch noch ausgebaut.
Das darauffolgende Kapitel jedenfalls beschreibt das Gespräch zwischen ihr und ihrem Professor Joseph Vogl, bei dem sie zum Thema »Identität, Authentizität und Illusion – Zur Theorie der Fiktionalität« promoviert. Der gibt ihr zu verstehen, dass sie eine unzureichende Auffassung von Wirklichkeit hat. Er selbst stellt dann aber nicht seine eigene Auffassung da, sondern problematisiert das: er hält einen kleinen Vortrag über die Veränderungen des Wirklichkeitsbegriffs in den vergangenen 500 Jahren und sagt, dass eine veränderte Welt auch einen veränderten Begriff von Wirklichkeit braucht. Und er gibt ihr einen Rat für den Roman an dem sie schreibt: »Lassen Sie es doch zu einer Kollision von darstellender und dargestellter Person, erzählendem und erzähltem Ich kommen« (AI, 24) Und genau das macht sie dann auch: Aléa spaltet sich im weiteren Verlauf auf, in erzählende Person und erzählte Figur.
Dieses Gespräch über Wirklichkeit zwischen Aléa Torik und Joseph Vogl stellt sich in der Mitte des Romans als frei erfunden heraus, also Teil ihres Romans, den sie mit einem Gespräch zwischen sich und ihrem Professor beginnen lässt. Und am Ende dieses Romans liegt sie auf dem Boden, erinnert sich an dieses Gespräch und kommt zu folgender Erkenntnis: „Ich denke mir die Dinge bereits aus, während ich sie erlebe. Ich erlebe sie, indem ich sie mir erzähle, indem ich sie in eine narrative Struktur bringe. Ich lege über alles, was meine Sinne aufnehmen, eine Schicht: die fiktive Version eines wie auch immer gearteten, unerkennbaren Wirklichen. Ich weiche in einer Erzählung ein wenig ab, auch wenn ich nicht weiß, wovon ich abweiche. Ich hatte bereits als Kind gelernt, dass man Dinge nicht erzählen kann, ohne sie zu verändern. Gibt es überhaupt einen klaren Trennstrich zwischen den zwei Welten? Oder verschiebt sich das, je nachdem, wer etwas mit welchen Intentionen betrachtet, und der eine tut als Fantasie ab, was der andere als Wirklichkeit abtut? Wer etwas darstellt, der erfindet es bereits, zumindest erfindet er seine Darstellbarkeit. Und darstellen muss man. Denn die Dinge sind, so wie sie wirklich sind, unaushaltbar. Weil sie einfach nur sind. Ohne jede andere Dimension, ohne subjektive Ebene“ (AI, 408).
Ich bin keine Anhängerin des radikalen Konstruktivismus, auch wenn in seinen Positionen vieles steckt, was ich als zutreffend empfinde. Ich versuche lediglich für diesen Roman eine Wirklichkeit zu beschreiben, die sich tatsächlich ganz stark um den Begriff der Identität dreht. Der Professor Aléas – der über seine Rolle in diesem Roman informiert ist -, hat ein sehr interessantes Interview zum Thema Identität im 21. Jahrhundert gegeben, hier. Wer Aléas Ich gelesen hat, kann erkennen, inwieweit Aléa Positionen Vogls anspricht, etwa bei den Wolken; er sagt dort: ‚alles was geschieht oder was nicht geschieht, hat denselben ontologischen Wert‘. Möglicherweise ist Aléas Verhalten bei der durch die Halle fallenden Frau eine Reaktion auf das, was die Doktorandin bei ihrem Professor gelernt hat.
Personelle Identität ist natürlich erst einmal eine körperliche und weil sie das ist, ist sie dann auch eine sexuelle. Indem wir uns als Junge oder Mädchen erfahren, identifizieren wir uns. Identität ist also ein Prozess. Wir identifizieren uns mit Bildern, die uns andere, die uns die Gesellschaft vorhalten. Das verläuft natürlich für jeden anders, der eine identifiziert sich mit einem Selbstbild, indem er Position an- und übernimmt, der andere, indem er sie ablehnt. Ich meine, dass der Aspekt der Konstruktion dabei kaum zu überschätzen ist. In einer Lebenswirklichkeit, in der unsere Erscheinung, unser Körper und unser Gesicht, eine Rolle spielt, wo wir also anwesend sind, sind wir deutlicher an diese Identität gebunden als etwa im Radio, wo die Stimme viel wichtiger wird, weil der Gesichtssinn ausfällt. Im Netz sind wir noch freier, da fallen nahezu alle Ebenen weg, aus denen sich unsere Wirklichkeit sonst zusammensetzt. Ob wir diese Freiheit schätzen oder nicht: wir nutzen sie. Ich will keinen universalen Identitätsbegriff propagieren. Ich glaube, dass das Netz eine andere Wirklichkeit hervorbringt, für die, die sich in ihm bewegen. Mehr nicht. Wer nicht ‚surft‘ muss sich um die vom und die im Netz geschlagenen Wellen auch keine Gedanken machen, er wird in dieser, in der realen Welt untergehen, nicht in der vituellen.
——
2) Katja zu Identität- Figurencharakteristik: Kann man Ihren Roman so verstehen, dass hier eine Figur (Aléa Torik) als Figur über sich selbst als Figur in einem Roman und dessen Entstehung schreibt, die immer wieder reflektiert wird? Es wird sozusagen die Entstehung einer Fiktion vorgeführt und der Leser ist herausgefordert, sich über die Frage nach Identitäten klar zu werden.
Aléa Torik: Es wird die Entstehung einer Fiktion vorgeführt: ja genau so! Zurecht betont die Rezension bei Literaturkritik.de – hier –, dass nicht etwa nach dem Ende der Ereignisse der Held geläutert zurückschaut und seine Entwicklung nachvollzieht; in diesem Roman sind das Ereignis und Beschreibung simultan. Simultaneität ist in der Postmoderne ein wichtiger Begriff, den ich hier nicht in seinen Einzelheiten beschreiben kann. Ich mache das bereits in dem Vorsatz des Textes deutlich, wenn ich den rumänischen Schriftseller Mircea Cărtărescu zitiere: »Der postmoderne Mensch glaubt an keine andere Wirklichkeit als die von ihm selbst erschaffene. […] Phantasie und ›Wirklichkeit‹ befinden sich auf ein und derselben Ebene und überschreiben einander unaufhörlich.«
Der Leser hat ein Buch in der Hand – Aléas Ich – und darin wird eine Person namens Aléa Torik beschrieben, die Schriftstellerin ist und an ihrem zweiten Roman schreibt. Langsam erkennt er, dass er Aléa nicht nur zuschaut, wie dieser Roman entsteht – etwa indem ihn die Autorin über die Ereignisse in dem Text informiert -, sondern das er mittendrin ist in diesen Ereignissen. Er erkennt, dass alles, was geschieht, bereits dieser Roman ist, den Aléa da schreibt. Der Leser sieht also dem Roman beim Entstehen zu, den er als fertigen in Händen hält. Das ist natürlich paradox: der Text muss ja abgeschlossen sein, wenn man das Buch kauft. Was scheinbar Rahmen war, ist tatsächlich das Bild. Über den Rahmen, die eigentliche Wirklichkeit in der das Bild entsteht, weiß der Leser nicht viel und er muss oder soll erkennen, dass er im Grunde gar nichts weiß. Über die Autorin, auch wenn die sich scheinbar selbst thematisiert, weiß der Leser nicht das Geringste.
Auf der ersten Seite sieht er Aléa Torik, die in der Bibliothek sitzt und an ihrem Roman arbeitet und auf der letzten Seite sitzt sie da immer noch: alles dazwischen ist der Text, der, wenn er fertig ist, Aléas Ich heißen soll. Es gibt also sozusagen zwei Romane mit demselben Titel. Es gibt zwei Welten mit derselben Geschichte, aber die eine ist wirklich und die andere fiktiv. Wo die Grenzen, wo die Übergänge dieser beiden Welten liegen, wird nicht deutlich gemacht. Das kann und muss jeder selbst entscheiden. Vielmehr muss man es nicht entscheiden, man erkennt einfach, dass die beschriebene Welt Brüche hat. Und wenn der Mensch nicht völlig versessen ist auf Kontiguität und Kontinuität, dann wird er ebenfalls erkennen, dass die Welt in der er lebt, diese Brüche tatsächlich auch aufweist. Die Welt unserer Identität ist eben keine heile: mal sind wir Autor, Initiator oder Handelnder und mal müssen wir es einfach nur erleben, wir sind lediglich eine Figur in unserer eigenen Geschichte. Und weil wir diese Geschichte nur aus der Ich-Perspektive erleben können, sind wir dort notwendigerweise immer die Hauptfigur.
Diese Konstruktion mutet dem Leser relativ viel zu, nämlich einen ungewöhnlich großen Interpretationsspielraum. Das schreckt manchen auch ab. So schrieb mir eine Leserin etwa: „Achtung das Lesen dieses Buches kann bei sensiblen Menschen zu Realitätsverlust, Wahnvorstellungen bis hin zur Digitalparanoia führen!“ Sie meinte das, wenn ich sie richtig verstanden habe, nicht als Kompliment, sondern als Warnung. Aber für mich war das ein dickes Lob. Ich habe das nicht von Anfang an beabsichtigt, aber als sie mir das schrieb, konnte ich erkennen, dass ich genau diesen Effekt jetzt will.
———-
3) Katja zu Internet-Realität: Sehen Sie das Internet als eine Art zweite Realität oder führt hier die Annahme eines Realitätsbegriffes ins Leere? Ist es sozusagen eine erweiterte Realität unserer materiellen Welt, in der wir sein können, wer wir sind, ähnlich wie Figuren in einem Computerspiel, die wir steuern? Ist im Internet nicht jeder fiktiv und versuchen Sie das in ihrem Roman spielerisch darzustellen, vorzuführen, infrage zu stellen? Denn die Figuren in Ihrem Buch verschwimmen am Ende und es erschien mir beim Lesen so, als sei jede Äußerung der Figur und jeder Charakterzug wiederhol- und austauschbar, alles sei schon einmal so passiert und kann auch jedem passieren, so dass es keine wirkliche Individualität mehr gibt, sondern diese verschwimmt?
Aléa Torik: Ich glaube nicht, dass es eine erste und eine zweite Wirklichkeit gibt, eine vor- und eine nachgeordnete Ebene. Ich meine, dass wir nur eine Wirklichkeit haben, in der sehr vieles Realität gewinnen kann.
In sozialen Netzwerken inszenieren sich alle. Was im Netz ausfällt, die sinnliche Wahrnehmung aus der wir üblicherweise einen Großteil unsere Realität konstruieren, muss kompensiert werden. Wir müssen den Mangel an Sinnlichkeit wettmachen, indem wir, was wir sind, verdichten. Wir wollen im Netz nicht unbedingt schönere oder bessere Menschen sein, wir lügen nicht und führen andere nicht bewusst in die Irre. Wir inszenieren lediglich. Diese Inszenierung ist keine, die die eine oder die andere Seite übernimmt – im klassischen Kommunikationsdesign: Sender oder Empfänger -, sondern das ist eine Leistung die simultan von beiden Seiten erbracht wird. Statt Inszenierung könnte man auch Fiktionalisierung sagen: im Netz ist jeder fiktiv. Wir können wirklich uns selbst meinen, wenn wir ‚ich‘ sagen, aber für die anderen ist das eine Fiktion. Dennoch haben die Dinge im Netz natürlich eine Realität, die Dinge in Büchern haben ja auch Realität. Die virtuelle Realität allerdings hat noch eine andere Macht, die, wie viele imaginäre Dinge, sehr groß sein kann. Man könnte beinahe so weit gehen die Virtualität als Nachfolger der Fiktionalität zu verstehen.
Das Netz als eine Welt „in der wir sein können, wer wir sind“? Nein, das können wir, mit einigen Einschränkungen, in dieser Welt. Im Netz können wir sein, wer wir nicht sind. Vielmehr können wir das nicht, wir sind es einfach. Wir müssen dort sein, wer wir nicht sind. Wir können noch so sehr behaupten, dass wir der- oder dieselbe sind, die wir in der Realität sind. Dass es eine Identität gibt eine Identität zwischen erzählendem und erzähltem Ich. Aber das ist nicht richtig, das ist eben die Fiktion. Und die virtuelle Welt ist keine ideale Welt, weil wir eben dort nicht die sein können, die wir sein wollen, sondern die sein müssen, die wir nicht sind.
Ich versuche in Aléas Ich Realität und Virtualität, indem ich sie nicht gegenüberstelle, sondern miteinander verschmelze, zu beschreiben, teilweise auch zu verstehen, jedenfalls erfahrbar zu machen. Dass die Figuren in dem Roman verschwimmen, war nicht intendiert. Vielleicht ist das bei Ihrer Lektüre ein Produkt jenes Verschwimmens, das ich erreicht habe, indem ich die beiden Welten der Fiktion und der Realität nicht deutlich getrennt habe? Für mich haben alle Figuren eine sehr deutliche Individualität. Aber das sind die Rätsel der Sprache, und gleichzeitig seine enorme Poesie, dass man alles, was im Kleid der Worte daherkommt, mehr oder weniger festlich verstehen kann und für den einen ist schon schick, was für den anderen noch burschikos ist. Bewusst gewollt – wobei das beim Schreiben nur in Maßen möglich ist, etwas zu wollen: Texte haben einen eigenen Bewegungsdrang – war lediglich die Auflösung der Hauptfigur Aléa Torik, sie konfrontiert sich mit ihrer Flugangst, steigt ins Flugzeug und stützt dann auch ab, sie vermischt sich mit den Wolken und den Elementen, mit den Sonnenstrahlen. Und dennoch löst sie sich ja nicht ganz auf: Sie steht ja immerhin hier noch Rede und Antwort. Es löst sich also nur die Figur auf, nicht die echte Aléa Torik!
——
4) Katja zu virtuelle Geburt und virtueller Tod: Wenn die virtuelle Realität eine erweiterte Realität unserer Wirklichkeit wäre, dann hätte es Konsequenzen, das eigene digitale Ich zu ermorden. Ebenso könnte man sagen, es ließe sich ein Charakter, eine Identität erschaffen oder gebären. Beeinflusst diese uns dann in der Wirklichkeit oder führen wir eine Art Parallelleben im Virtuellen? Können wir uns dessen überhaupt noch bewusst sein, da es ja auch „kein Außerhalb unseres Bewusstseins“ geben kann, wie Sie auch schreiben (S. 22)?
Aléa Torik: Das geht mir zu weit! Stirbt das digitale Ich, stirbt nicht das reale. Geboren und gestorben wird vorläufig noch in dieser Welt. Aber einen Vorgeschmack auf dieses Sterben kann jeder bekommen, wenn er oder sie das Netz abschaltet. Nur für eine Woche, als Selbstversuch. Eine Woche kein Netz, keine Mails, keine SMS, kein mobiles Telefon und Bankauszüge am Kontodrucker. Man stirbt nicht daran, aber die Symptome, die man dabei zeigt, sind vermutlich bei vielen digital natives denen ähnlich, die in Entzugskliniken zu beobachten sind.
Es gibt kein Außerhalb unseres Bewusstseins, ja das nehme ich an. Ich bin mir allerdings im Moment nicht sämtlicher Konsequenzen dieser Annahme bewusst. Sagen wir, es gibt kein Außerhalb, aber wir können Kenntnis davon bekommen: durch andere. Indem andere uns erzählen, was ihre Wirklichkeit und was ihr Bewusstsein ist.
——
5) Katjas Feststellung: Nach dem Lesen von „Aleas Ich“ und der Beschäftigung mit Ihrem Blog kam mir der Gedanke, dass Sie mit Ihrem Buch/ Blog auf ein fundamentales Phänomen des Internets aufmerksam machen und dieses sozusagen für die Literatur, das Erzählen nutzen: Analog wie wir eine digitale Identität in Blogs oder Social-Media-Kanälen aufbauen und im Modus unseres „Ichs“, d.h., in einer gewissen Figurenrede agieren, so erschafft der Autor seine Fiktion, seine literarische Wirklichkeit. Würden Sie dem widersprechen oder sehen Sie es so, dass Sie das mit „Aléas Ich“ sozusagen direkt zeigen und dieses Phänomen nutzen und durchleben? Mir scheint, ohne moralische Anklage oder erkenntnistheoretisches Ziel, sondern aus einer rein künstlerischen Perspektive? Schafft das Netz damit ganz neue Möglichkeiten für Autoren und Künstler, mit Identitäten zu spielen und die Fiktion zu beobachten? Oder könnten jetzt Kritiker sagen, jeder, der im Virtuellen agiert, ist ja schon ein Künstler seiner Selbst, da er Identitäten erschafft? Wozu brauchen wir dann noch Literatur und Kunst als solche? Verschwimmt damit die Grenze zwischen bewusster Inszenierung oder einer Darstellung zum künstlerischen Aspekt nicht stark?
Aléa Torik: Die Analogie, die Sie da beschreiben, trifft es genau. Wenn wir im Netz über uns reden, dann machen wir das im Modus der Figurenrede: aus der Ichperspektive. Wir selbst werden zu einer Figur. Das ist es, was ich sagen will, wenn ich davon spreche, dass wir nicht die sind, die wir sein wollen, sondern die, die wir sein müssen. Wir agieren wie Figuren. Wir sind für die anderen fiktiv, weil das Kommunikationsmodell nicht mehr einfach lautet: vom Sender zum Empfänger. Das ist es, was ich in meinem Blog getan, meinetwegen auch inszeniert habe und was im Roman beschrieben wird.
Dieses unidirektionale Kommunikationsmodell ist in Blogs nicht mehr aktiv. Man mischt sich ein. Man versucht, Einfluss zu nehmen. Die ‚Erzählung‘ zu verändern. In einem Blog muss man sich, anders als in einem Buch, nicht nur mit der Rolle des Zuschauers begnügen, sondern man greift in die ‚Handlung‘ ein. Jeder Kommentar ist der Versuch, die ‚Ereignisse‘ den eigenen Absichten gemäß zu beeinflussen. Was passiert, was geschieht ist nicht einzig die Geschichte des Autors, sondern auch die der Kommentatoren In Bezug auf die Aléa Torik, auf die Figur im Netz, heißt das, dass dort nicht nur meine eigenen, sondern auch die Projektionen der anderen virulent werden. Sie erkennen, wenn sie mich erkennen, nicht meine Wirklichkeit, sondern ihre Wunschvorstellungen davon. Wer sich etwa echauffiert, ich hatte aus Marketinggründen gehandelt – weil jung , gutaussehend und blitzgescheit sich auf dem Buchmarkt gut verkaufen lässt -, der echauffiert sich über seine eigenen Projektionen, denn über meine Gründe das zu tun, wusste er ja gar nichts. In Zeiten des Netzes wird deutlicher als je zuvor: wir wissen beinahe nichts über den Autor.
So wie wir uns alle im Netz fiktionalisieren – die faktische Person schafft eine sich selbst ähnliche Figur und nennt sie „Ich“ – arbeiten auch Schriftsteller. In den social media Aktivitäten belässt man es üblicherweise wohl bei der Erfindung dieser einen Figur gleichen Namens. Schriftsteller müssen da einen etwas größeren Figurenkosmos erarbeiten. Man spaltet sich auf in verschiedene Perspektiven, Lebensschicksale, Ideen, Ansichten. Schriftsteller dürfen das. Wenn sie zugeben, dass sie diese Dinge erfunden haben. Das tut man, indem man die Gattungsbezeichnung über den Text schreibt, also etwa „Roman“. Dennoch werden Autoren immer wieder gefragt, ob sie, was sie in ihren Texten beschreiben, tatsächlich auch erlebt haben. Der Leser will nämlich, dass man das Erfundene legitimiert, indem man es als echt, als wirklich erlebt herausstellt. Im Modus des ‚falschen‘ unterstellt man, dass nur das Authentische ‚echt‘ ist.
Ich wollte diese Weise, wie der Begriff Identität sich durch das Netz verändert und wie wir uns dabei verändern, darstellen. Eines aber will ich definitiv nicht, eine moralische Bewertung. Die läge vollständig außerhalb meiner Kompetenzen. Ich klage niemanden an, weil er sich im Netz so verhält. Klage ist eine literarische Gattung, die mich nicht interessiert. Ich klage nicht an und ich will auch nicht verklagt werden. Wie mich die Moral nicht interessiert, interessiert mich auch die Erkenntnistheorie nicht, weil es einfach nicht meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist ein literarischer Text. Mich interessiert nur die künstlerische Aufgabe. Ich will die Verbrechen begehen. Aufklären müssen sie andere. Und, mit Verlaub, ich zweifele daran, dass die Moral zur Klärung beitragen kann. Da ist weit eher die Philosophie gefragt.
Es hat einen kleinen Skandal gegeben. Jedenfalls waren da ein paar Leute, die meinten, einen Skandal machen zu können. Dabei muss man sich fragen: wer macht den Skandal und wem nützt er? Der Skandal nämlich, dass Aléa Torik nicht identisch mit sich ist. Nicht nur im Buch nicht, sondern auch im Netz nicht. Sie ist eine fiktive Figur. Frei erfunden. Wenn man in meinem Blog einen Text liest, passiv rezipiert, oder einen Kommentar abgibt, sich aktiv einmischt, dann erreicht man nicht die authentische Autorin. Aber wo steht, in welcher Netiquette, dass man – sei es in der U-Bahn oder sei es im Netz – mit sich identisch sein müsste? Nirgends. Hintergeht man die Menschen, die potentiellen Kommentatoren eines Blogs, wenn man nicht der oder die ist, die man zu sein vorgibt? Oder hintergeht man die Menschen, wenn man ihnen vorspielt, dass man der ist, als der man sich darstellt? Die erste Frage ist einfach zu beantworten, man nimmt das Schatzkästchen der allgemein greifbaren Moral als Richtschnur. Die zweite Frage ist sehr viel schwieriger zu beantworten, weil man dann nicht einen anderen in Frage stellen muss, sondern sich selbst. Weil man sich selbst zur Verantwortung ziehen, seine eigenen Strategien erwägen und möglicherweise feststellen muss, dass man es sich zu leicht macht.
Was ich mit Bog und Roman gemacht habe, ist eine Ausweitung der literarischen Kampfzone. Ich mache, was alle im Netz machen, für die Literatur. Ich übertreibe dabei, zugeben, ich übertreibe maßlos, ich ändere Alter, Geschlecht und Herkunft meiner Figur. Und ich übertreibe noch weiter, indem ich auch jetzt noch behaupte, diese Figur zu sein. Ich behaupte das nicht, weil ich schizophren bin, sondern weil ich diese Figur bin. Weil wir hier im Netz sind. So wie es mein authentisches Ich im Netz nicht gibt, so gibt es in der realen Welt keine Aléa Torik. Aber diese rein reale Welt interessiert mich nicht.
Ich mache einfach nur, was technisch möglich ist. Ich nutze die modernen Medien, um Literatur zu schreiben. In meinem Verständnis gibt es überhaupt keinen Skandal, weil es nur einen Roman gibt, den eine junge Frau aus Rumänien schreibt, in dem sie sich als ihre eigene Hauptfigur herausstellt: sie ist einfach nur das, was Figuren in Romanen nun einmal sind: erfunden. Aber in dieser Erfindung stellt sich langsam heraus, dass da wirkliche Personen vorkommen, ein echter Clemens Setz. Aber ist das wirklich Clemens Setz? „Ich lernte Clemens Setz kennen. Er hatte, wie ich auch, am Blog zu »Unendlicher Spaß« teilgenommen und war für eine Lesung in Berlin. Ich holte ihn vom Hotel ab und wir gingen ins Literaturhaus in die Fasanenstraße. Er war kurzsichtig und ich musste immer ganz nah an ihn herangehen, ich musste ihm die Speisekarte vorlesen, weil er nichts erkennen konnte. Er konnte nicht erkennen, wie aus den dürren Worten auf der Karte die reichhaltigen Gerichte auf dem Teller werden sollten. Oder seine Kurzsichtigkeit war ein Trick, um möglichst nahe an die Leute heranzukommen. Er saß mir gegenüber in einem schwarzen Sakko und einem bunten Rollkragenpullover darunter, das alles war viel zu groß für ihn und passte auch nicht zusammen. Mir gefallen solche Männer, die das nicht bemerken, weil sie in Gedanken ganz woanders sind. Ich mag dieses betont Männliche nicht, das auf mich geradezu lächerlich wirkt. Als würden Frauen grundsätzlich an der Männlichkeit der Männer zweifeln. Clemens war nicht überaus schick gekleidet, aber er war, wie man lesen konnte, überaus begabt. Womöglich simulierte er das lediglich. Er simulierte den astigmatischen Hochbegabten und wie alle Simulanten und Hochstapler musste er sein Geschäft weit besser beherrschen, als wenn er tatsächlich begabt oder astigmatisch gewesen wäre. Er schien ein bisschen durcheinander, was sicher ebenfalls nur eine Simulation war. Vielleicht war das gar nicht Clemens Setz. Das war nur irgendein Clemens. Ich war einfach in das Hotel gegangen, das er mir per Mail genannt hatte, und war dann mit dem herausgekommen, der sich mir gegenüber als Clemens zu erkennen gegeben hatte.“ (AI, 238)
So ist das in der Literatur: da zeigt sich das, was man so schön abtun konnte als lediglich ‚erfunden‘ plötzlich in seiner ganzen Radikalität: das Erfundene hat eine Realität. Und die ist vielleicht größer als die der ‚echten‘ Realität. Wenn ich als Leser mit so einer Konstruktion wie in Aléas Ich konfrontiert werde, dann muss ich mir irgendwann Gedanken machen, was die Bedingungen von fact and fiction sind. Ich habe mir jedenfalls Gedanken gemacht und festgestellt, dass ich für mich in den wenigsten Fällen klar differenzieren kann, sondern dass ich nahezu immer diese beiden Welten vermische. Und darüber habe ich einen Roman geschrieben. Allerdings habe ich nicht vorher überlegt und dann geschrieben, sondern das geschieht bei mir simultan.
In dem verlinkten Interview spricht Joseph Vogl von Jose Luis Borges, von einer Erzählhaltung, die die verschiedensten auch widersprüchlichsten Ereignisse in einen Augenblick packt: wir sind Täter, aber gleichzeitig auch die Opfer; wir sind existent, aber vielleicht auch inexistent. Wir existieren vielleicht noch nicht, aber vielleicht auch nicht mehr. Das beschreibt auf eine treffende Weise, was Aléa Torik bedeutet: ein paradoxer Zustand, der sich bewegt.
Zum Schluss, allerdings nur noch ganz verkürzt: Ihre letzten Fragen sind sehr interessant. Ich glaube – ich unterstelle – dass es in der Kunst, außerhalb des Inszenierung, außerhalb des Artefakts, einen ganz wesentlichen Aspekt gibt, um derentwillen die Kunst gemacht ist: das Genießen. Im Genuss sind wir ganz bei uns selbst. Deswegen mögen manche Menschen Kunst nicht. Vielleicht sind das die, die mit sich identisch sind.
Wenn auch nicht jede Zeile gleich erhellt:
geschehn aus unablässigem Bestreben.
Aléa hat’s hierher gestellt,
und zwar soeben.