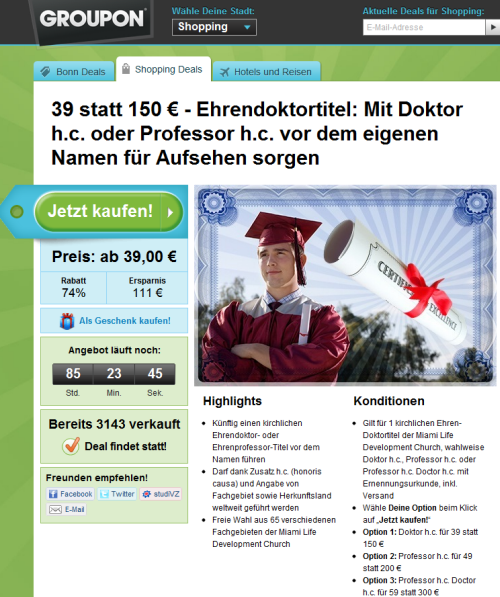Es gibt in China gerade keinen großen Medien-Aufruhr, es wird nicht viel mehr oder weniger zensiert als sonst, es werden künftig sogar ein paar zusätzliche ausländische Filme unterdurchschnittlicher Qualität auf den chinesischen Kino-Leinwänden zu sehen sein, nachdem Hollywood lange genug genörgelt hat. Aber auch ohne die großen Skandale kann man regelmäßig über „Anpassungen“ in der Ausgestaltung und Regulierung des chinesischen Mediensystems lesen und hören. Es gibt fast täglich Nachrichten, die die Besonderheiten der chinesischen Medien beleuchten: Gemeint sind gar nicht die medialen Aufreger wie der Rauswurf einer Al-Jazeera-Journalistin, oder das routinemäßige Blockieren vor allem internationaler Webseiten. Solche Ereignisse haben wenig bis keine Relevanz für den chinesischen Medienmarkt – in den genannten Beispielen, weil es sich im ersten Fall um Medienberichterstatter von an ausländische Nutzer orientierten Medien handelte, im zweiten Beispiel. weil die meisten blockierten Seiten von chinesischen Nutzern auch dann kaum besucht würden, wenn sie verfügbar wären (aber das ist eine andere Geschichte und soll in einem anderen Blog-Beitrag … usw.).
Jenseits dieser außergewöhnlichen Eingriffe sind es vielmehr die normalen Entwicklungen, das Alltags-Management der Medien durch die verschiedenen Regulierungsbehörden, die ein Licht auf den spezifischen Charakter und auch auf die Herausforderungen werfen, mit denen Medien und ihre Nutzer hier konfrontiert sind. Nun doch am konkreten Beispiel: Fernsehen darf seit kurzem nicht mehr „exzessiv unterhaltsam“ sein. Das ist kein Witz, sondern eine Verordnung des Regulierers, der „State Administration for Radio, Film and Television“ (SARFT), die am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist. Wer gelegentlich ins chinesische Fernsehen schaut, der findet diese Regelung selbst exzessiv unterhaltsam – sehr wenig wird dem Abendprogramm der großen Staatsender seltener vorgeworfen, als unterhaltsam oder gut gemacht zu sein. Aber seit einigen Jahren drängen Show- und Reality-Formate wie „Supergirl“ oder „Fei Cheng Wu Rao“, “Let’s Shake It” oder “China’s Got Talent” in die Prime Time, und ziehen mit ihrem sagen wir konsumfreundlichen, lifestyle-orientierten und gelegentlich auch sexuell unerwartet offenherzigen Fokus ein junges Publikum an. Die Talentshow „Supergirl“ geriet in die Schlagzeilen, als überraschend hohe Teilnahmezahlen bei der Telefonabstimmung die Regulierer auf den Plan gerufen hatten.
Solchen Enthusiasmus für demokratische Abstimmungsverfahren waren nicht ganz geheuer, die Sendung wurde auf Anweisung der Regulierer abgesetzt. „Fei Cheng Wu Rao“ (wir würden es „Herzblatt“ nennen) löste eine andere Wertediskussion aus: Eine Teilnehmerin mäkelte, der Verehrer, der eben eine romantische Radtour vorgeschlagen hatte, könne diese gerne alleine machen, da würde sie doch lieber alleine auf der Rückbank eines BMW heulen. 50 Millionen Zuschauer waren begeistert bestürzt über solch ungeschminkten Materialsmus aus stark geschminktem Munde. Ergebnis: Die Zensoren fielen über die Sendung her, das Konzept wurde massiv entschärft, nun darf nicht mehr über das Einkommen der potentiellen Turteltauben, auch nicht über deren erotische Vorlieben und Erfahrungen geplaudert werden.
Diese Beispiele aus einem „alten Medium“ sind deshalb interessant, weil sie einem durchschnittlichen europäischen Fernsehzuschauer völlig vertraut sind: Debatten um Schamgrenzen und Moral zu Beginn der „Big Brother“-Lebenphase; voyeuristischer Spaß am Beiwohnen verbaler Hinrichtungen durch Dieter Bohlen in Talentshows; Pseudo-Dokumentationen für Heimwerker, die wie Werbefilme für den nächsten Baumarkt daherkommen. Wir haben in alle diesen Fällen die Rufe nach „absetzen“, „verbieten“ , „die Leute vor sich selbst schützen“ und „Qualitäts- und Werteverfall“ gehört und gelesen. Nicht im autokratischen China, sondern im liberalen Deutschland.
Man sollte sich nicht scheuen, das festzustellen: In westlichen Demokratien und in Chinas Ein-Parteien-System gibt es gleichermaßen Kontroversen über wünschenswerte und unerwünschte Medieninhalte. Mit Worten wie „Schmutz“ und „Schund“ werfen „Medienexperten“ und Politiker gleichermaßen großzügig um sich. Diese Diskussion ist oft von gleicher fragwürdiger Qualität wie die diskutierten Sendungen, aber im Prinzip völlig in Ordnung und wichtig als Schritt im Herausbilden einer öffentlichen Meinung. Von hier geht die Diskussion dann natürlich ein wenig unterschiedlich weiter: wer führt solche Wertedebatten, wie öffentlich sind sie, wie kommt man zu Ergebnissen, die dann auf welche rechtliche Art formuliert und auf welche Art und Weise umgesetzt werden? Über Rechtsstaatlichkeit und Transparenz des öffentlichen Entscheidungsfindungsprozesses, über die Art und Weise, wie der Wille des Volkes zu Recht und Gesetz gerinnt, wird sicher hier im Blog bald einmal zu lesen sein. Da gibt es Unterschiede. Ergebnis in China: Die Anzahl der Unterhaltungsprogramme während der Prime Time sank in Folge der neuen Regulierung von 126 auf 38. Ergebnis in Deutschland: man gewöhnt sich dran und alle paar Monate gibt es eine Rüge der Landesmedienanstalten, weil die nächste Toleranzgrenze ausgetestet wurde.
Als Beobachter der chinesischen Medienlandschaft sieht man erst einmal den nächsten Schritt: Sendungen werden abgesetzt oder beschnitten, ausländische Programme werden zunehmend limitiert. Im Feburar 2012 wurde etwa verfügt, dass kaum mehr ausländische Serien ausgestrahlt werden dürfen, vor allem nicht zur Hauptsendezeit – ausländische Action- und Krimisendungen wurden fast komplett eliminiert. Die Inhalte der als staatseigene Betriebe geführten Fernsehsender (gleiches gilt für Radio und fast alle Printmedien) werden aus populären, aber inhaltlich unkritischen Banalitäten und Beiträgen zur Volksbildung und der geistigen Erbauung zusammengemischt. Soap Operas, Verführungs-Dramen am Hofe des Kaisers, Varianten über chinesische Mythologien und Kaufempfehlungen für teure, gerne auch deutsche Autos – „bieder“ passt als Annäherung. Diese Biederkeit ist Politik, das Fehlen von kantigen und exzentrischen Inhalten Kern der staatlichen Medienpolitik. Die jährliche TV-Gala zum chinesischen Neujahrsfest strotzt vor Harmlosigkeit und belangloser Fernsehballett-Unterhaltung; das Zulassungssystem für Kino-Filme verlangt, dass jeder Film für alle Altersklassen geeignet sein muss; das auch in China äußerst populäre Online-Spiel „World of Warcraft“ musste seine Skelett-Armeen für die chinesische Version mit Fleisch und Haut „bekleiden“, da die Darstellung von knochigen Skeletten für chinesische Spieler unzumutbar sei.
Man kann in einem System, in dem Massenmedien so unmittelbar eine Verlängerung des politischen Apparats sind, die Medienpolitik nicht einmal kritisieren. Die Medien haben eine andere Aufgabe zugeteilt bekommen, sie sind definiert als Instrument im Dienste des Partei- und Regierungssystems. Will man die Biederkeit kritisieren und den aus westlicher Sicht manchmal exzessiv wirkenden Ruf nach Harmonie und Konformismus, dann muss diese Kritik gegen das politische System gerichtet sein, nicht gegen die Staatsmedien als Erfüllungsgehilfen, ohne viel Handlungsspielraum. Die Staatsmedien „dienen“ dem Staat und seinen jeweiligen Zielen – und ändern sich mit diesen Zielen. Selten wurde das deutlicher als im Fall von Chongqing, der in diesem Blog schon zu Prominenz gelangten Metropole des Südwestens. Im Rahmen der dort ausgerufenen moralischen und ästhetischen roten Wende gab es im regionalen Fernsehen ein komplettes Werbeverbot und regelmäßige Volksopern mit kommunistischen Inhalten zur Hauptsendezeit – und im Ergebnis einen katastrophalen Einbruch der Einschaltquoten. In einem System, das mit Ausnahme der nationalen CCTV-Senderfamilie nur sehr bedingt auf Werbeeinnahmen zählen kann, gleichzeitig aber ein weitreichendes regionales Vertriebsmonopol und nirgends Konkurenz von privaten TV-Anbietern hat, war das ein bisschen egal. Mit den jüngsten, nun ja, personellen Änderungen in der Provinz-Regierung wurden dann aber auch dieser regionalen Besonderheit schnell der Garaus gemacht. Der Nachricht der Absetzung des Provinz-Parteichefs folgte sofort (!) eine Schnaps-Reklame und die Wiedereinführung regelmäßiger Werbeblöcke.
Parallel zu diesen Überlegungen gilt: Ob im Fernsehen gutes oder schlechtes Programm läuft, interessiert täglich weniger chinesische Mediennutzer. Die Staatsmedien sind nicht der Ort, an denen man sich Nachrichten und Informationen besorgt. Sie sind schon gar nicht der Ort, von dem man gute Unterhaltung erwartet. Wie in allen Ländern, in denen ein stark intervenierender Staat zu miserabler Programmqualität führt (wer mir ein in den letzten fünf Jahren entstandenes chinesisches Medienprodukt, ob Film oder Fernsehen, nennen kann, das erstens technisch und inhaltlich glänzt und zweitens innerhalb des Staatsmedienapparats entstanden ist, der … der hatte sehr viel Glück), so bedeutet auch in China die rigide Kontrolle der Produktion und des Vertriebs von Medieninhalten, dass sich die Kunden von diesen offiziellen Produkten abwenden. Kontrovers diskutiert wird nicht in der TV- oder Radio-Talkshow, sondern auf den Twitter-Klonen. Nachrichten werden nicht durch die Hauptnachrichtensendung von CCTV (die jeden Abend auf allen Kanälen laufen muss) wahrgenommen, sondern über die Portale von Sina und Sohu, die Yahoos Chinas. Und Unterhaltung? Wie in allen anderen Ländern auch, ist die Internetnutzung in China durch Unterhaltung dominiert und definiert. Internationale Fernsehsender werden live im chinesischen Netz gestreamt. Die heimischen Video-Portale stellen in Sachen Kapazität und täglicher Nutzung Youtube weit in den Schatten. Das chinesische Netz ist bestens ausgestattet mit Peer-to-Peer-Angeboten, bei denen man aktuellste Filme und TV-Serien innerhalb von Minuten nach US-Ausstrahlung in hochauflösender Qualität findet, inklusive chinesischer Untertitel. Das ist kein Untergrund-System, dessen Zugangs-Passwörter heimlich auf dem Schulhof getauscht werden. Es ist das Medien-System, das jeder nutzt, der einen Internetanschluss hat und damit umgehen kann. In China sind das derzeit knapp über 500 Millionen Menschen. Die meisten dieser 500 Millionen würden kaum mit der Schulter zucken, wenn CCTV morgen abgeschaltet würde und die Partei-Zeitung Renmin Ribao nicht mehr geliefert würde.
Chinesische unhd westliche Mediennutzer haben dabei oft unterschiedliche Perspektiven: Für den typischen chinesischen Mediennutzer gilt ein oft umgekehrtes Qualitäts-Verständnis wie für etwa den westeuropäischen. Wir sind aufgewachsen mit einem Mediensystem, das dominiert wurde von Rundfunkanstalten, spezifisch finanziert zur Gewährleistung von Vielfalt und Qualität (in Deutschland etwa durch institutionellen Binnenpluralismus innerhalb der öffentliche-rechtlichen Rundfunkanstalten, Außenpluralismus durch die Zulassung und Regulierung private Anbieter). Diese Glaubwürdigkeit hat das öffentlich-rechtliche Mediensystem mindestens im Bereich der Nachrichten und Informationen weiterhin. Das Internet ist eine willkommene Ergänzung, und nichts ist schöner als mit dem Laptop auf dem Schoß die Tagesthemen nachzurecherchieren (wie hoch sind Griechenlands Staatsschulden nochmal genau? Genau, Luft anhalten und hier klicken) – aber es ist noch immer „das Internet“, dem zunächst misstraut wird, nicht „dem Fernsehen“ oder „den Zeitungen“. Wer mit Staatsmedien aufwächst, das zeigt nicht nur die chinesische Erfahrung, wird umgekehrt denjenigen Medien einen stärkeren Vertrauensvorschuss geben, die sich außerhalb der staatlichen Kontrolle bewegen und nicht im Verdacht stehen, Verkündigungsmaschinen eines Apparats zu sein, der alle anderen Ziele und Werte den beiden Säulen „Bewahrung der staatlichen Einheit“ und „Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei“ unterordnet. Und in beiden Systemen gewinnen Online-Medien über die Zeit an Professionalität und Glaubwürdigkeit, das traditionelle System der Massenmedien wird diesen Trend nicht umkehren können. Für Chinas „alte Medien“ kann das einen unumkehrbaren Pfad in die Irrelevanz bedeuten.
Wie ist der Trend? Mitte Mai wurde das TV-Unterhaltungsverbot verschärft, nachdem das Sendeverbot während der Prime Time zu nichts weiter als einer Konzentration ähnlicher Sendungen ab 22 Uhr geführt hatte. Gleichzeitig ist der Medienregulierer dabei, eine neue nationale (und natürlich staatliche) Kabel-TV-Firma zu etablieren, die die bisherigen etwa 1000 Kabelanstalten bündeln und konsolidieren soll. China stemmt sich kräftig gegen die internationale Öffnung der Medienmärkte, die die USA durch eine Klage bei der Welthandelsorganisation WTO erzwingen wollen. Die Position der Massenmedien und der Vertriebskanäle, das zeigt sich hier, wsoll mit Zähnen und Klauen verteidigt werden. Wie auch im Westen, so gelten Online- und Offline-Medien als entscheidende Einflussfaktoren für die öffentliche Meinung. Innerhalb der Logik chinesischen Regierens bedeutet das die Notwendigkeit einer dauerhaften und intensiven Inhaltekontrolle. Dem stehen Kommerzialisierungstrends entgegen, der Wunsch der Bevölkerung nach mehr Unterhaltung und Freizeit, die Unzufriedenheit mit dem alten Mediensystem.
Und damit wären wir bei einem neuen Schauplatz: Kann die Inhaltekontrolle, die bei staatseigenen Medienanstalten relativ einfach auszuüben ist, auch in einer Welt praktiziert werden, die durch die Allgegenwart von Online-Medien geprägt ist? Auch hier gibt es schöne Parallelen zu ziehen: Westliche Politiker und Experten suchen seit vielen Jahren nach Ideen, Regulierungssysteme für die Online- und Offline-Welt zu konzipieren. Diese sollen einerseits reflektieren, dass Inhalte unabhängig von der Art, wie sie zum „Nutzer“ gelangen, zu beurteilen und gegebenenfalls zu regulieren sind. Gleiche Prinzipien etwa für Jugendschutz oder strafrechtliche Relevanz sollen für die Online- und die Offline-Welt gelten. Gleichzeitig müssen die neuen Konzepte der Vielfalt der Vertriebswege gerecht werden, praktikabel sein und dürfen nicht eine Kontrollierbarkeit suggerieren, die in globalen Netzen oft illusorisch ist. Ob nationale Regierungen, EU Kommission oder chinesische Regierung: auch hier ist die Aufgabe die gleiche, diese Anforderungen miteinander zu vereinigen. Der Weg dahin, soll schon einmal verraten werden, unterscheidet sich auch hier zwischen China und dem Westen.