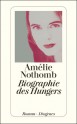Amélie Nothomb: Im Namen des Lexikons
30. Dezember 2012Wer sein Kind Tanguy oder Joëlle nennen will, schickt es in eine Welt des Mittelmaßes hinein, versperrt ihm von vornherein den Horizont.
 Diese Erzählung Amélie Nothombs zeigt wieder einmal, dass ihre direkt aus der eigenen Biographie gespeisten Texte (»Liebessabotage« oder »Biographie des Hungers«) deutlich stärker sind als ihre eher fiktionalen. Hier wie dort bleibt sie allerdings ihrem Interesse für bestimmte Motive – Gewalt, gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper, Bulimie – treu.
Diese Erzählung Amélie Nothombs zeigt wieder einmal, dass ihre direkt aus der eigenen Biographie gespeisten Texte (»Liebessabotage« oder »Biographie des Hungers«) deutlich stärker sind als ihre eher fiktionalen. Hier wie dort bleibt sie allerdings ihrem Interesse für bestimmte Motive – Gewalt, gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper, Bulimie – treu.
»Im Namen des Lexikons« (im Original »Robert de noms propre«) erzählt die Geschichte der jungen Plectrude, die bereits vor ihrer Geburt zur Halbwaisen wird, als ihre Mutter den Kindsvater erschießt, da sie glaubt, das Kind vor dessen banaler Namenswahl beschützen zu müssen. Nachdem die Mutter dann dafür gesorgt hat, dass Plectrude auf ihren raren Namen getauft wird, erhängt sie sich in ihrer Zelle.
Nach diesem etwas merkwürdig aus Camus’ »Der Fremde« und Jonny Cashs »A Boy named Sue« zusammengestrickten Auftakt wächst Plectrude im Haushalt ihrer Tante zu einem gänzlich außergewöhnlichen Mädchen heran: Hoch intelligent – wenn man dem mit traumwandlerischer Unbewusstheit bestandenen Test glauben darf –, aber an allem außer dem Tanz desinteressiert, verlässt sie die Schule mit mit knapp dreizehn Jahren und tritt ins Internat der Ballettschule der Pariser Oper ein. Hier ruiniert sie sich durch eine konsequente Fehlernährung ihren Knochenbau und muss, zur maßlosen Enttäuschung ihrer Tante, den Traum aufgeben, Tänzerin zu werden. Als sie schließlich die wahre Geschichte ihrer Herkunft erfährt, identifiziert sie sich mit dem Schicksal ihrer Mutter, lässt sich schwängern, gebiert den Knaben Robert und macht sich auf den Weg, Selbstmord zu verüben. Vom Ende soll nur soviel verraten werden, dass Nothomb versucht, den Text dadurch zu retten, dass sie sich von ihrer eigenen Figur ermorden lässt, um sie dann ratlos vor ihrer Leiche zurückzulassen.
Das Buch ist ganz nett, mehr aber auch nicht. Insbesondere die Passagen der Kritik an der Institution der Ballettschule und des Zerwürfnisses zwischen Plectrude und ihrer Ziehmutter überzeugen nicht – zu viel für eine so kurze Erzählung, der auch durch den abschließenden Schwenk ins Absurde nicht aufgeholfen wird.
Amélie Nothomb: Im Namen des Lexikons. Aus dem Französischen von Wolfgang Krege. detebe 23455. Zürich: Diogenes, 2004. Broschur, 148 Seiten. 7,90 €. (Derzeit anscheinend nicht lieferbar.)
Schlagwörter: Absurde Literatur, Belgische Literatur, Belletristik, Erzählungen, Jugend, Künstlerroman
Zur Archiv-Seite für Amélie Nothomb | Zum Autorenregister