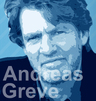weitere Infos zum Beitrag
Leseempfehlung
FÜR DEN GEISTESGABENTISCH – Andreas Greve rät ab und zu
REZA – GSELLA-BENN
Zu Weihnachten darf man Bücher verschenken, die man selber nicht gelesen hat. Diese Erleichterung gilt leider nicht für den, der versprochen hat, sie zu besprechen. In diesem Fall waren und sind das drei Namen aus den Suchbereichen Theater, Satire und Legende. Die beiden ersten – Reza und Gsella – würde ich zwar sehr gerne empfehlen, allerdings nicht just die von mir zu besprechenden Bücher. Das kommt vor, gilt aber nicht für den dritten Fall, bei Benn. Hier gibt es kein Vertun: Höchste Geschenkwarnstufe; bei nur 35.- Euro Einsatz schwer angeraten.
Klett-Cotta hat zum 125. Geburtstag Gottfried Benns (im Mai 2011) fünf Paperbacks in einer Art Sonderedition (mit Banderole, aber leider ohne Schuber) und dem Versprechen „Das Beste von..“ herausgegeben. Da also viel Benn ins Haus stand, sowohl lyrisch als auch poetologisch, versuchte ich mich vorher durch einen abgegriffenen Band mit sämtlichen Gesammelten Gedichten, sogar den unveröffentlichten aus seinem Nachlass, zunächst einmal wieder mit dem deutschen Großdichter vertraut zu machen. Und war, gelinde gesagt, sehr erstaunt über so viel sprachliches Kunstgewerbe, ja, fast Konditorhandwerk und Lyrik-Konfekt. Rein klanglich schienen mir etliche der Gedichte eher Parodien auf Benn zu sein. Nur eben von ihm selbst verfasst. Eine Art Autosatire. Da ich Benn einst schwer bewundert hatte, machte mich das einigermaßen unruhig.
DICHTER IN DOPPELROLLE
In meiner Gymnasialzeit, jedenfalls in der Oberstufe um 1970plus, verlief die vorderste Front der Revolution nicht etwa zwischen Schülern und Lehrern, sozusagen zwischen Untertan und Oberlehrer (und damit ähnlich wie in der Familie), sondern zwischen Klassenkampfzimmer und kapitalistischer Gesellschaft. Wenn man da – so wie ich und blöd wie ich war – auf einmal behauptete, Benns Gedichte toll zu finden, war man so gut wie erledigt. Ich glaube, dass die darauf einsetzende Hetze und Hatz (ca. πῖ geteilt durch Druck mal Traumafaktor 12) mich für gefühlte 20 Jahre jeder Art von ernster Lyrik entraten ließen. Über die Zeit begann ich zu ahnen, was seinerzeit an Einwand (Nazi-Nähe) gerechtfertigt war, aber langfristig n i c h t reichte, um den Dichter im Dichter nicht wieder zur Bewunderung freizugeben.
Das kann man wohl spätestens heute sagen, wo fünf namhafte Literaten der Jetzt-Zeit, von Draesner bis Tellkamp, für je einen der Benn-Bände ein Vorwort schrieben - ihre Namen gleich groß gesetzt unter den des Delinquenten. Hatte ich es doch immer geahnt. Was die Klangfarbe angeht und sowieso. Oder wie Gerhard Falkner so bildlich in seiner Einleitung schreibt: „Das klingt jetzt alles ein bisschen so, als würde ich einem Gott die Zehennägel schneiden. Dies ist aber nicht meine Absicht! BENN IST EIN WUNDER. So, wie auf eine ganz andere Art und doch in seltsamer Gegenüber-Entrücktheit Rilke ein Wunder ist.“ Sag ich doch. (Ich würde allerdings immer zwei Benns für einen Rilke geben. Sogar auf Grundlage von „Das Beste …“ dieser hier zur Verhandlung stehenden Edition, also der ausgewählten Gedichte, denn Rilke, Rilke ist wirklich ein Wunder!)
Gottfried Benn. Das Beste von Benn. 5 Bände. 792 Seiten. 35,00 Euro Paperback. Klett - Cotta Stuttgart 2011
SEINE VERSION DES SPIELS: BIG BENN
Für mich sind diese Vorworte ein Grund, zum Kauf oder zum Wunsch zu raten, weil gerade diese dubiose Doppelrolle – als Einleitung zu „Doppelleben“, aber auch in allen anderen Beiträgen – beleuchtet wird. Es ist schon ein Luxus, sich den Weg zur Dichter-Legende (gewissermaßen zum „Lyrischen Sie“) von Schreibkundigen der Jetztzeit ausleuchten zu lassen – und bei der Gelegenheit nebenbei auch die ein wenig näher kennen zu lernen. Michael Lentz liefert zu den Benn-Gedichten „Trunkene Flut“ über 50 Seiten, von denen ich anfangs nur die Hälfte verstanden habe. Es wurde dann aber besser. Durs Grünbein versah die „Statischen Gedichte“ mit einer knapp 30seitigen Einleitung, die ich regelrecht genoss, so flüssig und schlüssig lief es dahin. Faktisch gefiel mir sein Vorwort besser als diese späten Gedichte des Meisters, meine Vorlieben gingen quasi ein wenig über Kreuz. Es lädt sowieso ein, kreuz und quer zu lesen, von Essay zu Lyrik zu Lebensbericht.
In die Sammlung späterer Reden und Vorträge „Problem der Lyrik“ machte ich nur kleine Ausflüge und erst ganz zuletzt las ich die Einleitung von Ulrike Draesner zu „Doppelleben“. Rein faktisch bin ich wieder dabei, diesen Band zu lesen, der ja auch viel erzählt über die Fähigkeit von Benn, sich zu präsentieren und positionieren – und auch eigene verkehrte Urteile durch Auslassungen in eine „zeitgemäßere“ Meinung umzumendeln. Döblin nannte ihn bekanntlich einen Schurken, aber Nachkriegs-West-Deutschland war ihm dann bald mehr als zugetan, war er doch… mehr oder weniger… einer von ihnen. Also einer von denen, die es dann nicht gewollt, gewusst oder gar gewünscht hatten. Ulrike Draesner meint, dass der Dichter sehr viel klarer war, als die Person Benn es zu sein vermochte. „Du blühst wie Rosen schwer in Gärten allen / Du Einsamkeit aus Alter und Verlust / Du Überleben, wenn die Träume fallen / zuviel gelitten und zuviel gewusst“.
DER DICHTER ALS UNVERSCHÄMTER MENSCH: GSELLA
An der Stelle musste ich das Lesen unterbrechen – weil ganz andere Verse zu besprechen blieben, nämlich Schmähgedichte, wie Thomas Gsella hier sein Bestreben zusammenfasst. Der ganze Titel lautet: „Reiner Schönheit Glanz und Licht / IHRE STADT! im Schmähgedicht“. Ich hatte vorgehabt, Absicht, Ziel, Wirkung und dazugehörigen labilen Unterbau, sowie vor allem den Überbau, wo die Metaebenen sich nur so türmen, bis hin zur Hybris, mit dem geschätzten Dichter – quasi als d a s ultimative Feuilleton des aus- und ablaufenden Jahres - in einem grandiosen Interview abzuhandeln – oder jedenfalls anzureißen. Dazu fehlte dem Herrn Gsella derzeit leider diezeit. Pech für ihn, möchte ich sagen, denn zwar kannte ich nicht seine Antworten, wohl aber meine Fragen, die ich so, wie ich sie auf der Papierdecke in der Haifischbar notiert hatte, hier gleich runter trommeln könnte. Meine Wertung werde ich stehenden Fußes abgeben: Wenn Sie einen Gsella lesen wollen, dann greifen Sie lieber zu „Nennt mich Gott“ (Bei einem Satiriker keine Hybris, sondern Humor) – Schönste Gedichte aus 50 Jahren“. (Gerechnet ab Nabelschnur) Es gibt dort viel mehr Seiten bei viel größerer Auswahl an Themen, Stilen, Metren, Genres – meist ein wenig auf Abstand zum Dichterherzen gehalten, denn Komik und Anteilnahme sind nicht so gerne auf den selben Versfüßen unterwegs. Ein Satiriker ist nicht mitleidlos, er schleppt nur sein Herz nicht mit in seine Kata-Strophen, weil ja gelacht – und nicht geweint – werden soll. Dennoch, behaupte ich, dennoch sind die schönsten, wahrsten und anrührendsten Gsella-Stücke die, die vom Vater- oder besser Mutterglück handeln. (Wie sagte High Fidelty-Autor Nick Hornby so richtig: Sobald ein Kinderwagen auf dem Korridor steht, kann man die Kunst knicken!) Dazu hätte ich ihn gerne befragt. Viel lieber als zu seinem Wohnort Aschaffenburg oder ob er denn überall anderswo real gewesen sei. Oder ob er schon irgendwo ein Stadtverbot hat. In unserem schönen Hamburg bestimmt nicht, denn da schmeißt er sich regelrecht ran:
Wie stolz die Stadt, die immer kann:
Zum Schwitzen an die Strände,
Zum Spritzen auf die Reeperbahn,
zum Spitzen die Vidende
Wie Tor zur Welt, wie frei der Geist:
Sich nehmen heißt hier geben.
Im Glanze, den der Teufel scheißt,
Soll Hamburg ewig leben.