#textediebleibensollten [Raymond Radiguet]
Die poetische Lüge vom ersten Hahnenschrei bei Sonnenaufgang. Die Wahrheit ist: Die Hähne krähen die ganze Nacht hindurch. Um das zu bemerken bedarf es jedoch der Schlaflosigkeit der Jugend. Auch Marthe bemerkte es. Und ihr Erstaunen war groß.
Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 war Raymond Radiguet elf Jahre alt. Als er 1923 an Typhus starb, hatte er ein kleines Werk bestehend aus einem Gedichtband und einem schmalen Roman hinterlassen. Letzterer ist 1923 unter dem französischen Originaltitel „Le diable au corps“ erschienen. Begleitet von einer engagierten Werbekampagne seines Verlegers Bernard Grasset sowie öffentlichem Trommelwirbel bekannter Zeitgenossen wie Jean Cocteau galt der Roman als Sensation; und machte Radiguet zum ebenso gefeierten wie verpönten Wunderkind der Stunde. Seine Gönner sahen in ihm einen neuen Rimbaud oder Mallarmé; seine Gegner einen Verräter an der nationalen Einheit der Jahre 1914 bis 1918.
Radiguet erzählt in schlichter Prosa eine Liebesgeschichte, seine Liebesgeschichte, wie sie sich unzählige Male zugetragen hat und bis heute zuträgt: die Beziehung einer verheirateten Frau mit einem jüngeren Mann. Anders als bei Stendhals Figur des Julien Sorel geht es dem Ich-Erzähler aber nicht um den sozialen Aufstieg. Sondern einzig um das glühende Verlangen des 15-Jährigen, die Frau des Begehrens – die 19-jährige Marthe Grangier – mit Haut und Haaren zu besitzen. Dargestellt wird die Liebe nicht nur als Egoismus zu zweit, sondern vorrangig als gegen den vermeintlich geliebten Menschen gerichtet: Als jugendliche Spielwiese der Gefühle und des Narzissmus, unter dem Deckmantel der vollständigen Zweisamkeit, ohne die kein weiteres Leben möglich erscheint – oder erscheinen darf. Als Marthe in einem verzweifelten Brief den Versuch unternimmt, die Beziehung zu beenden, ist der Protagonist nicht angesichts dieser „harmlosen Drohung“ verärgert, sondern darüber, dass sie den Selbstmord als tragisch-finalen Ausweg nicht einmal in Erwägung zog. Er selbst jedenfalls hätte sich schon „aus Schicklichkeitsgründen“ dazu genötigt gesehen. Dass Marthe dies nicht tat, zeugte in seinen Augen von der Unaufrichtigkeit ihrer Gefühle.
Die Kompromisslosigkeit der Darstellung des jugendlich Liebenden brachte Radiguet zahlreiche Fürsprecher ein. Zu seinen Unterstützern gehörten neben Jean Cocteau – mit dem er eine Beziehung unterhielt – auch Picasso, Modigliani und Klaus Mann. Letztgenannter attestierte Radiguet, das Vorrecht der Jugend beschwörend, eines der wichtigsten und ergreifendsten Bekenntnisbücher der Nachkriegszeit geschrieben zu haben.
Das freilich wurde in Teilen der französischen Gesellschaft ganz anders gesehen, wenngleich sich die Kritik nicht in erster Linien gegen den zerstörerischen Elan das jungen Liebhabers wandte. Für einen Aufschrei des Entsetzens sorgte vielmehr das Verhalten Marthes, die nicht nur ihren Mann betrog, als dieser an der Front sein Leben riskierte, sondern ihm bei der Rückkehr auch das Kind des Liebhabers unterschob. Dazu kam, dass die gesamte Umgebung einschließlich der beiden Familien von der Affäre wusste, ohne jedoch dagegen vorzugehen, aus Sorge vor dem Gesichtsverlust.
Das Ende des Krieges brachte auch das Ende der Beziehung; Marthes Tod kurze Zeit später die endgültige Befreiung des Ich-Erzählers. Sowie dessen letzten Triumph über die vormals Geliebte in Form der Gewissheit, dass kein anderer Mann sie je wieder besitzen werde. Als er erfährt, dass Marthe mit seinem Namen – der auch der Name des gemeinsamen Sohnes ist – auf den Lippen gestorben ist, sieht er die Dinge in Ordnung gebracht. Sie hatte nur ihn geliebt, und um das gemeinsame Kind wird sich fortan ihr Witwer kümmern. Jetzt konnte das Leben beginnen, in der erfüllenden Gewissheit, bereits in jungen Jahren ein bewegendes Schicksal erlitten zu haben.
Obwohl die Geschichte in der deutschen Übersetzung gerade einmal 170 Seiten umfasst, ist die Vielschichtigkeit dieses kleinen Romans bemerkenswert. Davon zeugen nicht zuletzt die unterschiedlichen Reaktionen der Zeitgenossen. So bezog sich die Kritik nicht in erster Linie darauf, dass Radiguet die Beziehung einer verheirateten Frau mit einem jüngeren Mann erzählte, was wenige Jahrzehnte zuvor noch als hinreichend skandalträchtig gegolten hätte. Kritisiert wurde vielmehr, dass dies zu einem Zeitpunkt geschah, als der betrogene Ehemann für sein Land kämpfte. Dies wiederum war ein Aspekt, der den Befürwortern des Buches nicht einleuchtete. Sie feierten Radiguet vor allem für seine subjektiv-eindringliche Beschreibung des jungen Liebhabers, dessen destruktive Ich-Sucht nicht nach moralischen Kategorien, sondern als unverblümte Darstellung jugendlichen Ungestüms und leidenschaftlichen Lebensdrangs gewertet wurde. Gemeinsam war Kritikern und Befürwortern lediglich die Indifferenz gegenüber dem Schicksal Marthes. Deren Tod – hier erwies sich Radiguet in der Erzähltradition des 19. Jahrhunderts verwurzelt – wurde von allen Beteiligten als gerechtfertigt erachtet, sei es als Bestrafung der Ehebrecherin oder zur Befreiung des gefeierten Helden.
Raymond Radiguets „Den Teufel im Leib“ ist mehr als der Achtungserfolg eines Frühvollendeten, dessen Leben und Schaffen nur wenige Jahre währte. Das Buch ist auch das eindrucksvolle Zeugnis einer bewegten Zeit – der Erste Weltkrieg und unmittelbar danach –, das es verdient, über die Jahrzehnte hinweg immer wieder neu entdeckt und gelesen zu werden.
*
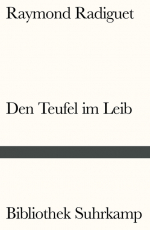 Raymond Radiguet
Raymond Radiguet
Den Teufel im Leib - Roman
Aus dem Französischen von Friedhelm Kemp
11,95 €
Erschienen: 05.10.2016
SuhrkampTaschenbuch, 172 Seiten
ISBN: 978-3-518-24058-8
Fixpoetry 2019
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.







Neuen Kommentar schreiben