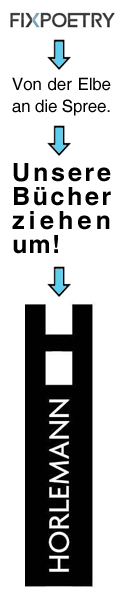weitere Infos zum Beitrag
Prosagedichte
Verlottert hing das späte Laub im Walnussbaum, – ein Band voller variierender, funkelnder, lispelnder, raschelnder, wankender und aufblühender Prosagedichte von Michael Donhauser
30.05.2013 | Hamburg
Wenn es auch war, dass wärmer ein Tag uns lock-
te oder schien, wenn Dornen am Gestrüpp wie
Beeren spiegelten die Bläue und fern als Mauer
standen die Wolken, dass hell sich wölbte und
herbstlich der Himmel, [...]
Variationen in Prosa von Michael Donhauser zeichnet sich durch eine Sprache von einer schwer zu fassenden Leichtigkeit aus, „ein Schimmern in Silben ein Sagen ohnegleichen“, wie es im Klappentext heißt. Das besondere an den Prosagedichten von Michael Donhauser ist, dass sie viel zu verbergen scheinen und dass man sie daher auf viele unterschiedliche Weisen lesen kann. Auch weht ein Blätter- und Blütenrauschen durch den ganzen Gedichtband.
Der Buchtitel des Gedichtbandes von Michael Donhauser lautet „Variationen in Prosa. Variationen im März.“ Eine Variation ist Abwandlung, Umformung und Veränderung. Im Klappentext liest man: „Variierend, das heißt auch schillernd oder in sich von sich abweichend und abweichend so von allem Eigenen wie Anderen [...]“ Die Variation ist aber auch ein musikalischer Begriff. Spontan fallen einem dazu vielleicht die Goldberg-Variationen von Bach ein, gespielt von Glenn Gould. Michael Donhauser variiert nicht in C-, oder Es-Dur, er variiert in Prosa. Auch wenn es sich bei ihm also um Sprachvariationen handelt, so sind seine Gedichte doch von außerordentlicher Musikalität.
Einzelne Motive werden in den Gedichten variiert und immer wieder aufgegriffen. So taucht beispielsweise mehrmals an unterschiedlichen Stellen das Bild von welkenden Tulpen in einer Vase auf. Auf Seite 18 heißt es:
[...] wenn verloren wir
einem Zimmer waren anvertraut, wo Tulpen
standen halb verwelkt und schlingernd neigten
sich die Stiele, es lagen einzeln Blätter, leicht ge-
wölbt und matt als Blüten, die flüchtig streifte
oder hob auch sanft, was wehte wie verhangen
und wogend dann als Hauch von einem abend-
lich verirrten Duft.
Das gleiche Motiv findet man auf Seite 34 leicht abgewandelt wieder:
Bitter sei und so blieb, war einsam die Nacht in
dem Zimmer, wo vergessen ein Strauß nur von
Tulpen zu feiern schien das Welken, sich win-
dend an den Stielen, als suchte Halt, so nahe dem
Fallen, Blüte um Blüte und aufwärts weit sich
öffnend entgegen der Neige, [...]
Und auch auf Seite 68 taucht der Tulpenstrauß gleich einer Erinnerung wieder auf, während „müde sank das Sommerlaub“:
[...] und
sehnlich uns umfing, was Anmut bald wie Ab-
schied war und lispelnd sprach, als wäre sanft
und ahnte schon, dass noch zu sein wie einst,
da wir in Zimmern fanden uns, war fern wie
jene Tulpen, die als Strauß um eine leere Mitte
schlingern ließ, was sich entzog und Duft dann
war und nahe als ein Traum.
Auch „Blätter“ werden häufig in den Gedichten genannt, sehr oft in Zusammenhang mit dem Wort „Silben“. Manchmal handelt es sich dabei um einzelne Silben:
[...] fielen doch in Scharen
schon die Blätter oder einzeln dann als Silben, [...]
Oder sie reihen sich an einer anderen Stelle:
[...] alles Sehen ein Entbehren,
und es reihten sich die Silben, duftend von der
süßen Wärme, die sich staute oder blühte an
den dunklen Efeuranken.
Die häufige Nähe von „Blättern“ mit „Silben“ legt die Vermutung nahe, dass die Gedichte selbstreflexiv über Sprache nachdenken könnten:
[...] als suchten
die Tage, die Blätter wie Silben ein Sagen und
rauschten, [...]
Lässt man sich erst auf solcherlei Verdachte ein, gewinnen die Gedichte sofort an Tiefe, lassen sich aber dadurch auch schwerer fassen.
Nicht nur einzelne Motive, sondern auch Orte kehren immer wieder. Neben dem Garten gibt es einen Park mit Platanen, einen See, ein Zimmer und auch eine Stadt in der Ferne:
Es gab, da war der Mond ein Schein, die Stadt,
Gewölk, und kahl verzweigt stand nah ein Ast, [...]
Etwas Fernweh könnte man im Auftauchen von Straßen, Wegen und Zügen sehen.
Alles scheint um einen Garten und die Jahreszeiten zu kreisen. Dabei nehmen das Frühjahr und der Herbst besonders viel Raum ein. Doch auch der Sommer und Winter werden angesprochen:
Leicht wogten, leicht sanken und zogen die
Flocken, da lose wie leise ein Schweben es war, [...]
Der Garten ist im ständigen Wandel inbegriffen, alles wankt und neigt sich, und dennoch oder gerade deswegen bleibt er unverändert. Nicht nur die Blumen und Ranken wanken, auch die Gedichte vermitteln eine gewisse Unentschlossenheit, wie es der Klappentext ausdrückt: „[...] zögernd zwischen einem Noch und einem Nicht und einem Dann und einem Schon [...]“ Die Bewegung der Gedichte lässt sich als ein wellenförmiges Aufwärtsstreben und Wiederhinabsinken beschreiben.
Michael Donhauser schreibt über einen Garten im Wandel der Zeit – könnte man als Antwort auf die Frage, worum es in Variationen in Prosa denn gehe, sagen. Das wäre sogar eigentlich gar nicht falsch. Dennoch ist diese Beschreibung unzureichend. Denn sie lässt die leisen Untertöne, die verhaltenen Echos ganz außer Acht. Es werden immer wieder Hinweise gegeben, dass eigentlich auch gerade etwas ganz anderes gemeint sein könnte. Oft scheint es offensichtlich zu sein, dass die Natur als Metapher für Menschliches fungiert. Beziehungsweise, dass es hinter der vordergründigen Naturbeschreibung eigentlich um Menschen geht. Ein Beispiel hierfür wären die Arme des Tages:
[...] wie standen wir am See im Licht, da
voll die Dolden, da der Tag uns gütig fast um-
fing, mit Armen, die wie trunken noch erblüh-
ten dann und sanken, süß und mild.
Die Gedichte beschreiben einen Garten, thematisieren aber ebenso große Themen wie Vergänglichkeit und Liebe.