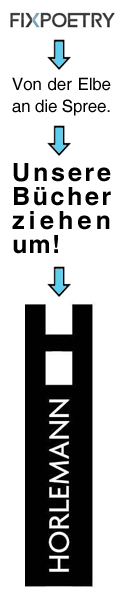weitere Infos zum Beitrag
Roman
Wie sie geworden ist. »Die ersten Tage von Berlin. Der Sound der Wende« von Ulrich Gutmair.
24.07.2013 | Hamburg
»Erinnerung funktioniert nicht wie ein Fotoapparat. Die Bilder, die das Gedächtnis hergibt, sind unscharf und vermischen sich mit Gerüchen, Sounds und Gesichtern, zu denen wiederum Gespräche gehören, die möglicherweise aber in ganz anderen Zusammenhängen geführt worden sind. Kurze Momente aus Nächten in unterschiedlichen Jahren schießen zu einer Erinnerung zusammen, ein wildes Durcheinander kurzer Sequenzen, wie von Stroboskoplicht zerhackte Teile, die zusammengehören, aber auch beim besten Willen nicht zu einer Geschichte montiert werden können.« Einsichtige Zeilen, die Ulrich Gutmair gleich zu Beginn seines Buches Die ersten Tage von Berlin. Der Sound der Wende schreibt. »Die frühen neunziger Jahre erscheinen wie ein Traum, an den man sich morgens nur noch vage erinnern kann, der aber als Soundscape immer noch im Ohr ist«, stellt er später fest. Na klar, das Vinyl von damals knistert zwar ein bisschen, spielt aber noch, die größten Killer-Tunes von damals sind eh bei YouTube abrufbar. Der Sound der ersten Tage der geeinten Stadt – er kann sich jederzeit mit 128 bpm wieder in die Ohrmuschel fräsen. Der Mythos lebt schnell wieder auf, wenn wir nur wollen. Doch mit jedem Mal vielleicht ein bisschen verschwommener als zuvor.
Gutmair scheint selbst die Berechtigungsfrage zu stellen: Braucht es denn noch so ein Buch? Über Berlin, Techno und die Wende, wie es schon im Untertitel der exzellenten oral history Der Klang der Familie hieß? Ist das Wesentliche (oder zumindest: das Meiste?) zu diesem Thema nicht schon gesagt und geschrieben worden? Haben wir nicht alle die Tracks gehört, uns aus der Vielzahl der Erinnerungen einen wie auch immer vagen Eindruck destillieren können? Was war, wie es war – davon haben wir doch mittlerweile eine gute Idee, selbst wenn die durch die damaligen Exzesse schlierig geratenen Retrospektiven sicherlich nicht unbedingt ein verlässliches Bild zeichnen. Warum schreibt der taz-Kulturjournalist Gutmair, der selbst Anfang der 90er nach Berlin kam, für die de:bug aktiv war und auf der letzten Ausgabe des CTM-Festivals in Berlin über untote Rave-Musik diskutierte, dieses Buch? Weil er uns seine Erinnerungen aufdrücken will, sich vornehm hinter dem Schleier der Unmöglichkeiten Objektivität verbergend? Oder weil er uns die einzig wahre und richtige Story der Stadt präsentieren möchte, ein hieb- und stichfestes Dokument der Zeit?
Soviel wird schnell klar: Gutmair kaut zumindest nicht die Hypes und Mythen von anno dazumal wieder, sondern bemüht sich um die Aufarbeitung der größeren Zusammenhänge. Historische Bedingungen sind ihm wichtiger als Hit-Singles, er nimmt keine Stars, sondern StarthelferInnen ins Auge, leuchtet Infrastrukturen aus, konzentriert sich nicht auf verschwommene Ideologien. Auf gut 250 Seiten flaniert Gutmair mehr durch Geschichts- und Grundbücher als durch flackernde Stroboskoplichter. Er spricht über Antisemitismus in der DDR, über Luftwaffenangriffe im zweiten Weltkrieg und wie dies alles das Gesicht der Stadt prägten. Die ersten Tage von Berlin wurden eben zwar auch, aber nicht ausschließlich von Acid House und Techno geprägt. »Der Sound der Wende wird in diesen Tagen von Sirenen, Hubschraubern und Steinen erzeugt, die aufs Pflaster schlagen«, konstatiert Gutmair nüchtern über die Auseinandersetzungen der Hausbesetzungsszene mit der Staatsgewalt. Das klingt nicht ganz so romantisch wie die Schilderungen von MDMA-befeuerten magischen Momenten, die das Narrativ über das Nachwende-Berlin bestimmen.
Aber auch für die Einzelschicksale und privaten Beiträge zum Charakter dieser Zeiten, von denen so oft erzählt wurde, lässt Gutmair Raum. Dabei geht es ihm weniger um prominente SzenerepräsentantInnen, sondern vielmehr Randfiguren. Menschen, deren Namen heut in Vergessenheit geraten sind, die aber maßgeblich die Strukturen bestimmt haben. Wie beispielsweise Jutta Weitz, die KünstlerInnen Räume vermittelt hat und ohne die Berlins »Mitte ganz anders aussehen« würde. Oder aber den Obdachlosen Klaus Fahnert, der jahrelang vor dem Tacheles in Berlin-Mitte mit einem Büchertischlein die Stellung hielt, den jeder irgendwie kannte und der doch in keiner der Geschichten wirklich noch auftaucht. Eine zu oft vernachlässigte Nische, in die sich Gutmair einnistet, wenn er die Geschichten um das Drumherum in der alternativen Sozialutopie nacherzählt oder nacherzählen lässt.
Der Mix aus historischen Fakten, liebevollen Porträts von Dabeigewesenen und nicht zuletzt Gutmairs eigenen Erinnerungen macht aus Die ersten Tage von Berlin letztlich doch ein besonderes Berlin-Buch. Eines nämlich, das nicht nur die Hintergründe zur Dauerparty beleuchtet, sondern auch gleichzeitig eine Erklärung dafür abliefert, warum die Aufarbeitung notwendig ist, warum Berlin-Bücher vielleicht notwendig sind. »Die Brachen wurden überbaut, die Lücken geschlossen, die Spuren der Maschinengewehre auf den Häuserwänden von Mitte, die man in den neunziger Jahren noch überall sah, beinahe komplett getilgt. Historisierung und Vergessen sind manchmal nur unterschiedliche Formen desselben Vorgangs.« Die Reste von Nazi-Herrschaft und DDR-Politik verschwanden aus dem Alltagsleben, wurden kosmetisch behoben. Was gegen das Vergessen hilft ist die Erzählung vom Gewesenen und wie es sich auswirkte. Die Neunziger in Berlin zu verstehen, hilft vielleicht Berlin zu verstehen, auch das heutige. Gutmair leistet einen wichtigen Beitrag dazu.
Im Handgemenge der Publikationen, die uns erzählen wollen, was und wie die Hauptstadt war, ist und vielleicht sogar noch werden wird, sticht Die ersten Tage von Berlin als ein Buch hervor, das darüber nachdenkt, warum sie so geworden ist. Und sagt damit mehr über die Stadt und ihre Blüten schlagende Subkultur aus, als die es in eigenen Worten wohl könnte – oder wollte. »Die meisten Leute, die nach dem Fall der Mauer in Mitte unterwegs waren, sprechen über die Vergangenheit mit der heiteren Gelassenheit, die Menschen eigen ist, die wissen, dass sie etwas besitzen, was ihnen keiner nehmen kann. Sie haben erlebt, dass man sich gemeinsam mit anderen in einem selbst definierten Rhythmus bewegen kann, ohne nach Sinn und Zweck zu fragen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie uns nicht alles erzählen wollen«, mutmaßt Gutmair im letzten Kapitel. Er hat einen eleganten Weg gefunden, dieses Problem zu umschiffen.
Ulrich Gutmair: Die ersten Tage von Berlin. Der Sound der Wende. Broschur, 256 Seiten. ISBN: 978-3-608-50315-9. 17,95 Euro. Tropen/Klett-Cotta, Stuttgart 2013.
Kristoffer Cornils hat zuletzt über »On the Wild Side« von Martin Büsser auf Fixpoetry geschrieben.
© Fixpoetry.com 2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com
Sie können diesen Beitrag aber gerne verlinken