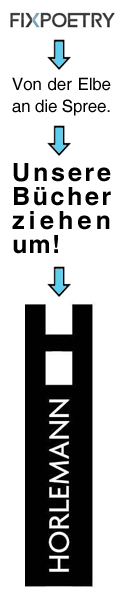weitere Infos zum Beitrag
Roman
Migrantinnenliteratur oder was will die Vergangenheit von mir. Julia Kissinas »Frühling auf dem Mond«
20.07.2013 | Hamburg
Wenn das Wort nicht so sperrig wär, es könnte eine neue Genrebezeichnung werden: Migrantinnenliteratur.
Ein Klick in der Suchmaschine zeigt mir, es heißt Migrantenliteratur. Aber ich bestehe darauf, dass es vor allem Migrantinnenliteratur ist, die zurzeit eine große Konjunktur erlebt. Zwei Autorinnen, deren Muttersprache Russisch ist, haben beim Bachmann-Wettbewerb hintereinander den renommierten Preis bekommen: Olga Martynowa 2012, und in diesem Jahr Katja Petrowskaja. Letztere ist 1970 in Kiew geboren. Ebenda kam 1966 Julia Kissina zur Welt. Beide leben seit mehr als zwei Jahrzehnten in Deutschland. Kissina schreibt allerdings auf Russisch. Ihr Roman „Frühling auf dem Mond“, in dem sie ihre Mädchenzeit in Kiew erzählt, wurde von Valerie Engler ins Deutsche übersetzt. Es gibt dennoch eine weitere interessante Gemeinsamkeit. Die beiden schauen in ihren Texten zurück. Auf den Alltag im Sozialismus unter Breschnew und noch weiter zurück bis zur Zeit der deutschen Besatzung im zweiten Weltkrieg und auf eines der furchtbarsten Massaker der SS, die Ermordung von 33 000 Juden in der Kiewer Schlucht Babi Jar. In Petrowskajas Preisträgertext „Vielleicht Ester“ geht es um die Urgroßmutter der Erzählerin, die bei dem Massaker von Babi Jar ums Leben kam. Bei Julia Kissina ist es eine Frau, die dem Morden in der Schlucht Babi Jar entkommen ist, weil sie ein Verhältnis mit einem deutschen Offizier hatte. Die Nebenhandlung zieht sich durch das Buch und hat direkte Auswirkungen auf das Leben der Ich-Erzählerin. Einerseits also bewusstes Erinnern bei Petrowskaja, andererseits das ungewollte Daraufgestoßenwerden, das nicht Drumherum-Können um die Vergangenheit bei Julia Kissinas „Frühling auf dem Mond“. In beiden Fällen ist es die Vergangenheit der Opfer. Veröffentlicht und gelobpreist im Land der Täter, in Deutschland. Der deutsche Literaturbetrieb reagiert mit schon masochistischer Verliebtheit auf solche Texte, in denen der Migranten-Finger die deutsche Schuldwunde kitzelt. Misstrauisch fragt man sich: warum?
Vielleicht ist Petrowskajas „Vielleicht Ester“ gar kein Geschenk an die deutsche Literatur, wie Hildegard Keller in ihrer Laudatio auf die Bachmannpreisträgerin pathetisierte, sondern eine willkommene Verkitschung der Vergangenheit. Für den Vater der Ich-Erzählerin, 1941 noch ein kleiner Junge, wurde ein Feigenbaum von der Ladefläche des für die Evakuierung bereitgestellten Lasters geräumt. Wäre die Feige auf dem Laster geblieben, würde es die Ich-Erzählerin nicht geben, gibt Petrowskaja zu bedenken. Darf man die Vergangenheit so zurechtbiegen? In Kiew hat es im Zusammenhang mit den Geschehnissen um Babi Jar keine Evakuierungen gegeben, erzählte Katja Petrowskaja selbst in einem Interview. Und kann man es glauben, dass die Literaturbeschleuniger des Täterlandes sich so bereitwillig in die Schockstarre der Betroffenheit und Rührung versetzen lassen? Soll das ein Pflasterchen für die Schuldwunde sein? Oder ist es eine Art Verdrängungsmechanismus?
Aus Julia Kissinas „Frühling auf dem Mond“ lässt sich der Handlungsstrang, der im Zusammenhang mit den Babi Jar-Geschehnissen steht, schwer herauslösen. Zu komplex ist diese Komposition des Textes. Es soll dennoch versucht werden: In der grauen Stadt Kiew erzählt eine böse Alte der pubertierenden Ich-Erzählerin die böse Geschichte ihrer Schulfreundin Vera, die hilflos sabbernd neben ihr im Altenheim liegt. Sie hat Babi Jar überlebt, weil sie einen deutschen Offizier zum Geliebten hatte. Und das Kind, das Vera erwartete, hat sie auf Anraten der bösen Freundin erstickt. Später aber lernt die Ich-Erzählerin das „erstickte Kind“ kennen, es ist die Mutter einer Freundin. Da das „erstickte Kind“ unter einer anderen Identität aufwuchs, fragte sich die inzwischen erwachsene Frau, wer ihre Eltern sind. In einer spiritistischen Sitzung erfährt sie vom Geist Garibaldis, dass ihr Vater ein Deutscher war. „Ich habe mich so gefreut, auch wenn ich die Tochter eines Faschisten bin.“
Da steckt die Ambivalenz drin, die Literatur lesenswert macht. So skurril und abgedreht die Geschichte klingt, wir alle wissen doch, dass nichts skurriler ist als das Leben selbst und Kissina unternimmt den Versuch, dem nachzuspüren. Den sowjetischen Alltag mit Staub, KGB und Juri Gagarin macht man sich in den eigenen vier Wänden „schön“. Vor allem mit Ausflügen in den Spiritismus, auch gegen den Protest des Vaters, der als Materialist so etwas in seinen vier Wänden nicht dulden kann. Skeptisch, mal angezogen, mal abgestoßen von dem unmaterialistischen Geschehen hilft die Ich-Erzählerin einer Freundin, den toten Gerad Philippe zu heiraten. Oder man vergnügt sich mit einem Salz aus „schottischen Adern“, das allerdings seinen Besitzer hinter Gitter bringt. Der Leser bekommt den ganzen Wahnsinn einer Pubertierenden hingeblättert, die ihre erste Blutung für eine Krebserkrankung hält und erstaunt registriert, dass sie weiter lebt. Ihre Skepsis gegenüber der Erwachsenenwelt – Verrat, Verrat – mündet in Hass, Ablehnung und Ekel, auch sich selbst gegenüber, also in den Gefühlscocktail, der hinuntergekippt werden muss, damit man selbst erwachsen werden kann.
Und unmerklich ist in die Wut und Wirren einer Kiewer Pubertierenden dieser historische Faden eingewebt, der diese Nachgeborene mit den Ereignissen von Babi Jar verbindet. Aber sie will das eigentlich gar nicht wissen, sie fühlt sich belastet mit diesem Wissen, den Erzählungen der Eltern über den Krieg: „und ich wurde rasend, wenn Mutter zum wiederholten Male mit Leidensmiene vom Krieg zu erzählen begann.“ Und sie muss zuschauen, wie die Nachwirkungen dieser Ereignisse die Ehe der Eltern sprengt.
Möglicherweise sind es ein paar Skurrilitäten zu viel in diesem Roman, aber sehr überzeugend ist die Darstellung der ambivalenten Haltung einer Vierzehn- oder Fünfzehnjährigen, die mit Verwunderung und Ablehnung, mit Neugier und Hass auf alles sie Umgebende reagiert, einschließlich auf sich selbst und auf die Geschichte, zu der sie gehört.
Julia Kissinas „Frühling auf dem Mond“ ist ein Stück Literatur einer in Deutschland lebenden Ukrainerin, die sich nicht der Vergangenheit bedient um die eigene Existenz zu rechtfertigen, sie zeigt statt dessen eine Suchbewegung nach dem Ich, in dem zwangsläufig ein Stück Vergangenheit steckt. Auch hier bleiben in der Bewertung die Superlative nicht aus. Ein Rezensent schreibt, man könne das Buch im Regal getrost zwischen die beiden „Wladimirs“ Kaminer und Nabukow stecken. Auf dem Cover des Buches, das die Aktionskünstlerin Kissina selbst gestaltete, steht gar: „Ein Meisterwerk aus dem Geiste von Fellini s Amacord“. Ich finde das Buch gut und enthalte mich der Lobhudelei und schließe stattdessen mit einem schönen Satz aus Kissinas letztem Kapitel: „Und dann wurde ich irgendwie rasend schnell erwachsen“.
Exklusivbeitrag
Julia Kissina: Frühling auf dem Mond. Roman Übersetzt von Valerie Engler. 248 Seiten. ISBN 9783518423639 18,95 Euro Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Simone Trieder hat zuletzt über „Helen Hessel« - eine Biografie von Marie-Françoise Peteuil auf Fixpoetry geschrieben.