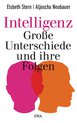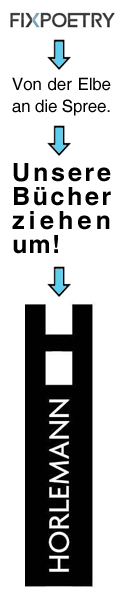weitere Infos zum Beitrag
Sachbuch
Argumentation unter Ausschluss von Störfaktoren. »Intelligenz. Große Unterschiede und ihre Folgen« von Elsbeth Stern und Aljoscha Neubauer.
31.07.2013 | Hamburg
In einer verständlichen, und auch für Laien nachvollziehbaren Sprache, erklären Stern und Neubauer in ihrem Buch, was Wissenschaftler unter Intelligenz verstehen und welche gesellschaftspolitischen Konsequenzen ihrer Meinung nach daraus gezogen werden sollten.
Das ist schon darum mutig, weil sich die Autoren angreifbar machen, indem sie zahlreiche Alltagsmythen über Wert und Bedeutung, aber auch „Herkunft“ der Intelligenz entkräften. Was für ein Reizthema „Intelligenz“ ist, zeigt sich aktuell in der hitzigen Diskussion auf Zeitonline zu einem Artikel der Autoren, in dem diese das Anliegen ihres Buches in zehn Zeilen verdeutlichten. Bislang gingen 157 Kommentare zu dem am 21.03. d. J. erschienenen Artikel ein.
In ihrem Buch „Intelligenz. Große Unterschiede und ihre Folgen“, geht es Stern und Neubauer ebenso sehr darum, neben den Hochbegabten auch die Begabten zu fördern, als auch klar zu stellen, dass nicht jedes Kind, nur weil es aus einem Akademiker Haushalt kommt, zwangsläufig für einen Gymnasialbesuch geeignet ist. Intelligenz braucht zwar eine fördernde Umwelt, um sich entfalten zu können, die Grundlage, der Grundstock an Intelligenz ist hingegen angeboren. Es gibt handfeste Beweise gegen die Vermutung, dass „einzelne Familien oder Gruppen immer intelligenter oder immer weniger intelligent würden. Von Generation zu Generation werden die Karten neu gemischt, und die Vererbung tendiert nicht in Richtung der Extreme, sondern zur Mitte.“
Umso wichtiger ist es, die Vielfalt der Intelligenz auszuschöpfen, indem eine möglichst homogene Umwelt geschaffen wird, was die Entwicklung und Förderung von Intelligenz angeht. Damit sind keine absurden pränatalen Frühförderungsprogramme gemeint, in den ersten Lebensjahren genügt eine liebevolle Zuwendung, damit das Kind sein ererbtes Potenzial entfalten kann. Stern und Neubauer zielen hier vielmehr auf Kindertagesstätten und Grundschulen ab, deren Bedeutung noch immer nicht hinreichend gewürdigt und erkannt wird. Obwohl die „Hardware“ Intelligenz genetisch bedingt ist, besteht ein Spielraum zur Erweiterung der Intelligenz durch Lernprozesse, auch „weniger intelligente Personen [können] die Effizienz ihrer Gehirnnutzung steigern, wenn sie sich nur lange genug mit einer speziellen Aufgabe oder Wissensdomäne beschäftigen.“
Aus der Tatsache, dass Intelligenz weder ein Familienerbe, noch eine Gabe ist, die sich von selbst entfaltet, leiten Stern und Neubauer ihre Forderung nach besseren Schulen ab. Denn die Schule macht den Unterschied. Wobei nicht die schulischen Rahmenbedingungen entscheidend sind, sondern die Qualität des Unterrichtes. Diese sicher zu stellen, ist oft erstaunlich einfach und mit wenig Aufwand zu gewährleisten, wie man aus dem Beispiel Finnlands lernen kann: „Wenn die Lernangebote weniger am Alter der Kinder als an ihrem Lernstand ausgerichtet sind und altersgemischte Lerngruppen ganz selbstverständlich zur Schulkultur gehören, können Kinder, die bis zum Alter von 15 Jahren von den gleichen Lehrpersonen im gleichen Schulhaus unterrichtet werden, Spitzenleistungen erbringen.“ Also müsste weder so früh entschieden werden, welcher Schultyp für welches Kind in Frage kommt, noch können Fragen nach Inklusion, Notengebung usw. mit Ja oder Nein beantwortet werden, entscheidend ist die Umsetzung in Lernwirksamkeit und dafür sind allem voran, Lehrer notwendig, die überdurchschnittlich intelligent sind und die Fähigkeit mitbringen, jedes Kind individuell zu fördern. Wobei der Kreis zur Notwendigkeit von Intelligenztests sich schließt. Die Berufswahl, so plädieren die Autoren, sollte nämlich nicht nach den Interessen, sondern nach der vorhandenen Intelligenz erfolgen.
Bis zu diesem Punkt kann man den Autoren gut und gerne folgen, ihre Argumentation baut klug aufeinander auf und ist nachvollziehbar. Dennoch bleiben Fragen und Zweifel. Mischen sich da nicht doch bisweilen Ursache und Wirkung? Spätestens wenn behauptet wird, dass keine andere Größe außer der Intelligenz nicht nur beruflichen Erfolg, sondern auch privates Glück so gut vorherzusagen im Stande ist, wie der Intelligenzquotient, klingt das für mich wie wissenschaftliches Handlesen.
Es fällt schwer, den Verdacht zu unterdrücken, dass der Intelligenz, weil sie sich so gut messen lässt, eine derart hohe Bedeutung zugestanden wird, als Grundlage für Glück, Gesundheit und Erfolg. Ob deswegen Persönlichkeitsmerkmale, die sich weniger gut operationalisieren lassen, wie Disziplin, Kreativität und Verlässlichkeit, tatsächlich weniger aussagekräftig sind, wage ich zu bezweifeln. All das ändert jedoch nichts an der Berechtigung des Aufrufs, die wichtige gesellschaftliche Ressource Intelligenz nicht zu vergeuden. Doch auch hier bleibt ein fader Nachgeschmack, wenn man sich historisch einmalige Jugendarbeitslosigkeitsraten ins Gedächtnis ruft. Auf der einen Seite die Wissensgesellschaft und auf der anderen die Realität einer Jugendarbeitslosigkeit von über 50 %. Ich hätte mir ein zwei Sätze gewünscht, die diese Gegensätze verbinden, verständlich machen, zumindest in die Diskussion einbinden.
Macht Intelligenz automatisch unabhängig, kritisch, mutig? Das ist vermutlich keine wissenschaftliche Frage, gesellschaftspolitisch relevant ist sie dennoch. Auch wenn die Autoren sie nicht stellen. Derartige Überlegungen gehören scheinbar zu den Störfaktoren einer streng wissenschaftlichen Diskussion. Schade, dass dieses streitbare Buch, sich so wenig einer weitreichenderen und interdisziplinären Diskussion öffnet.
Bleibt zu hoffen, dass Begabung und Intelligenz baldmöglichst auf eine Umwelt treffen, in der der Mut quer und anders zu denken, sich entwickeln kann, damit neue Wege beschritten werden, die Perspektiven für junge und alte Menschen bieten, jenseits der marktwirtschaftlich globalisierten Sackgassen.
Elsbeth Stern | Aljoscha Neubauer. Intelligenz. Große Unterschiede und ihre Folgen. Sachbuch. ISBN 978 3 421 04533 1. 19,99 Euro. Deutsche Verlagsanstalt München, 2013.
Elke Engelhardt hat zuletzt über »Treideln« von Juli Zeh auf Fixpoetry geschrieben.
© Fixpoetry.com 2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com
Sie können diesen Beitrag gerne verlinken