Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, Anne Carson zu übersetzen. Ich hatte sie immer mit all dem gelesen, was in solchen Fällen auftritt: Interesse und Aufmerksamkeit, tiefer Respekt und Gewinn, auch Bewunderung. Aber ich verspürte – um eine Zeile aus der Oper »Decreation« abzuwandeln – nach ihr keinen Hunger. Man musste mich nicht – wie es im Essay »Decreation« heißt – davon abhalten, diese Seiten aufzuessen. Nie geriet ich in diesen ungeheuerlichen Zustand, in dem das Gelesene beim Lesen den eigenen Körper, das eigene Denken zu verdauen scheint und man doch in diesem Aufruhr der Aufnahme bei sich ist, in extremis.
Es waren, wie ich nun im Nachhinein meine, die besten Voraussetzungen, um eine Übersetzung zu versuchen. Als der Fischer-Verlag mich anfragte aber, zögerte ich. Darf man eine solche, umfangreiche Arbeit ohne Verliebtheit beginnen? Mein Zögern wagte sich nicht aus der Deckung; schließlich waren da genug andere Dichterinnen und Dichter, die diese Aufgabe an meiner statt hätten übernehmen können – so gut wie ich, die eine oder andere vielleicht besser – und bestimmt auch übernommen hätten. Immerhin ist Carson längst legendär. Vielleicht nicht in Deutschland; vielleicht in Deutschland nur unter den Dichtenden; aber in den meisten anderen Ländern hat man auf breiterer Basis begriffen, was den meisten anderen Ländern hat man auf breiterer Basis begriffen, was das vermutlich gewesen sein wird: Anne Carson. »Sie hat in ihrem Haus drei Schreibtische«, raunte mir 2013 ein indischer Autor auf einem Festival zu, »three desks! Für jede Arbeit einen – poetry, essay, visual art.« Er wisperte diese Information – als hätte Carson auch noch ein drittes Ohr, mit dem sie über Kontinente hinweg hören kann, was über sie gesprochen wird. »She’s wonderful.« Vielleicht kann man hier etwas Erhabenem beim Entstehen zusehen, denn wie Carson in ihrem Essay »Schaum« in »Decreation« schreibt, ist das Erhabene nicht zuletzt »eine Dokumentationstechnik«, besteht aus Zitaten und Gerüchten, die sich ausbreiten und wie eine Woge die Hörenden mitnehmen, denen so gestattet wird, an einem »elektrisierenden Lebensüberschuss« teilzuhaben. 3 Schreibtische!
Meinem Zögern versuchte ich, mit zwei Tests zu begegnen, die wenigstens die Frage nach der prinzipiellen Befähigung zu dieser Aufgabe klären sollten. Der erste: das Buch irgendwo aufschlagen, die schwierigste Stelle auf dieser Seite nehmen und schauen, ob sich über Nacht drei mögliche Lösungen abzeichnen. Die Problemlotterie hätte besser nicht ausgehen können. Ich landete in »H & A«, einer Szenenfolge zu Heloise und Abelard, Szene 10, 1. Satz: »I feel bad«. Dieser Satz ist unmittelbar verständlich, es fallen einem x Lösungen ein – und alle sind sie keine. Weil die deutschen Wendungen an anderen Stellen und in anderen Körperhaltungen in der Sprache herumliegen als im Englischen. Weil sie eine andere Textur haben. Da braucht man die Nacht gar nicht abwarten, da kann man die Panik – alle Wörterbücher, alle Nachschlagequellen, alles komplett sinnlos! – sofort genießen. Ich dimmte meine Erwartungen runter. 1 Nacht, 1 Wendung, 1 Lösung. Ich könnte da eine wichtige kanadische Autorin übersetzen, sagte ich zu einer Freundin am Telefon, aber mir ist nicht recht wohl bei der Sache. Das blieb mir bis zum Morgen und dabei blieb es dann tatsächlich auch im Text: »Mir ist nicht wohl«. Ist nicht dasselbe wie »I feel bad«? Nein, eh nicht. Eben.
Trotzdem war ich erleichtert, dass sich überhaupt etwas Gangbares ergeben hatte, und wertete diese abgespeckte Version des Tests als bestanden. Ich vermutete schon, dass diese Unterschiede in der Textur der Sprachen sich durch die gesamte Übersetzung ziehen und kaum auflösbar sein würden. In einem von Carsons Gedichten aus dem Zyklus »STATIONEN « heißt es: »Man trifft Eis in verschiedenen Graden«, »man kann nicht darauf stehen«. So habe ich auch Carsons Gedichte wahrgenommen: Man läuft auf ihnen wie über eine Eisfläche, das Gleichgewicht wäre stehend kaum zu halten, man gleitet über das Eis, »seine Farben – blau weiß braun schwarzgrau silber – sind variabel«. Und plötzlich gähnt etwas, sichtbar wird, wie weit es unter der Oberfläche nach unten geht, Schwindel, man stolpert oder sinkt sogar. Um so etwas zu erzeugen – und nicht etwa in einer Paraphrase davon bloß zu erzählen – muss die Sprache transparent, kühl, durchscheinend sein.
Carsons Gebrauch des Englischen ist genau dies.[1] Und das Englische erlaubt so etwas. In seinen einsilbigen Wörtern, der strengen Satzordnung, seinen Artikulationsorten, dem Verhältnis zwischen Vokalen und Konsonanten. Und in seiner ganz eigenen Begabung zur Abstraktion, die sich aus den verschiedenen Herkunftssprachen und damit Färbungen seiner Wörter ergibt. Das Englische kann Eis.
Und das Deutsche tut sich schwer damit.[2] Das Deutsche ist fleischig. Nehmen Sie z. B. das Wort ›Fleisch‹ selbst. Sprechen Sie es aus. Die Zähne reiben sich an der Lippe, dann rutscht das Wort nach hinten, Zunge an Gaumen, der Mund bricht auf, in ein weites ›a‹, das in etwas zwischen ›e‹ und ›i‹ verengt wird und alles schließt auf ein sattes, verwischtes Gezische. Dieses Wort spricht sich, als hätte man sich einen dicken Brocken Fleisch in den Mund gesteckt und würde nun mit einer ersten, ausgreifenden Kaubewegung darauf losgehen. Das ist großartig; und liegt vor allem im Diphthong, in der Bewegung des Öffnens und Schließens, von hinten nach vorn – das englische ›flesh‹, abgesehen davon, dass es auch semantisch schmaler ist, klingt demgegenüber windig, zerfasert. Und es liegt an der lautlich-semantischen Nachbarschaft, die mit ›flash‹ und ›flush‹ im Englischen völlig anders ausfällt. Und erst ›meat‹! Da hat man das Fleisch noch vor sich, von dünnen Strängen Fett durchzogen wie von bereiften Zweigen; gleich wird es mit spitzer Gabel aufgespießt. Und wo der Vorgang als tatsächliches Essen konkret würde, verabschiedet sich das Englische mit ›veal‹ und ›beef‹ in den romanischen Sprachraum. Das ist selbstverständlich nur ein Beispiel, das sich so nicht verallgemeinern lässt; aber es bildet die Problematik, wie ich sie erlebt habe, gut ab: wie das in Carsons Texten dünn geschabte, gefriergetrocknete Fleisch im Deutschen immer noch tropft und dampft.
Diese Überlegung selbst ist sehr fleischlich. Und findet in einem gewissen Abstand zu Carson statt, die im Essay »Decreation« erst die »kompositorische Einheit aus Klang und Gedanken« im Sappho-Fragment 31 konstatiert, um sich dann von der Lautlichkeit umgehend wieder abzuwenden: »wir wollen den gedanklichen Aspekt betrachten«. In der Übersetzung (auch der Prosa) aber war genau das nötig: eine Konzentration (auch) auf die klanglichen Aspekte – wie sie nicht nur im einzelnen Wort, sondern nicht zuletzt in den grammatikalischen Ordnungen stecken –, ebenso eine Hinwendung auf die Interaktion klanglich-semantischer Elemente im Satzbau. Nur sie konnten verhindern, dass das Deutsche Carsons Klarheit in der Gedankenführung zudeckt – und dass die »kompositorische« und klangliche »Einheit« des Bandes verloren geht.
Denn was auf dem Umschlag der englischen Taschenbuchausgabe von »Decreation« steht, ist irreführend: »One of the most interesting gatherings of material that any poet has published within living memory«, heißt es dort. Als habe man es nicht mit einer Komposition zu tun, sondern mit einem Gewühl aus den Textsorten Gedicht, Essay und Opernlibretto, die zufällig gemeinsam in einen Kessel gefallen sind. Und als könne der Leser sich nun an dieser »Kochstelle« aus den unverbundenen »Bröckchen« beliebig etwas herauspicken, zum Beispiel die »Ode an den Schlaf«, aus der die zitierten Wörter stammen.
Ich muss zugeben, dass ich bei der ersten Bekanntschaft mit diesem Buch ebenfalls den Verdacht hatte, es könnte eine Art Sammelstelle für Disparates sein. Erst mit der Zeit ist mir klar geworden, wie eng diese Texte verwoben sind, wie sehr sie aufeinander verweisen. An der Oberfläche, natürlich, wenn z. B. im ersten Zyklus Beckett vorkommt und später ein ganzer Text sich mit Becketts »Quad« auseinandersetzt. Aber bei weitem nicht nur dort. Im Essay »Ein Lob des Schlafs«, der zusammen mit dem Gedichtzyklus »STATIONEN« die Eröffnungssequenz des Buches bildet, schreibt Carson über Telemachos’ Weg durch die Odyssee: »wie ein Kräuseln durchläuft das Wissen um den Sex die gesamte Geschichte«. In der weiteren Bewegung durch Carsons Buch zeigt sich dann langsam, dass dieser Satz ein erstes Antippen war: Denn auch durch »Decreation« läuft der Sex; weniger als explizit verhandeltes Thema, denn als subkutanes Kräuseln. Und auch seine Verwandten, Liebe und Hunger, gehen wie ein »Schaudern« (»Ode an den Schlaf«) durch diese Texte; immer auch in ihrer Verneinung, als Abwesenheit, Versagung, Versiegen. »Iss deine Suppe, Mutter, wo immer du in deinem Kopf auch bist« (»STATIONEN «). Auf einer etwas abstrakteren Ebene durchziehen die Texte Fragen wie die nach verschiedenen Formen von Wissen und Erkenntnis, nach Formen des Möglichen und Unmöglichen (in Konditionalen oder bestimmten logischen Konstellationen), die bestimmte Denkbewegungen hervorbringen oder verschwinden lassen. Solche abstrakteren Zusammenhänge formen den Lektüreprozess – die Texte nennen sie aber nicht, denn sie sind literarische Texte, die nie in einer simplen Abstraktion stecken bleiben.
Es versteht sich, dass die gedankliche Textur von »Decreation« nicht Problem, sondern Grund und Motivation für die Übersetzung war. Zu einer Schwierigkeit wurde sie aber dort, wo die Entwicklung der Überlegungen stark in ein einzelnes, unter verschiedenen Perspektiven wiederholtes Wort gebunden ist. Z. B. in das Wort ›Spill‹ im Essay »Foam« (»Schaum«). ›spill‹ ist ein flüssiges Verb, es geht ums Verschütten, Überquellen, Ausgießen; in einer übertragenen Bedeutung kann es davon reden, dass jemand sein Herz ausschüttet, oder zusieht, dass ein hübsches Stück Klatsch sich schön verbreitet. Vor allem die letzte Bedeutung zeigt: ›spill‹ lappt ins Schmutzige, quillt gewissermaßen über die schicklichen Grenzen hinaus. »Foam« hat ›spill‹ vor allem als die Verbreitung von Zitaten. Aber es geht um mehr – es geht ums Erhabene, um eine Erde, die sich selbst ausspeit, um Lava, die sich ausbreitet und – naturgemäß – jeden physischen Rahmen überschreitet, um psychische Grenzen, die man in der Teilhabe an fremden Gedanken überwindet. Ich wollte im Deutschen ebenfalls ein einziges Verb setzen, dessen verschiedene semantische Beugungszustände die Lesenden verfolgen könnten. Die plastischeren und ebenfalls flüssigen Verben, die z. B. aus ›quellen‹ oder ›strömen‹ oder ›fließen‹ ableitbar waren, ließen sich nicht durch den Text ziehen. Übrig blieb am Ende die blasseste Variante: »sich ausbreiten«, »Ausbreitung«. Dieses Wort konnte in verschiedenen Kontexten problemlos wiederholt werden und trug wenigstens die passivisch-negative Komponente einer nicht kontrollierbaren Verbreitung, etwa von Krankheiten. Innerhalb des Textes »Schaum« funktioniert diese Lösung – einigermaßen –, aber die Einbettung dieses Essays in das ganze Buch ließ sich nicht aufrechterhalten.
Der nächste Abschnitt nämlich – »SUBLIMES« (»ERHABENES«) – beginnt mit einem Bild aus »Il Deserto Rosso«: Monica Vitti, zwei Männer, an den weißen Wänden große, teils verschmierte Flecken. Am rechten Bildrand stehen Farbeimer, aber die Assoziation ist: Blutflecken. Unter dem Bild steht: »Everything might spill.« ›Spill‹ in »Decreation« blendet die Dimension des Blutvergießens nicht aus; Ausbreitung hingegen sehr wohl. ›spill‹ als Blutvergießen wirkt auf den – durchaus nicht gewaltfreien – Essay »Foam« zurück. Und es wird gewiss erinnert werden in einem weiteren Text, »LOTS OF GUNS«, in dem nun nicht nur ein Wort, ›gun‹, sondern die Waffe als Konzept und Gegenstand in einer Reihe von Textsorten durchdekliniert wird; nicht ohne Absurdität und Aberwitz. Da reicht die ›Ausbreitung‹ nicht hin; und ich habe es auch nicht geschafft, diese Berührung doch noch irgendwie herzustellen.
Lediglich etwas anderes ist uns im Lektorat noch gelungen: Das deutsche Wort für ›spill‹ konnte mit dem Titelwort ›Schaum‹ verschränkt werden – mit ›überschäumen‹ ließ sich das ›ausbreiten‹ an manchen Stellen gewissermaßen verflüssigen. ›Überschäumen‹ hat mehr Dynamik und Vehemenz – und obwohl die Verbesserung klein ist, schaue ich im Moment etwas verliebt auf sie. Und vielleicht kann sie damit sogar Gegenstand für zukünftige Tests werden –
Denn das war der zweite Test, mit dem ich herausfinden wollte, ob ich dieser Übersetzung gewachsen sein würde – und auch dieser zweite Test wurde modifiziert, während er schon lief: Ich schaute mir die Übersetzung von ein paar Carson-Gedichten, die ich für die Neue Rundschau gemacht hatte, aus der Distanz von einigen Jahren neu an. Die meisten Texte schienen mir akzeptabel übersetzt; aber das, stellte sich heraus, war nicht die wichtigste Information. Denn ein Text war nicht akzeptabel übersetzt. Ich erinnerte mich daran, dass dies der Text gewesen war, für den ich damals sofort entflammt war. Er war mir großartig erschienen, so wonderful, so nah.
Und so hatte ich ihn auch übersetzt: nah – an mir, und in der Tat ein Wunderwerk – der ›spill‹, mit der meine eigene Phantasie manche Stellen des Gedichts überspülte. Die bestimmt etwas zufällige Textauswahl von damals lieferte mir nun die entscheidende Information: die »Ferne« – um ein Zitat Carsons von Margarete Porete abzuwandeln – diese Ferne, in der ich Carsons Texte sah, könnte in der Übersetzung »das größere Nah« werden. Und ich hoffe, dass die Zuneigung, die während der Übersetzungsarbeit zu diesen Texten gewachsen ist – unwiderstehlich –, diese Ferne nicht zu sehr überwuchert hat.
[1] Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich sage nicht, dass Carsons Gedichte ›kalt‹ wären, etwa im Gegensatz zu ›warmherzig‹. Das sind sie nicht; aber darum geht es hier auch nicht. Es geht um Transparenz und Kühle als sprachliche Eigenschaften.
[2] Um einem weiteren Missverständnis vorzubeugen: Ich sage nicht, dass nicht auf Deutsch bereits Dinge von beispiellosem Kältegrad gesagt worden wären. Ich sage, dass das Deutsche, selbst wenn es das Grausamste, Zerstörerischste sagt, dies nicht so tun kann, dass ›kalt‹ eine sprachliche Eigenschaft würde. Wenn das Deutsche das Kälteste und Grausamste sagt, bekommt es entweder ein traniges Pathos oder es knarzt vor Sperrigkeit, kracht wie aus rohen Klötzen zusammengezimmert, ist eine Stube mit verstaubter Luft und einem Schreibtisch, über dem ein armes Hirn sich zu Totholz versteift, ächzt unter der Bürde seiner sich verkeilenden Gedankenstümpfe. Manchmal tut es das auch schon, wenn es Harmloseres sagt, wie in poetologischen Essays oder nicht decodierbaren Schreiben vom Finanzamt.
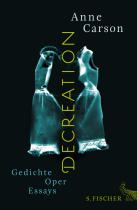
Anne Carson ist eine der große Lyrikerinnen der Gegenwart, eine Meisterin, deren oszillierende Kreativität weit ausgreift: von Gedicht zu Essay, von Oper zu Ballett findet sie Gesten, um die Gegenwart zu bannen. Sappho, Simone Weil, Monica Vitti – mit ihnen führt Anne Carson Telefonate: Stimmen und Ideen erreichen sie über eine Spanne von Jahrhunderten und auch nur Tagen. Ihre Fragen bringen alle Gewissheiten ins Wanken: das Selbst, die Form, die Identität, das Geschlecht. Im Erforschen dieser Fragen entsteht eine zartes und widerständiges Gewebe aus Bildern, Worten und Gedanken, das seit Jahrzehnten die Bewunderung der Leser und Dichter auf sich zieht: »unbestechlich« (The New York Times).






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /