 Schuhanprobe in Low Cost Village nach dem Awareness-Training. Die Kinder, die Ebola überlebt haben, bekommen neue Plastikschuhe, die auch für die Regenzeit geeignet sind. Einige müssen noch in sie hineinwachsen. Aber vielleicht sind das genau die Siebenmeilen-Stiefel, die ihnen in ihrer Kollektion noch gefehlt haben.
Schuhanprobe in Low Cost Village nach dem Awareness-Training. Die Kinder, die Ebola überlebt haben, bekommen neue Plastikschuhe, die auch für die Regenzeit geeignet sind. Einige müssen noch in sie hineinwachsen. Aber vielleicht sind das genau die Siebenmeilen-Stiefel, die ihnen in ihrer Kollektion noch gefehlt haben. Rainer Merkel: Von Cap Anamur habe ich als Psychologe 2008 das Angebot bekommen, in Monrovia zu arbeiten. Für ein Jahr war ich da und wir haben die einzige Psychiatrie im Land geleitet, die jetzt auch noch immer existiert. Als ich jetzt zurückgekommen bin, hatte ich die große Sorge, dass damalige Kollegen an Ebola erkrankt sein könnten. Aber zum Glück war nur eine betroffen – und die hat überlebt. Im Moment haben sie 13 Patienten und nehmen aus Sicherheitsgründen keine mehr auf.
Warum und wann bist du jetzt wieder gefahren? Welche Vorbereitung erfordert eine solche Reise?
Ich war vom 7. bis 14. November in Liberia, also bis vor 4 Wochen. Ich hatte das Gefühl, ich müsste das machen. Jemand müsste hinfahren und etwas über das Land schreiben, und zwar einen Text, in dem keine Menschen in Schutzanzügen vorkommen, in dem nicht immer nur vom Tod die Rede ist. Aber jetzt ist in meinem Buch doch oft vom Tod die Rede, das ließ sich nicht vermeiden. Ich wäre, ehrlich gesagt, lieber nach Irak oder Syrien gefahren als in ein Ebola-Gebiet. Die Ängste, die man vor allem vor der Reise hat, erscheinen einem zwar etwas irreal, aber sie sind dann doch ziemlich groß – und die Gefahr ist, wenn man dort ist, eben doch eine reale. Die Angst war trotzdem vor und nach der Reise größer als in den acht Tagen, in denen ich dort war. Jetzt im Nachhinein denke ich, das Buch war ein Versuch, dieser befremdlichen Erotisierung des Todes etwas entgegenzusetzen. Ganz frei machen konnte ich mich davon aber wohl nicht. Die ganze Zeit nur davon zu erzählen, wie ich mit den gutgelaunten Studenten der liberianischen NGO in einem klapprigen Bus sitze und wir zusammen lustige Anti-Ebola-Songs singen, war dann doch nicht möglich.
Wie würdest du die jetzige Situation in Liberia beschreiben?
Die Lage hat sich offenbar etwas beruhigt, aber sie kann sich auch jederzeit wieder verschlechtern. Es gibt ja keine Erfahrungswerte, wie sich Epidemien solchen Ausmaßes entwickeln. Gerade im Landesinneren gibt es immer wieder neue Fälle. Und das »contact tracing« funktioniert überhaupt noch nicht. Der schwedische Statistiker Hans Rosling hat gesagt, Ebola sei wie ein Ungeheuer, das plötzlich aus dem Wasser kommt, jetzt aber wieder untergetaucht ist. Ob es und wann es wieder auftaucht, kann niemand sagen. In Sierra Leone, dem Nachbarland von Liberia, steigen die Zahlen ja wieder.
In wieweit hat sich das Land zwischen deinen beiden Reisen verändert? Kennst du noch Leute dort?
Die meisten sind weg. Viele mussten das Land jetzt auch wegen Ebola verlassen. Aus Sicherheitsgründen. Eine der wenigen, die noch da ist, ist Pandora Hodge. Sie ist die Projektkoordinatorin von Kriterion Monrovia (Facebook), einer NGO, und sozusagen die heimliche Heldin des Buches. Sie ist auch die Schwester des blinden Jungen, über den ich in dem Roman ›Bo‹ geschrieben habe. Jetzt ist sie im ganzen Land mit den Mitarbeitern ihrer NGO unterwegs und macht Aufklärungsarbeit, versucht den Menschen in den Dörfern zu erklären, wie sie sich vor Ebola schützen können. Als ich mit ihr am Telefon das erste Mal gesprochen habe, hat es mich beruhigt, als sie gesagt hat: »Ebola is not catching you. You catch Ebola.«
Gibt es Regeln, die du nach der Rückkehr aus Liberia beachten musstest?
Es gibt Richtlinien vom Robert Koch-Institut, wie man sich zu verhalten hat. Man sollte zum Beispiel mit seinem Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen. Aber es bringt natürlich nichts, wenn, wie mir das passiert ist, das Gesundheitsamt von der Regelung gar nichts weiß. Ansonsten sollte man niemandem die Hand schütteln und niemanden umarmen. Die Leute sind insgesamt schon sehr nervös und bei einem Radiointerview haben sie mich erst mal wieder ausgeladen. Ich habe dann beschlossen, mich auch bei meinen Freunden nicht zu melden und erst mal die 21 Tage Quarantäne abzuwarten. Man denkt auch die ganze Zeit über die »Fehler« nach, die man vielleicht gemacht hat. Dass man etwas angefasst hat, was infiziert gewesen sein könnte. Zum Beispiel, ob es wirklich so eine gute Idee gewesen war, die gebrannten Nüsse zu essen, die uns eine Frau geschenkt hat, deren Kinder kurz vorher an Ebola gestorben sind. Man hält die Nüsse in der Hand und überlegt für einen Moment.
Hat sich die Situation in Liberia seit deiner Rückkehr nochmal verändert? Hast du noch regelmäßigen Kontakt?
Ich telefoniere immer mal wieder mit Kriterion Monrovia. Sie haben mittlerweile 60 Studenten, die mitmachen, und jetzt haben sie auch endlich ein eigenes Büro. Sie fahren immer wieder raus in die Dörfer, wo es neben Ebola häufig auch andere gefährliche Situationen gibt. Einmal haben sie in einem Dorf übernachtet und nicht gewusst, dass die Hütte, in der sie geschlafen haben, die ganze Nacht von Männern mit Macheten umstellt war, die Leute haben gedacht, die Studenten wollten ihnen mit diesen Sprühflaschen mit Chlorlösung den Brunnen vergiften. Zum Glück ist ihnen nichts passiert und sie konnten am nächsten Morgen mit dem Awareness-Training anfangen.
Wie hast du die Form für das Buch gefunden, die ja eine literarische ist? Ist so eine literarische Reaktion auf eine solche Katastrophe angemessen?
Ich habe es so geschrieben, wie ich immer meine nicht-fiktionalen Texte schreiben. Das sind ja literarische Reportagen, bei denen es auch darum geht, die eigene Position mit zu thematisieren und die Recherche transparent zu machen. Dass der Leser nachvollziehen kann, wie ich zu meinen Informationen gekommen bin. Es ist ein Text, wie man ihn als Schriftsteller schreibt, wenn man nicht den Zwängen durch das Zeitungsformat unterworfen ist. Ob es angemessen ist, ist für mich also nicht die Frage. Es ist genauso angemessen oder unangemessen wie das, was Journalisten machen, die da hinfahren und dann etwas darüber schreiben. Und dann denkt man: So ist das also jetzt. Das ist also der Stand der Dinge.
Hast du dir in Liberia schon Notizen gemacht oder mit dem Schreiben erst nach deiner Reise begonnen?
Die Arbeit hat ja schon lange vorher angefangen. Ich habe viel gelesen, im Internet recherchiert, Interviews mit Experten geführt. Auf der Reise habe ich Graham Greene gelesen, ›Journey Without Maps‹. Und das wurde dann nach meiner Rückkehr zu einer Art Parallellektüre. Greene erreicht die Küste, schickt seine Träger ins Landesinnere zurück, während ich im Taxi sitze und auf dem Weg zum Flughafen bin. Nervös, ob meine Temperatur unter 37,5 bleibt. (Wäre sie höher gewesen, hätte ich nicht ausreisen dürfen.) An Greene habe ich aber auch gemerkt, dass so eine Reise leicht etwas Eskapistisches bekommen kann, so als würde man eine irrsinnig teure und exklusive Outdoor-Therapie machen, mit Afrika als düsterem Erlebnispark, in dem hinter jedem Baum der Tod lauert.
Vor Ort habe ich natürlich Notizen gemacht, aber zum ersten Mal auch eine Kamera und ein Aufnahmegerät dabei gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch mal machen will. Die Gefahr, dass einem Details entgehen, ist einfach zu groß. Andererseits ist die Erfahrung, so einen »Dokumentationsdruck« zu haben, »Beweise« liefern zu müssen, auch wieder interessant. Dass man die Erzählerinstanz absichtlich überfordert, dass man als »Figur« also fast untergehen kann. Aber ich bin auch froh, dass ich diese tollen Anti-Ebola-Songs von Kriterion aufnehmen konnte. Oder die Stimme von Comfort, der kleinen Nichte von Pandora. Sie sagt diesen einfachen Satz: »Ebola kills.« Das ist ja eigentlich schrecklich, und doch erfasst es in zwei Wörtern – ohne Sentimentalität, ohne falsche Gefühle – die ganze Realität. Es ist ungeheuer, und es ist ungeheuer charmant, wie sie das sagt.
Gibt es Möglichkeiten zu spenden? Würdest du sagen, dass es sinnvoll ist zu spenden?
Es wird viel zu wenig für die Bekämpfung von Ebola gespendet. Man spendet vielleicht auch deswegen nicht so gerne, weil es eben so eine düstere und beklemmende Krankheit ist und man sie lieber nicht wahrnehmen möchte. Ich mache im Januar im Literaturhaus Köln eine Benefizveranstaltung, zusammen mit Kölner Künstlern wie Peter Licht, Guy Helminger, Ute Wegmann und anderen. Mal sehen, vielleicht können wir ja ein bisschen Geld zusammensammeln. Wir würden das an Kriterion Monrovia geben, so dass sie ihre Arbeit fortsetzen können. Wir machen auch ein Skype-Interview mit Kriterion, schalten also Liberia dazu, dann kann man auch mal sehen, wie gelassen und cool die Liberianer selbst damit umgehen. Die würden sich über all das, was ich hier sage, bestimmt amüsieren. Kriterion ist ja eigentlich eine Kultur-NGO. Sie haben noch vor ein paar Wochen in den Dörfern, wo sie jetzt Aufklärungsarbeit machen, Charlie-Chaplin-Filme gezeigt. Dann kam auf einmal Ebola, und der Traum vom ersten Kino in Monrovia war vorbei. Aber vielleicht klappt es ja doch, wenn das Ungeheuer unter Wasser bleibt.
Kontakt und Spenden für Kriterion Monrovia sind möglich über:
www.facebook.com/kriterionmonrovia
www.smore.com/z75g0
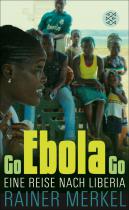
Exklusiv als E-Book: »Go Ebola Go« singen die Mitarbeiter einer liberianischen NGO auf dem Weg in die Dörfer außerhalb von Monrovia. Sie fahren dorthin, wo sonst niemand hinfährt, und leisten Aufklärungsarbeit. Rainer Merkel hat sie begleitet. Acht Tage verbringt er im November 2014 in Liberia. Er kehrt zurück in das Land, in dem er vor fünf Jahren das einzige psychiatrische Krankenhaus geleitet hat und in dem sein Roman ›Bo‹ spielt. Nur wenigen Menschen erzählt er von seiner Reise, Freunde reagieren alarmiert. Denn Liberia ist das von Ebola am schlimmsten betroffene Land, zu dem Zeitpunkt hat der Virus in Westafrika mehr als 10.000 Todesopfer gefordert. Rainer Merkel erzählt in ›Go Ebola Go‹ von den Vorbereitungen auf die Reise, von der Woche dort und der Rückkehr nach Berlin: Wie wird den Kranken geholfen? Was erzählen die Überlebenden? Wie gehen die Liberianer selbst mit der Bedrohung um? Wie lebt man mit der Angst? Das Buch ist eine literarische Reportage, die von einem Land im humanitären Ausnahmezustand berichtet.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /