1979 hatten The Clash ihr drittes Album herausgebracht. Es hieß »London Calling« und sollte ihr bestes werden. Obwohl ich damals eigentlich ein Teenage Spät-Hippie mit langen Haaren, Shell Parka und Neil-Young-Einschlag war, hat mich der Clash-Sound sofort zum Punk überlaufen lassen. Ich kannte zwar nur einzelne Stücke des Albums vom heimlichen Hören auf RIAS, dem Radio im amerikanischen Sektor, aber das reichte. Ich war Clash-Fan. Ich schnitt einzelne Songs auf meinem Stern-Kassettenrecorder mit und wir tanzten dazu auf Partys in Prenzlauer Berger Hinterhöfen. Auf einer dieser Partys traf ich Kees, einen Holländer, der sich in meine Freundin Gerlinde verliebt hatte. Dank dieser glücklichen Fügung kam ich zu meinem eigenen Vinyl-Doppelalbum von »London Calling«, das Kees aus Liebe zu Gerlinde für mich nach Ostberlin schmuggelte. Die Platte mit dem Cover, auf dem Clash-Bassist Paul Simonon seinen Fender-Bass auf der Bühne zerkloppt, hat mich seitdem durch Europa begleitet.
Mittlerweile habe ich in London studiert, postum neben Sigmund Freund gewohnt, eine Londonerin geheiratet, britisch-deutsche Kinder erzogen. London ist meine zweite Heimat, in manchen Dingen meine erste.
In letzter Zeit habe ich wieder öfter The Clash gehört, diesmal ihren Song »Should I stay or should I go«. Bisher hatte ich nur den Refrain im Kopf, nun habe ich mir den Text mal genauer angesehen.
Der Song beschreibt eine Beziehung, die schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Es wird gezankt, man nervt sich, mancher Tag ist gut, der nächste schlecht. Er fühlt sich von ihr unterdrückt, hat das Gefühl, dass sie ihn auf den Knien sehen will. Sogar seine Klamotten gefallen ihr nicht mehr, wahrscheinlich zu exzentrisch. Früher stand sie mal drauf, oder war das auch nur gespielt? Will sie ihn gar loswerden? Er weiß einfach nicht weiter.
Er nennt sie Darling. Liebt sie ihn noch? Liebt er sie noch? Haben sie sich jemals geliebt? Wenn sie ihm nur sagen würde, dass er bleiben solle, er würde es tun, sogar bis ans Ende aller Zeit, heißt es im Lied. Er weiß, egal, wie er sich entscheidet, es wird schwierig bleiben. Wenn er geht, wird es Ärger geben, und wenn er bleibt, wahrscheinlich noch mehr.
Heute ist der Song auf eine Weise politisch, wie es sich The Clash nicht vorgestellt haben. »Should I stay or should I go?« – Die Frage stellt sich Großbritannien am 23. Juni, wenn es über die Mitgliedschaft in der EU abstimmt.
Soll Britannien bleiben? Die EU ist quasi eine britische Idee. 1946 in Zürich war es kein anderer als Winston Churchill, der die Vereinigten Staaten von Europa ausrief. Er stellte sich ein vereinigtes, friedliches Europa nach dem Muster der Vereinigten Staaten von Amerika vor. Aber auch damals schon war Großbritannien nicht wirklich dabei, sondern Churchill sah seine Briten als externen Geburtshelfer für dieses bessere Europa, damit man in Zukunft nicht mehr so viel Ärger von der anderen Seite des Ärmelkanals hätte.
Die Beziehung war nie einfach. Kaum war das Land in der EU, wurde 1975 in einem Referendum darüber abgestimmt, ob man das wirklich ernst meinte. Damals kam ein klares »Ja« heraus. Aber bald gab es Streit ums Geld und um Agrarsubventionen. Trotzdem wurde Großbritannien stärker und wichtiger durch die Beziehung zur EU, hatte mehr Gewicht in der Welt. Die Wirtschaft florierte.
Auch für die eigene britische Verfassung ist die Beziehung zur EU nicht unwichtig. Großbritannien hat zunehmend Probleme, alle seine Einzelteile zusammenzuhalten, es ist ja selbst eine Union. Ginge die Beziehung zur EU in die Brüche, hat Schottland schon angekündigt, seine eigene Ehe mit Britain zu überdenken. Ohne EU könnte Großbritannien zu Kleinbritannien schrumpfen.
Oder sollte Britannien lieber gehen? Großbritannien ist eine der ältesten Nationen, Erfinder der modernen Demokratie, ehemalige und immer noch gefühlte Weltmacht, nukleare und maritime Kriegsmacht und Headquarter der Queen und von James Bond. Großbritannien sieht sich als Weltmacht, die (zufällig) in Europa liegt. Und diese Selbsteinschätzung prägt das Verhältnis zu Europa. Das Land hat etwas Weltbürgerliches. Das hat mit der Geschichte des Empire zu tun, das ja parallel mit dem Aufstieg der EU unterging, aber doch noch irgendwie da ist. Das frühere Empire nennt man jetzt Commonwealth, das über 50 Länder in einem losen Verbund umfasst und alle paar Jahre seine eigene Olympiade, die Commonwealth Games, aufführt.
Großbritannien mag sein Empire verloren haben und große Teile seiner Industrie, aber es hat immer noch andere weltbewegende Macht: tolle Universitäten, Weltarchitekten, Parks und Gärten, die Premier League, Monty Python und die BBC. Es hat eine passable Berufsarmee und sitzt permanent im UN-Sicherheitsrat. Außerdem ist es eines der wenigen Industrieländer, das seit Jahren seine Verpflichtung ernst nimmt, 0,7 Prozent seiner Wirtschaftsleistung in die Entwicklungshilfe zu stecken. Kann Großbritannien also ein Weltbürger sein, ohne sich zu fest an Europa zu binden? So ähnlich vielleicht wie die Schweiz und Norwegen?
Vielleicht können sie ja auch nur Freunde bleiben, Brüssel und London. Den Schlüssel zum gemeinsamen Markt würde Britain schon ganz gern behalten. Aber das ginge nur, wenn es weiter die EU-Hausregeln einhält. Bisher kann es diese Regeln mitbestimmen. Nach einer Trennung muss Britain die EU-Regeln einfach nur akzeptieren, ohne mitzubestimmen. Wenn sie Freunde bleiben wollen.
Und wie wäre das mit den gemeinsamen Freunden. Werden sie Britain treu bleiben oder werden sie sich auf EU’s Seite schlagen? Wahrscheinlich auf ihre Seite, schwant es ihm. Die Amerikaner haben das schon offen gesagt und die Chinesen. Putin findet wahrscheinlich eine EU ohne Britain ganz gut. Aber das sind nicht die Freunde, die Großbritannien im Auge hatte.
Wenn ich Klarheit brauche zu den wichtigen Fragen Großbritanniens, wie Immobilienblase, Macht der Banker, Fußball, dem Euro und ob Britain in der EU bleiben soll, gehe ich mit meinem Schwager Sean in den Black Leon Pub. Es wird zivilisiert diskutiert zwischen Runden von dünnem Bier, die meist als Anlass zum Themenwechsel genommen werden. Jedes Thema hat ein Pint Zeit, dann ist das nächste dran. Nach einem Pint ist man sich einig, dass es gut ist, dass Britain das Pfund behalten hat, nach dem nächsten Pint, dass Deutschland eine gute Krise hatte, beim Pint darauf ist man sich nicht mehr einig, ob Britain überhaupt Mitglied der EU ist, und wenn ja, was das eigentlich bedeutet. Dann kommt Klubfußball, was auch mehrere Pints diskutiert werden kann. Zur Fußball-EM werden die Hoffnungen an das englische Team wieder unrealistisch hoch gehängt. Immerhin war England ja mal Weltmeister, vor 50 Jahren. Der Pub ist ein öffentliches Haus, ein Wohnzimmer, Stammtisch, soziales Netzwerk, Kontaktanzeigen-Marktplatz und mehr. Und wenn man etwas vom Gefühl der Briten zu Europa erfahren will, ist das kein schlechter Anlaufpunkt.
Auch nach der Diskussion im Pub glaube ich, dass Großbritannien mit der EU besser fährt als ohne. Hier kann Britain die wichtige Nation bleiben, als die es sich fühlt und die es eben auch ist. Ohne EU-Mitgliedschaft wird das schwerer, gerade auch weil sich Britain allein beweisen muss, und für einen eigenen globalen Status einfach nicht mehr genug Substanz da ist. Das können die Briten innerhalb der EU überspielen und auch zum Teil positiv kompensieren. Und wahrscheinlich wird das Vereinigte Königreich nur als EU-Mitglied selbst vereinigt bleiben. Es geht also auch um britischen Selbsterhalt.
Im Clash-Song fragt er »Darling, du musst es mir sagen, soll ich bleiben oder soll ich gehen?«
Sie, die EU, will, dass Britain bei ihr bleibt. Sie weiß, es wird weiter kompliziert bleiben, wie in den meisten Beziehungen. Und sie weiß auch, dass sie selbst alles andere als perfekt und einfach ist. Auch deshalb braucht sie Britain, um besser zu werden. Ohne Britain würde die EU ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger wohlhabend sein. Aber das ist nicht der Punkt. Ihr würde die britische Weltläufigkeit fehlen. Er ist ein guter Redner, ein Gärtner, und ein guter Soldat, wenn es darauf ankommt. Vor allem der britische Humor, der würde fehlen. Ohne Britain würde es langweiliger werden. Und das kann sich die EU nun wirklich nicht leisten.
Also, lass es uns nochmal versuchen. Vielleicht sogar bis zum Ende aller Zeit.
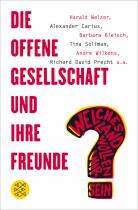
Harald Welzer, Andre Wilkens und Alexander Carius geben zusammen den Debatten-Band ›Die offene Gesellschaft und ihre Freunde‹ heraus. Die Frage, welches Land wir sein wollen, ist zu wichtig, um zwischen parteipolitischem Kalkül zerrieben zu werden. Wir müssen die Debatte führen: Wollen wir eine offene Gesellschaft sein, geleitet von Freiheits- und Menschenrechtsidealen, oder eine exklusive Gesellschaft, die ihre Identität vor gefühlten äußeren Bedrohungen sichert? Und wenn wir eine offene Gesellschaft sein wollen: Was sind wir bereit, dafür zu tun? Zum ersten Mal debattiert eine Gesellschaft über sich selbst und über diese Frage, analog, vor Ort.
Lesen Sie nun die wichtigsten Beiträge!






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /