Moshe Kahn ist nicht der Autor des 1400-Seiters ›Horcynus Orca‹. Das ist Stefano D’Arrigo. Moshe Kahn ist der Übersetzer, was aber in diesem Fall heißt: ein sprachmächtiger Nachbildner. Mit dem Moderator Tobias Eisermann war er kürzlich zu Gast im Düsseldorfer Heine-Haus. Am nächsten Morgen, auf dem Weg zu unserem Treffen, versuche ich mir eine nach acht Jahren Arbeit am Text befreite Euphorie vorzustellen. Geschafft! Das Buch endlich Wirklichkeit geworden und wunderbar ausgestattet! Begeistert besprochen und auf der Bestenliste! Und statt der Einsamkeit vor dem Bildschirm nun Interviews und Trubel auf der Leipziger Buchmesse, Deutsch-Italienischer Übersetzerpreis in Berlin, Veranstaltungen da und dort, wie gestern in dem gepackt vollen, schönen Saal…
Anstrengend mag das sein, aber bestimmt auch ein Genuss. Moshe Kahn, groß, gelassen, standfest und gut gelaunt, gibt freundlich Auskunft.
Geboren wurde er 1942 in Düsseldorf, seiner Familie gelang die Flucht in die Schweiz. ›Moshe‹ war ein Trotzname, er bedeutete: sei, der du bist. Kahn erwähnt das nur nebenbei, wie auch den Wunsch der Mutter, dass ihr Sohn Bankier werden solle – wie der sagenhaft reiche Großonkel Otto Hermann Kahn, der die New Yorker Met fast allein finanzierte.
Stattdessen arbeitete er nach dem Studium als Regieassistent, wiederum in Düsseldorf. Aber als er von einem Projekt hörte, die antike Tragödie im Theater von Ephesus wieder zu beleben, reiste er in die Türkei. Offenbar hatte er lebenslang den Mut und das Glück, das zu tun, was ihn existentiell anging. Wer diesem Drang folgt, verzichtet aufs Bodenständige am begrenzten Ort zugunsten der Luftwurzeln eines Hier und Da und wieder Woanders. Klingt spannend, bedeutet aber auch Risiko und fragile Lebensumstände. Reichtümer kann man damit nicht erwerben, im Gegenteil: das Haus, das er einst in Frankreich besaß, verkaufte er, um sich im preiswerteren Marrakesch niederzulassen und ›Horcynus Orca‹ zu übersetzen. Lauter Sprünge in ziemlich kalte Wasser, aber ihr Resultat ist ein sehr aufrechter Gang.
Dann sprechen wir über das Buch. Seit 35 Jahren begleitet es ihn, zwei Jahre brauchte er allein für die Lektüre, Zweifel an seinem Platz in der Weltliteratur hat er nie gehabt. Als ich sage, dass es Geduld erfordere, wird sein Blick durchdringend. Aber natürlich! Warum auch nicht? Ich zitiere ein bisschen Thomas Mann (»dass nur das Gründliche wahrhaft unterhaltend sei«), er aber verweist lieber auf Hans Henny Jahnn; wie Stefano D’Arrigo Autor eines Riesenwerks (›Fluss ohne Ufer‹) und immer noch nicht genügend geschätzt für seine eigenwillige, überbordende Sprache. Ich gestehe, dass ich gerade erst mit dem jungen Protagonisten ‘Ndrja und der geheimnisvollen Ciccina Circé ins Boot gestiegen bin, um von Skylla (Kalabrien) nach Charyibdis (Sizilien) überzusetzen. Eines der Themen der vorangehenden 300 Seiten war Sex, allerdings nur als Figurenrede – wo bleibt der erlebte? Kommt, kommt, erwidert Kahn und schaut noch ein bisschen durchdringender, aber die Liebe ähnelt da einem Kampf, das wird Ihnen vielleicht nicht gefallen.
Ich denke, dass es mir gut gefallen wird, denn D’Arrigos Kunst, Sex in Worte zu fassen, ist groß. Drastisch, unbefangen und poetisch zugleich wird erzählt, ohne Überhöhung oder Gedruckse. Mein Problem ist eher die Ausführlichkeit der Episoden, auch das Immer-noch-einmal der Wiederholungen. Man glaubt zu spüren, wann eine Szene zu Ende geht und wartet auf die nächste, aber das sei natürlich die falsche Haltung, erklärt Kahn, denn das Bleiben und Verharren und ganz, ganz langsame Aufhören sei viel schöner, es gleiche der Kompositionstechnik einer Mahler-Symphonie, dort würden die Motive auch immer noch einmal zurückgeholt, obwohl man sich schon von ihnen verabschiedet hat. Das werden Sie noch lernen, fügt er hinzu und hält die großen Augen auf mich gerichtet.
Ja, ernst ist es ihm mit diesem Lebenszeitverschlinger, aber der Ernst ist nicht bitter und nur milde diktatorisch. Er will einfach, dass D’Arrigos Werk der Rang zugebilligt wird, der ihm seiner Ansicht nach zwischen den Gipfelwerken des 20. Jahrhunderts gebührt. Vierzig Jahre sind seit dem Erscheinen der italienischen Originalausgabe von ›Horcynus Orca‹ vergangen. Seitdem hat sich die Welt gedreht und die Erwartungen an Literatur sind andere geworden. Ist das ein Einwand? Aber nein. Die heutige, gehetzte Trash-Kultur ist doch kein Fortschritt. Umso wichtiger, ein fast versunkenes Epos wieder ins Licht zu stellen, indem man ihm Satz für Satz die eigene, konzentrierte Kreativität schenkt.
Nach unserem Gespräch absolviert er ein Shooting im Studio des Fotografen Dieter Eikelpoth, der an einer Serie von Autorenportraits arbeitet, nicht für Verlage, sondern als eigenes, eigenwilliges Projekt. Der Selbständige will ja erkannt werden, sagt Moshe Kahn. Er sagt es nüchtern, im Bewusstsein seiner Leistung, ohne Auftrumpfen oder unangebrachte Bescheidenheit. Und zieht das Resümee, dass man Zweierlei brauche für Unternehmungen wie ›Horcynus Orca‹: Überzeugung und Wahnsinn.
Gisela Trahms
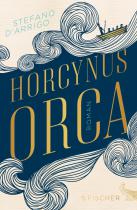
Die Landschaften um die Straße von Messina bilden die Brücke zwischen den Mythen der Antike und der Gegenwart. Hier, zwischen Skylla und Charybdis, hörte Odysseus den Gesang der Sirenen. An genau diesen Ort, sein Zuhause, strebt der Held von Stefano D'Arrigos Meisterwerk ›Horcynus Orca‹, dem letzten großen unentdeckten Roman der Moderne, der nur mit Joyce, Kafka, Musil, Proust zu vergleichen ist. D'Arrigo bannt diese ganze Welt in nur vier Tage: Ein 1943 nach dem Zusammenbruch der Marine heimkehrender Matrose erfährt, was der Krieg aus seinen Menschen gemacht hat. Eine geheimnisvolle Frau hilft dem Fischer ohne Boot über die Meerenge, aber er muss erfahren, dass jede Heimkehr vergeblich ist, wenn der Tod das Ruder führt.
Vierzig Jahre nach dem Erscheinen ist es Moshe Kahn gelungen, den lange als unübersetzbar geltenden Roman zum ersten Mal in eine andere Sprache zu übertragen. Er hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, für das sizilianische Italienisch mit seinen bildstarken und metaphernreichen Dialekten und erdigen Phonemen eine deutsche Entsprechung zu finden, die den großen Wurf des Romans, seine sprachliche Finesse und seine weiten Anspielungsräume lebendig werden lässt. Eine Glanztat.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /