1 In den Siebzigerjahren habe ich im College einen Prosa-Schreibkurs unterrichtet, und der lief nicht gut.
Die Studenten waren klug, wussten sich auszudrücken und bekamen ein, zwei schöne Seiten hin, nur auf Seite drei ging den meisten die Luft aus, gewann Stil gegen Stoff, endete die Erzählung in einem zaghaften »Fortsetzung folgt« oder fiel schlicht über die Klippe. Soll heißen, diese jungen Leute wussten nicht, worüber sie schreiben sollten.
Was tun ...
Die alte Devise »Schreib über das, was du kennst« kann verhängnisvoll sein, wenn die Autoren noch nicht mal wahlberechtigt sind oder alt genug, um Alkohol zu kaufen; da werden Wörter exerziert, und kreative Schreibübungen lesen sich wie kreative Schreibübungen.
Dennoch: Indem ich mich darauf besann, was mich in jungen Jahren angetrieben hatte, Geschichten zu schreiben, die auch veröffentlicht wurden, forderte ich die Studenten auf, sich Schnappschüsse von Familienmitgliedern aus der Zeit vor ihrer Geburt vorzunehmen und aus Geschichten zu schöpfen, die sie als Heranwachsende gehört hatten, etwas über die Menschen auf den Fotos zu erzählen. Die Familiengeschichten, die man mir als Kind verabreicht hatte, bestanden grundsätzlich aus zwei verstörenden Teilen – erster Akt: der Frevel; zweiter Akt: die Rache, und wenn die fehlschlug: berühmte letzte Trotzworte.
Zum Beispiel wie mein sechzehnjähriger Großvater im Jahre 1917 als einziger Jude an Bord eines Handelsschiffes von seinen Schiffskameraden in einer nordafrikanischen Stadt mit Alkohol zugeschüttet wurde und am nächsten Morgen in seiner Koje mit einem tätowierten Kruzifix auf dem Arm aufwachte. Wie er in die Stadt zurückhastete, den Künstler ausfindig machte und sich das Bild in einen Anker umstechen ließ, obwohl Tätowierung auf Tätowierung das Risiko einer Blutvergiftung barg – denn: »Lieber kehre ich tot zu meiner Mutter heim als mit einem Kreuz auf dem Arm.«
Oder wie sich derselbe Großvater fünfzehn Jahre später seine sechsjährige Tochter von einem Spielplatz in der Bronx schnappte, wo sie mit ihrem kahlgeschorenen Schädel (Ringelflechte) von den anderen Kindern gemieden wurde, mit ihr in einen Spielzeugladen eilte, zwei Wochen Lohn (35 Dollar) auf die Theke haute, auf die teuerste Puppe im Laden zeigte und sagte: »Diese anderen Kinder hast du gar nicht nötig.«
2 Oder wie meine Großmutter, eins fünfzig groß und krankhaft fettleibig, im Bus einen bulligen Fahrgast traktierte, ihn erst hochhob und dann zu Boden warf – sein Vergehen: besagtes leidgeprüftes, kahlgeschorenes Kind in seiner ruppigen Eile beim Einsteigen umgerannt zu haben.
Oder wie mein gutmütiger Vater – nach einem antisemitischen Scherz zu viel – zwei GIs in Panik aus der Feldküche rennen sah, nachdem er sich vor ihnen aufgebaut und sie aufgefordert hatte, den Mund zu halten; der Gute war bestürzt von seiner Fähigkeit, so wirksam zu drohen, bis er an sich hinunterblickte und das Kartoffelschälmesser in seiner zitternden Faust sah.
Oder wie meine Mutter einmal ... Wie meine Tante, mein Cousin ...
Wahr, halbwahr, neunzig Prozent passierfähig, diese bescheidenen mündlichen Erbstücke und etliche mehr bildeten das Rüstzeug meiner gut dreißig Jahre professionellen Schreibens. Also, geht nach Hause, ihr Lieben, und sucht euch einen Schnappschuss ...
In der darauffolgenden Woche waren keine Wunder zu bestaunen, doch einige der neuen Geschichten waren deutlich dichter, längst nicht mehr so gehemmt und lasen sich endlich nicht mehr nur wie Hausaufgaben.
Kurz nach Semesterende wurde mir schmerzlich bewusst, dass ich inzwischen das entgegengesetzte Problem hatte: einmal zu oft in die Familienschatzkiste gegriffen zu haben. Wollte ich als Romanautor weitermachen, musste ich mir Leben ausdenken, die nichts mit meinem zu tun hatten.
Und wenn es hart auf hart kommt, schreiben die Harten Drehbücher.
Erst zehn Jahre später kehrte ich sowohl zu den alten Geschichten als auch zum Roman zurück, diesmal allerdings unabhängig voneinander.
Als Vater von zwei kleinen Kindern stellte ich Ende der Achtziger sehr bald fest, dass keine Sprache in der Lage war, die Gefühle auszudrücken, die ständig hoch und tief über mich hinwegbrandeten; nichts von wegen dreihundert Wörter für Schnee. Und wenn ich sprachlos vor ihnen stand, packte ich oft instinktiv die alten Familienanekdoten aus, fügte eigene Schmalspurabenteuer hinzu und legte los.
Im Gegensatz zu den älteren Geschichten bewegten sich meine weniger im Frevel-Rache-Genre, sie umkreisten eher zuverlässig Dad als aufstrebenden Armleuchter: meinen ersten Anmachspruch in der zweiten Klasse, »Schwitzt du auch manchmal im Winter?« (wahr); wie ich beim Stickball einen Quarter in die Kehle kriegte und sofort ins Krankenhaus musste, um ihn mir wieder rausfischen zu lassen (wahr); wie ich in der sechsten Klasse nachsitzen musste, weil ich statt um den Maibaum zu hüpfen drumherum galoppiert war (halbwahr); wie ich in der Junior Highschool zwei Jahre lang Waldhorn light spielte, indem ich mich über das Mundstück beugte und wie ein drittklassiger Bauchredner die Noten mit der Stimme nachahmte (halbwahr); und wie mir ein dreizehnjähriger Little Stevie Wonder von der Bühne aus einen Krawattenhalter ins Auge feuerte, weil er falsch eingeschätzt hatte, wo im Publikum sich die Traube kreischender Mädchen befand (eher weniger).
3 Alle wissen, wie köstlich es ist, abgelegte Erzählklamotten zu erben. Doch als ich die aufmerksamen Mienen meiner Töchter sah, ihr knappes, entrücktes Nicken, ihre leicht geöffneten Lippen, die Bereitschaft ihrer Lachmuskeln um Mund und Augen, all die Signale, wie meine Geschichten aufgesogen wurden, war der Kick des Erzählers unaussprechlich klar. »Ich liebe euch« ist bloß eine Phrase, das Schnattern einer Ente, Tausender Enten; hier, dieser kleine Lebenssplitter von mir, der gehört jetzt auch euch. Und es gibt jede Menge Nachschub.
Was soll’s also, wenn die Geschichten, die ich ihnen erzählt habe, wie die Geschichten, die mir erzählt wurden, jetzt etwas lustiger klingen, als sie eigentlich waren, etwas dramatischer oder formschöner oder mit einer nachträglichen Pointe verziert? Der Wert, die Würde dieser Geschichten, bemisst sich an der Motivation, sie zu erzählen: Das bin ich, ich will euch etwas von mir geben. Und wenn die Ausschmückungen jedes Mal ziemlich konstant, die Schnörkel sehnlicher Verfeinerung über die Jahre einigermaßen stabil bleiben, ist das dann nicht auch ein Teil von mir?
Bedenkt man, wie der Tenor der Familiensaga innerhalb einer Generation von bewegtem Drama zu bescheidener Komödie wechselte, frage ich mich doch, welchen Ton meine Kinder anschlagen werden, wenn sie einmal als Geschichtenerzählerinnen zurückblicken.
»Mit meinen Freundinnen?«, sagte meine Tochter Annie. »Das hat wahrscheinlich viel mit 9/11 zu tun, aber die meisten Geschichten, die wir uns erzählen, handeln irgendwie von knappen Sachen, also, typischen New Yorker Querschlägern: wie man gerade mal diesem oder jenem entkommen oder irgendeiner Strafe entgangen ist. Es geht immer um Timing – wie wir irgendwo ungeschoren rauskommen, und wenn wir zwei Minuten länger geblieben wären, wenn wir dieses Flugzeug genommen hätten, in den Subwaywaggon gestiegen wären, eine Sekunde später vom Kantstein getreten ...«
»Verstehe«, sagte ich, »aber meine Frage ist, wenn ihr älter werdet und so weit seid, dass ihr euren Kindern eure eigenen Geschichten erzählt, was meint ihr ...«
»Wie schon gesagt«, antwortete sie. »Heutzutage in New York: die knappen Sachen.«
»Ja, schon«, sagte ich, »aber was ist mit dem Tattoo eures Urgroßvaters? Oder damals, als Little Stevie Wonder mich attackiert hat?«
»Ja doch, klar«, sagte sie sanft, »die sind auch schön.«
Aus dem Amerikanischen von Miriam Mandelkow
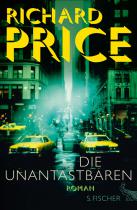
Nachtschicht in Manhattan: Billy Graves ist ein ruheloser Cop. Energy-Drinks und Zigaretten halten ihn wach, während er in den frühen Morgenstunden die Blocks in New York City abfährt. Billy und vier seiner Freund bilden den harten Kern der Wildgänse - einer Gruppe vom Leben gezeichneter Cops und Ex-Cops in Manhattan, New York. Vergangene Untaten schweißen sie zusammen. Billy fristet, seit er bei einem Schusswechsel einen zwölfjährigen Jungen getötet hat, seine Zeit als Detective in der Nachtschicht. Wie seine vier Kollegen hat auch er einen Unantastbaren, einen skrupellosen Mörder, den er nie dingfest machen konnte. Als er einen der Unantastbaren in einer gigantischen Blutspur entlang einer Subway-Station findet, gerät die ungesühnte Vergangenheit wieder an die Oberfläche, und Billy beginnt, gegen seine engsten Vertrauten zu ermitteln. Ein fesselnder New York-Roman, knallhart, fesselnd und gnadenlos gut.
Gewinner des deutschen Krimi Preises 2016






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /