Nun, an seinem achtzigsten Geburtstag, hat er demnach bereits mehr als die Hälfte seines Lebens in der anderen Stadt am Rhein verbracht, mit der ihn ebenso wie mit Düsseldorf eine sehr intensive, keineswegs nur äußerliche Beziehung verbindet. Düsseldorf und Basel sind für Dieter Forte vielmehr auch kulturelle Signaturen, verdichtete Orte einer europäischen Geschichtslandschaft, deren bewegende Kräfte der Blick des Schriftstellers weit zurückverfolgt, bis in die frühe Neuzeit. Zuletzt legte sein Buch ›Das Labyrinth der Welt‹ (2013) von der ernsthaften Wahlverwandtschaft mit Basel beredtes Zeugnis ab, indem es sich an die topographischen Spuren des oberrheinischen Humanismus heftete.
Basel und Düsseldorf werden, so fest ihre Straßen sich dem Schreiben des Autors auch eingeprägt haben, unter dem erinnerungsvollen Blick Dieter Fortes zu transitorischen Orten, zu Schauplätzen der Unruhe und der Wanderschaft. Die großen Tendenzen des europäischen Wirtschaftslebens, des Kunst- und Geisteslebens, aber auch der Geschichte von Krieg und Gewalt sind für Dieter Forte an diesen beiden Brennpunkten konkret fasslich geworden. Fünfundvierzig Jahre nach seinem dramatischen Basler Debüt von 1970 wird im Blick auf das Œuvre dieses Autors erkennbar, dass schon der Auftakt mit den Figuren Martin Luthers und Thomas Münzers ein für das folgende Werk sehr aussagekräftiger, geradezu programmatischer war. Die Geschichtslandschaft eines zersplitterten, in rivalisierende Fürstentümer und Einflussregionen zerfallenden Reiches prägt die Konstellation von Luther und Münzer ebenso wie das unheilige Zusammenspiel zwischen machiavellistischer Politik und geistlich verbrämter Korruptionswirtschaft. Ganz egal, ob nun gerade Albrecht von Brandenburg, Friedrich von Sachsen, Karl V. oder der Papst auftreten – sie alle tanzen nach der Pfeife des finanzmächtigen Augsburger Großkaufmannes Jakob Fugger, dem in den ersten Jahrzehnten nach 1500 mächtigsten Bankier Europas. Mit seinen Krediten lenkt und erkauft der Finanzier nicht nur die Kaiserwahl des Habsburgers Karl, er behält auch die Oberhand über den katholischen Ablasshandel und den aus ihm entspringenden Religionsstreit.
Sollte man die gesamte Reformationsgeschichte von Grund auf umschreiben müssen, wie Forte dies mit seinen bis zur Karikatur als abhängig gezeichneten Figuren von Denkern und Machthabern nun nahelegte? War die geistige Erneuerung des Humanismus und der Reformation nichts anderes als ein Ergebnis der doppelten Buchführung, durch die in das europäische Denken und Handeln der Neuzeit eine primär ökonomisch ausgerichtete Rationalität eingezogen war? Ein historisches Stück kann Fortes Großdrama um Luther & Münzer trotz seiner sorgfältigen Verarbeitung geschichtlicher Quellen nur zum Teil genannt werden; es ist in seinen Einsichten von der Macht des Finanzkapitals von einer geradezu bestürzenden Aktualität.
Zweifellos ist das literarische Werk Dieter Fortes von diesem fulminanten Beginn her den Impulsen eines engagierten, gesellschaftskritischen Denkens verpflichtet. Sowohl von den Salonmarxisten wie von der Straßenagitation der Post-68er-Phase aber unterscheidet sich Forte durch seine differenzierte Genauigkeit, die gegenüber allen eingängigen Phrasen das Seziermesser eines höchst skeptischen Sprachkritikers und die Richtschnur eines empfindlichen Stilisten anlegt. Außerdem war und ist Forte ein dialektisch geschulter Kopf, der in den widerstreitenden Positionen die ihnen gemeinsame Logik des Austrags gesellschaftlicher Spannungen und Konflikte erkennt.
In diesem Sinne ist Dieter Fortes darstellerisches Verfahren grundsätzlich eines der doppelten Buchführung, das konträre Positionen oder gegenstrebige Linien in großer Verklammerungsgeste nebeneinander setzt bzw. ineinander verschränkt. So hatte der Dramatiker beispielsweise dem taktischen Lavieren seiner Luther-Figur in Thomas Münzer, dem politischen Agitator und Rebell, ein militantes Gegenprinzip zur Seite gestellt, welches das gesamte Drama mit kontrapunktischer Spannung vorantreibt. Auch in der Doppelung von Figurenkonstellation einerseits und geschichtsdeutender Abstraktion andererseits kann man ein solches Verfahren dialektischer Buchführung erkennen.
Forte wiederholte dies später in weiteren geschichtlichen Theaterstücken, darunter ›Jean Henry Dunant oder Die Einführung der Zivilisation‹von 1978. Der ›Henry Dunant‹ ist ein Stück, welches sich den sozialen Fliehkräften und Klassenkämpfen des 19. Jahrhunderts widmet, anhand der bekannten Gestalt jenes Genfer Geschäftsmannes, dessen aus philanthropischen Motiven erfolgte Gründung des Internationalen Roten Kreuzes als ein Beitrag zur gesellschaftlichen Humanisierung gedacht war, die paradoxerweise aber das Gegenteil ihres Zweckes bewirkte, nämlich die arbeitsteilige Perfektionierung der modernen Kriegsführung.
An die Grenzen des Humanen und des zivilisatorischen Selbstverständnisses führte erst recht das dritte große Theaterstück, mit dem Forte seine kritische Archäologie der Neuzeit zu einer Trilogie erweiterte. ›Das Labyrinth der Träume oder Wie man den Kopf vom Körper trennt‹ (1983) stellt, wiederum mit einem der für Fortes Dramatik so charakteristischen Doppeltitel, das Schicksal zweier Massenmörder einander gegenüber, dasjenige des von seinen Zeitgenossen umjubelten Diktators Adolf Hitler und dasjenige des Düsseldorfer Triebtäters und Serienmörders Peter Kürten. Die entfesselten Kräfte des Massenwahns und die paranoid aufgeblähte Schreckensgestalt des Vampirs von Düsseldorf – sie bilden ein kommunizierendes System, in dem das kollektive Unbewusste sich austoben konnte. In diesen riskanten Engführungen wurde Fortes zwar thesenhaft angelegtes, aber stets auf Spielbarkeit und Sinnlichkeit ausgerichtetes Theater von einem sich wandelnden Zeitgeist, der seit Mitte der achtziger Jahre dann zaghaftere und subjektivere Formen bevorzugte, nicht mehr goutiert wie ehedem, vielleicht auch gar nicht wirklich verstanden.
Einen nochmals ganz neuen, wiederum fulminant eröffneten Weg beschritt Dieter Forte mit seinem ersten Roman ›Das Muster‹ von 1992. Die Konstruktion umgreift auch hier ein dialektisches Thema, nämlich die Parallelführung zweier Familiengeschichten, wiederum beginnend in den Anfangsgründen der europäischen Neuzeit. Mit seinem Titel ›Das Muster‹ bezieht sich Fortes Roman zunächst auf das Musterbuch einer oberitalienischen Dynastie von Seidenwebern, den Fontanas, die im 14. und 15. Jahrhundert erst in Lucca, sodann in Florenz ihr Handwerk entfalten und eine prosperierende Firma unterhalten. Im besagten Musterbuch, das jeweils der Familienpatron an den Erben und Nachfolger übergibt, sind all die Zeichnungen, Formen und Techniken festgehalten, mit welchen die kunstvolle Gestaltung der Seidentücher und Stoffe erfolgte. Dieses Musterbuch der Fontana ist das Zentrum des Geschäftserfolges und der Familiengeschichte überhaupt.
Immer wieder aber wird die Wirtschaftsausübung dieses feinen Metiers durch politische Intrigen und Turbulenzen gefährdet; der Vertreibung aus Lucca folgt die Neuansiedlung in Florenz, und als auch dort die Arbeit des Unternehmens bedroht erscheint, fliehen die Fontanas schließlich nach Lyon weiter, den großen Handelswegen im südwestlichen Mitteleuropa folgend. Lyon, am Zusammenfluss von Saône und Rhone zur einflussreichen Bank- und Wirtschaftsmetropole heranwachsend, versprach sich von der Ansiedlung der Seidenwebereien zu Recht einen weiteren Aufschwung seiner ertragreichen Gewerbe. In Lyon etabliert sich die aus Italien übersiedelte Familie Fontana rasch und erfolgreich. Einer aus der Folge der Familien-Patriarchen der Fontanas, ein nachdenklicher älterer Herr mit den französischen Vornamen Jean Paul, beschließt, sich »aus Vernunft und […] Überzeugung in die reformierte Gemeinde Lyons aufnehmen« zu lassen. Damit wird der weitere Weg dieser Familie Fontana durch die geschichtlichen Fährnisse der Religionskriege schon vorgezeichnet.
Während der eine Romanstrang von ›Das Muster‹ bis dahin dem Unternehmen und der dynastischen Kette der Fontanas getreulich gefolgt ist, beginnt, zeitlich leicht nach hinten versetzt, ein zweiter Erzählstrang sich einzuschalten, der an weit entfernter Stelle neu einsetzt und auf die Geschichte der polnischen Familie Lukacz gerichtet ist. Die Lukacz sind eigentlich in allem das schiere Gegenteil der Fontanas; es sind einfache Leute aus dem bäuerlichen Milieu, bettelarm, sehr fromm und ohne größere Kontakte über ihren unmittelbaren Lebenskreis hinaus. Eine Wallfahrt zur heiligen Muttergottes von Tschenstochau wird in der Familiengeschichte für Generationen den eindrücklichsten, mündlich weitergegebenen Erfahrungsschatz bilden. Während das Leben der Lukacz von den wiederkehrenden Gottesdiensten sowie von skurrilen Hochzeitsfeiern, Taufen und Begräbnissen seinen Rhythmus erhält und im Gleichlauf der Generationen scheinbar nicht vom Fleck kommt, geraten die Geschicke der Fontanas mit ihren feinen Seidenstoffen ganz unfreiwillig immer wieder in das Getriebe der geschichtlichen Umbrüche und Verwerfungen. Auch in Lyon wird die Familie nach einigen Generationen wieder unheimisch, denn die Hugenotten, zu welchen seit der Konversion des Patriarchen Jean Paul das gesamte Geschlecht der Fontanas zählt, dürfen in der Stadt ihren Berufen und Unternehmungen nicht mehr ungehindert nachgehen. Um der endgültigen Vertreibung zuvor zu kommen, beschließt der Familienrat den Auszug und die große Wanderschaft.
Die Familienzweige teilen sich, einer der Trosse auf Wanderschaft reist über die welsche Schweiz zunächst nach Basel, um dann stromabwärts weiterzuziehen und irgendwann im deutschen Rheinland Fuß zu fassen. In Basel lernen die staunenden Seidenweber aus Lyon die ersten automatischen Webstühle kennen, die ihr gesamtes mühevolles und kunstsinniges Handwerk durch die Verrichtungen einer Maschine ersetzen. Das Gewerbe wird durch den drohenden technischen Wandel seine bisherige Grundlage verlieren und muss sich auf irgendeine Weise neu erfinden, etwa in der Anfertigung von Luxuswaren.
Während die Fontana ihren Weg ins Ungewisse durch die Mitte Europas fortsetzen, immer an den großen Wasserwegen und Handelsrouten entlang, die ohnehin die Hauptadern der europäischen Wanderungsbewegungen bilden, kommt auch in den anderen Erzählstrang ungeahnte Bewegung, denn selbst die Lukacz können nicht umhin, ihren Existenzerhalt durch die Bereitschaft zur Auswanderung zu sichern. Da sie nun nicht mehr Bauern, sondern Bergleute geworden sind, verschlägt es sie wie so viele Polen in das westdeutsche Ruhrgebiet, wo um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein industrielles Gründerfieber sondergleichen ausgebrochen war. Mit der Eisenbahn, dem neuen Vehikel der europäischen Menschenströme, treffen die Lukacz in Gelsenkirchen ein. Erst ein, zwei Generationen später wird sodann eine gewisse Maria Lukacs weiter in das großbürgerlich vornehme Düsseldorf gelangen, wo sich inzwischen die jüngsten Generationen der Fontana-Dynastie niedergelassen haben. Bei den Lukacz verschleift sich mit der Zeit das Bäuerliche und das Proletarische, während die Fontanas irgendwann die Seidenweberei und das Textilgewerbe aufgeben müssen; einige von ihnen gehen zur Eisenbahn – übertragen das sich hin und her bewegende Weberschiffchen ins große Muster der Landschaft – oder hegen eine Vorliebe für die Kunst und das Theater.
Mit den Parallelbiographien zweier Familien über viele Jahrhunderte hin hat Dieter Forte in seinem ersten Roman ein Erzählprogramm von immenser Spannweite und Materialfülle eröffnet, das von Beginn an über die Grenzen eines Einzelwerks weit hinausgreift. Eine doppelte Buchführung zielt auch hier darauf, die Umbruchzeiten und Kontakträume der neuzeitlichen mitteleuropäischen Geschichte aus solchen exemplarischen Familien-Lebensläufen heraus zu rekonstruieren. Als sich in Düsseldorf schließlich die Wege der Fontanas und der Lukacz kreuzen und zu einer Paarbildung miteinander verschränken, sind damit die Erfahrungsschätze des mediterran-lateinischen wie des östlich-slawischen kulturellen Raumes in Beziehung gesetzt. Wenn in Düsseldorf Friedrich Fontana und Maria Lukacs als Liebespaar zusammenfinden – ausgerechnet im schlimmen deutschen Schicksalsjahr 1933 –, dann zeigt sich an dieser Verbindung, wie sehr jede einzelne Familiengeschichte verwoben ist mit den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und konfessionellen Weichenstellungen der europäischen Geschichte. Zu sagen, hier seien zwei Menschen mit Migrationshintergrund zu einem Hochzeitspaar zusammengekommen, wäre heftig untertrieben.
Dass aus dieser Paarbildung Kinder hervorgehen, von denen nicht alle die nächsten, schwierigen Jahre überleben, rückt die doppelt geführten Fäden dieses Familienromans dann vollends in die Kernzone des schwierigsten und kritischsten Teils der deutschen Geschichte. Mit dem zweiten und dritten Band dieses Erzählwerks erreichte Forte in den neunziger Jahren endlich die Zeitgenossenschaft seiner Generation, und das heißt: die Lebenslast eines biographischen Weges, an dessen Ausgangspunkt denkbar unheilvolle Konstellationen standen. Der erste Band endete geradezu prophetisch mit der Nachricht vom Selbstmord eines jüdischen Freundes und Bekannten, die mitten hinein in die Hochzeitsfeier des jungen Paares platzt. Pünktlich mit dem Potsdamer Handschlag zwischen Hitler und Hindenburg an 21. März 1933, der das Bündnis zwischen den Nazis und den alten Eliten des Reiches besiegelt, entbindet Maria Fontana geborene Lukacz ihren ersten Sohn. Es ist dies zugleich das astronomische Datum der Tagundnachtgleiche, mit deren Zeitschwelle der zweite Romanband eröffnet, dem nun ein viel engeres und dichteres erzählerisches Zeitmaß eignet. ›Tagundnachtgleiche‹ ist dieser Werkteil innerhalb der Trilogie überschrieben; als vorhergegangene Einzelveröffentlichung hatte der Band den Titel ›Der Junge mit den blutigen Schuhen‹ (1995) getragen.
Wiederum ist dieses Erzählgefüge ein Musterstück durchkomponierter Gleichzeitigkeit, ineinander verwoben sind Gang der Geschichte und Familienleben wie im Seidengewebe die Kett- und die Schussfäden. Zu den neuen Nazi-Machthabern in Berlin hält die rheinische Metropole Düsseldorf, ein Inbegriff gelebter Toleranz und Großzügigkeit, schroffe Distanz, so lange es geht. In der Ära zwischen den Kriegen war die zeitweilig von den Engländern besetzte Stadt, so stellt der Erzähler mit gewisser Genugtuung fest, »wohl die internationalste Stadt Europas«. Doch auch hier sind die Kräfte der Gewalt nicht aufzuhalten. Der Terror des teils verordneten, teils polizeilich geduldeten Pogroms vom November 1938, der sogenannten »Reichskristallnacht«, durchbebt die Kindheitswelt des kleinen Jungen, auf den sich nun die Erzählperspektive mehr und mehr verengt. Auf einem Laternenumzug zum Sankt Martinstag, wie er für die Kinder nach alter Tradition ausgerichtet wird, führt der Weg von Maria und ihrem Jungen durch scherbenübersäte Straßen, vorbei an den Brandruinen der vom Mob zerstörten jüdischen Geschäfte.
Die Kindheitswelt dieses Jungen verwandelt sich, trotz der Liebe, die ihm seine Familie entgegenbringt, in ein einziges Inferno. Es kommt der Krieg, der die Männer entführt und sie viel später erst, wenn überhaupt, verstört oder verstümmelt zurückbringt. Es kommen die Sirenen des Fliegeralarms, die schlaflosen Nächte im Schutzbunker, die Bombenangriffe und deren Folgen. Im Feuersturm sinkt das mehrstöckige Haus, in dem die Fontanas Schutz gefunden haben, schwer getroffen über dem kleinen Jungen zusammen. Die vertraute Stadtumgebung verwandelt sich mehr und mehr in eine Trümmerlandschaft. Es sind solche Zeitumstände, die den Jungen an Leib und Seele krank machen, so dass er über lange Phasen kaum noch das Bett verlassen kann.
›In der Erinnerung‹, so der dritte Roman dieser Werkreihe, schildert den Übergang von den desaströsen Jahren des Niedergangs bis hinein in die Nachkriegswelt, er verengt sich dabei zuweilen auf die kleinstmögliche Sichtscharte eines Mauerlochs in einer Ruine, von der aus der Junge den verzweifelten Überlebenskampf der Menschen um ihn herum registriert, in dem die Stimmen der Lebenden gegen jene der Toten kaum ankommen.
Und abermals hat sich das Zeitmaß des Erzählganges in dieser erstarrten Nachkriegswelt spürbar verlangsamt, bis hin zu einem Gefühl völligen, ausweglosen Stillstandes. Eine Stunde Null gibt es nicht, ebensowenig die Emphase des Neuanfangs; und doch keimt im Zusammenleben mit den einquartierten englischen Besatzern wieder so etwas wie neue Lebensenergie auf. Gustav, der Großvater des Jungen, vertritt die Auffassung, »die Erschaffung der Welt sei bitte schön nichts gegen ihre ständige Restaurierung.«
Doch für den jungen Mann scheint die Bürde riesig, die ihm da aus den zwölf Jahren der Unzeit auferlegt wurde und noch lange danach erhalten bleibt. Um seine schwere chronische Erkrankung auszukurieren, wird er zu einem langen Heilaufenthalt auf eine Nordsee-Insel geschickt. Davon erzählt schließlich jener Band, den Forte seiner imponierenden Romantrilogie folgen ließ und der den Titel trägt ›Auf der anderen Seite der Welt‹ (2004). Es ist für den Protagonisten ein Gang in das Fegefeuer, mitten hinein in eine groteske Welt der Verfallenen und Moribunden, aus der eigentlich kein Weg mehr hinausführt. Und doch macht sich der Autor auch bei diesen bedrückenden Aufzeichnungen von einer hartnäckigen, fast lebenslangen Leidensphase das bewährte Prinzip einer doppelten Buchführung zu eigen. Denn neben den dunklen Kapiteln von der mit eiserner Hand geführten Bettenstation am Rande des Meeres stehen in diesem Roman hinreißend elegante, leichtfüßige Passagen über die brodelnde, swingende Künstlerwelt im Düsseldorf der fünfziger Jahre, in der ein Joseph Beuys anfängt, von sich Reden zu machen, in der sich glanzvolle US-amerikanische Jazzgrößen in den Kellerkneipen der Altstadt tummeln und in der auch ein unbekannter Bildhauerei-Student mit seinen Auftritten als Hobbyjazzer ein kärgliches Auskommen findet, den die Szene nur den »Waschbrett-Günter« nennt, solange er noch nicht als Autor der ›Blechtrommel‹ hervorgetreten ist.
Jenes vor Experimentierlust und Sinnlichkeit nur so vibrierende Düsseldorf der fünfziger und sechziger Jahre war ein Möglichkeitsraum, Inkubationsort einer Zukunft, die dann freilich längst nicht alle dieser Versprechungen wahr zu machen wusste. Dieter Forte hat sich diesen Möglichkeitsraum von Basel aus neu erschaffen und mit ihm der Erinnerungslast seiner Trilogie ›Das Haus auf meinen Schultern‹ in ihrer Coda ein aufbrechendes, offenes Ende verliehen. Bei diesem Dialektiker der doppelten Buchführung sind sowohl die Dramen wie die Romane – und nicht zu vergessen auch seine Fernsehspiele und Hörfunkarbeiten – in gewisser Weise immer von der anderen Seite her geschrieben. Sein Schreibort Basel ist für Forte über die Jahrzehnte zu einem klandestinen Refugium geworden, von dem aus er in so viele Richtungen der europäischen Geschichtslandschaft gleichzeitig zu blicken vermag – Werkstatt, zuletzt nun auch Schauplatz eines Œuvres von imponierender, streng komponierter Vielstimmigkeit.
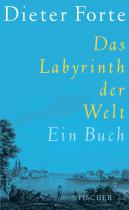
Dieter Fortes grandioses Buch ist kein Roman, kein Sachbuch und kein Essay, aber vielleicht alles zusammen: Eine poetische Geschichte der Bilder und Bücher, des Lesens und Schreibens, des menschlichen Miteinanders im Lauf der Jahrhunderte. Das alles vor dem Hintergrund der alten europäischen Kulturstadt Basel, in der Dieter Forte seit vier Jahrzehnten lebt – eine Stadt der Künstler und Denker, der Drucker, Kupferstecher und Alchimisten, der Kaufleute und Bankiers, der Wissenschaftler und Narren. Sie kommen aus der Tiefe der Vergangenheit, verweilen vor dem Auge des Lesers, verwickeln ihn in ein Gespräch der großen Fragen und Antworten: Was ist der Mensch? Was macht er mit seiner Zeit – und was die Zeit mit ihm?






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /