Zu Fuß kann man etwas erfahren über die Ordnung der Welt, die immer besonderen Regeln des städtischen Raums, des öffentlichen und des privaten, über Übergänge. Es sind schließlich Schritte, die zur Palette führen, jenem ersten Undergroundlokal Hamburgs, wie man damals noch nicht einmal gesagt hätte, jenem Ort für alle schrägen Vögel:
»Die Palette ist neunundachtzig bis hundert Schritte vom Gänsemarkt entfernt…
Jäckis erster Besuch in der Palette: Jäcki geht über den Gänsemarkt. Jäcki geht vier Stufen hinunter. Jäcki macht die Tür wieder zu.
Der erste Besuch dauert fünf Minuten.
Das ist für die Palette nicht wichtig. Die fünf Minuten könnten neunundzwanzig Besuche sein oder neunhundert Besuche, von denen jeder zwölf Stunden dauert oder eine Sekunde – zwischen Entstehen und Schließung der Palette. In der Palette ist immer alles da.
Nur für die Beschreibung ist es wichtig, dass es die ersten fünf Minuten von so und so viel geschilderten Besuchen Jäckis sind und für Jäcki ist es wichtig, der erst in der Mitte seiner Besuche wissen wird, woran er ist…« (Palette, S. 9/14).
Ähnlich ging es mir mit der Lektüre Fichtes, die mich erst einmal gefangen nahm und die sich mir erst nach und nach erschloss. Ein Schreiben, das nicht ohne Grund die hermetischen Traditionen aufnimmt, allerdings durch sie sozusagen hindurchschreitet.
Diesen Ort, die Palette, angemessen zu beschreiben, war der Ausgangspunkt für seinen gleichnamigen Roman, den Erfolgsroman, seinen Bestseller, der nur drei Jahre nach dem Erstling ›Das Waisenhaus‹ 1968 erschien. Es war ihm wichtig, es richtig zu machen, nicht voller Klischees und Halbwahrheiten, Gerüchten, sondern realistisch – was in diesem Fall die kritische Selbstbefragung mit einschloss, dem Sinnlich-Konkreten und Historischen zugleich gerecht zu werden, beiden, dem Fensterputzerkarl und der Blume zu Saaron gleichermaßen Raum zu geben, so wie ein Alphabet der sprachlichen und körperlichen Gesten zu erstellen, Gesten des Abseitigen, der Differenzierung, des Anknüpfens und Imitierens, so dass das alles erstmal vorhanden sein kann, pure Demokratie des Raums, eben nicht ohne Ansehen, aber ohne Beurteilung von Ansehen und Herkunft.
Hubert Fichte selbst ist jemand, der schon in jungen Jahren krasse Verwandlungen durchgemacht hat. Vom versteckten protestantischen Halbwaisen und Halbjuden in einem katholischen Waisenhaus im Nationalsozialismus zum Kinderdarsteller im Hamburger Thalia-Theater der Nachkriegszeit, zum Ziehsohn von Hanns Henny Jahnn und zum französischen und schwedischen Jungbauern, der die Schule gesteckt hat, vom Schwulen zum Bisexuellen. Man kann wohl sagen, er kannte sich aus mit den Verwandlungen, er wusste sich in den unterschiedlichsten Milieus zu bewegen, und er wusste, wie rettend kleine Zeichen sein können. Er glaubte nicht an Essenz, sondern an Gesten, Bilder, Wörter.
Es wird insofern nicht verwunderlich sein zu hören, dass Hubert Fichte in über zwanzig Ländern unterwegs war, zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Flugzeug, mit Touropa und ohne, alleine und doch meist in Begleitung seiner Lebensgefährtin, der Fotografin Leonore Mau. Eine literarische Legende, jemand, den man nicht wirklich zu fassen kriegte und der doch enorme Wirkung aufweist. Sein Bestsellerdasein investierte er nach 1968, mit 33, bereits erfolgreich in sein damals abseitig wirkendes Reise- und Rechercheprojekt zum Synkretismus, das später zur ›Geschichte der Empfindlichkeit‹ auswachsen sollte. Er mutierte sozusagen zu einem Vielfüßler.
Heute gibt es ihn in mehrfacher Ausgabe: Als Synkretismus-Fichte, als Paletten-Fichte, als Gesprächsfichte, Palais-d’Amour-Fichte, als Hans-Henny-Jahnn-Fichte, als Daniel-Casper-von-Lohenstein-Fichte, als Reportage-Fichte und später posthum als Thomas-Meinecke- und Klaus-Sander-Fichte, und ich bilde mir ein, den einen oder anderen auch wirklich getroffen zu haben. Mit dem einen oder anderen irgendwann mal ein Gespräch geführt zu haben, das ging so von 1998 bis ungefähr 2006, dann kehrte ein wenig Ruhe ein bei mir, doch diese unterschiedlichen Fichtes korrespondierten einfach in mir weiter, steckten die Köpfe zusammen und wieder auseinander, schüttelten sie über so manche Unsinnigkeit.
Eine Rede über Fichte hier im Literarischen Colloquium kann insofern nur radikal subjektiv, naja, nicht radikal, aber subjektiv sein, schließlich ist hier einer seiner Orte, seiner Schauplätze, zumindest der des Showdowns einer einstigen literarischen Objektivierungsveranstaltung, der Gruppe 47 – der Überprüfung auf den Kanonisierungsgehalt der Texte. Es sind jugendherbergsartige Szenen, die man in der ›Zweiten Schuld‹ nachlesen kann.
Sein Material waren insgesamt Reisen, ob es solche in die eigene Vergangenheit waren, ins Literaturbetriebssystem in der Villa Massimo, in die Kunstszene New Yorks oder zu den synkretistischen Candomblés in Brasilien, zum Platz der Gehenkten in Marokko, es gab immer diesen Vorgang des Beobachtens und Notierens, der Erstwahrnehmung.
»Ein Schleier aus Gischt.
Zehn Meter hoch.
Schien es Jäcki. Die Sonne stieß hindurch.
Die Wolkenkratzer wackelten.
Die Autos hüpften.
Die Welle sank in sich zusammen.
Die nächste spritzte zwischen den Hochhäusern hoch.
Das war Copacabana – eine verstopfte Hauptverkehrsader,
voller Auspuffgase, die nach der heiligen Jungfrau hieß,
nackte nasse Afrikaner, nackte glitzernde Indianer, nackte
überperlte Portugiesen.
Minislips rundgebläht, Surfbretter im blauen, schwarzen Nebel.
Zwischen den Bussen bellt ein Aznavourepigone Chansons von Innigkeit und Urwald
Und am Ende jeder Straßenschlucht die durchleuchteten Sekundentürme aus Gischt.« (Explosion, S. 9).
Extrem sinnlich, konkret, rhythmisch, genial montiert. Und doch: Für Fichte denkt man sich anscheinend immer noch gerne ein Publikum aus, wo es nicht notwendig ist, man denkt an die Ethnologen, die Post-colonial-Menschen, die Gender- und Queerfraktion, damit stehe ich nicht alleine. Ich wurde bei Lesungen sogar schon angesprochen – und: automatisch der Ethnologenfraktion zugeordnet, was auch immer das über mich aussagen mag. (Ich wäre immer lieber einer Freakfraktion zugeordnet worden, die es auch irgendwo geben muss …) Tatsache ist, es stand lange außer Frage, dass man einfach so zu einer Fichte-Lesung kommt, also aus ästhetischen, literaturinteressierten Gründen.
Dabei war es gerade seine Ästhetik, die mich reizte, die er aus dem Barock eines Daniel Casper von Lohenstein und eines Hans Henny Jahnn entwickelte, zwischen den unterschiedlichsten Manierismen hindurch bis an den Rand einer sinnlich glasklaren, analytischen Sprache trieb, ein Aufklärer und ein Realist, der wirklich was vom Realen verstand. Dabei halfen die Selbstaufklärung, die Konkretion der Beschreibung, die egalitäre Behandlung der Bedürfnisse, die Erotik und das klare Bewusstsein über Machthierarchien, Praktiken der Unterwerfung. Die eigene Suche und Neugier, die Lust aufs Reisen, die Frage nach den Riten bildeten die Basisbewegung, auf die alle anderen Bewegungen treffen konnten. Es waren alternative Entwürfe zu dem, was ich jedenfalls schon zu kennen glaubte, und hatte insofern enorm befreiende Wirkung.
»Plötzlich – aber vielleicht vorbereitet durch langsam zur Oberfläche geschwemmtes Material – entdeckte ich, dass alle meine Versuche bisher nur eine Bewegung verrieten: zurückzufinden in frühere Schichten.
Ich beschloss, von nun an die Handlungen einzuteilen in magische und vom Magischen abgelöste.
(Wobei ich den Begriff des Magischen für meinen Gebrauch etwas umwandelte.)
Ich überlegte, ob nicht auch meine Vorstellungen in der Pubertät Ritualisierungen wären, wie die Zeichensprache der Aderflügler, Schwurgifte und wie das Schminken von Novizen.« (Versuch über die Pubertät, S. 9)
Die Einteilung der Welt in magisch und unmagisch war eine Möglichkeit der Ordnung der Verhältnisse. Die Ritualisierung und die Zeichensprache der Priester als Widerstandsgesten und Überlebenskunst in den Favelas zu interpretieren, eine andere. Alltagsinszenierungen von Pubertierenden, Menschen ohne Inszenierungsurlaub in Bezug zu setzen zu sprachmagischen Ordnungen, die dritte. Fichtes »Verwörterung der Welt« hatte mit diesen drei Ordnungen zu tun, aber auch mit der haarscharfen und geduldigen Beobachtungskunst des Ethnologen, der die Selbstbeobachtung als integralen Bestandteil seiner Arbeit versteht.
Immer wieder begegne ich in seinen Texten seiner Art nachzuhaken, stets knapp an der Befragung vorbei, insistierend, weich und doch konsequent. Sein Tonfall bleibt einem im Ohr, schließlich kann man die ›Interviews aus dem Palais d’Amour‹ hören oder die Gespräche mit Lil Picard, im Audioverlag supposé sind sie erschienen. Fichtes Gesprächskunst war es, die den Stil entscheidend beeinflusste. Er war Pop, ohne Zweifel, spielte nicht nur mit allen möglichen medialen und literarischen Formen, vom Hörspiel (Schulfunk!) über die Koransuren, bis hin zum Essay, sondern schrieb auch, soweit mir bekannt ist, zusammen mit Wolli Köhler den ersten deutschsprachigen Interviewroman, den zweiten mit Hans Eppendorfer, ›Der Ledermann spricht‹. Den dritten versteckte er gleich in ›Explosion‹, in dem sich eine regelrechte Architektur des literarischen Interviews finden lässt. Schließlich montierte er das berühmt gewordene Interview mit Salvador Allende in dessen Residenz von 1973 in das nicht gelungene mit Borges in der argentinischen Nationalbibliothek und schließt ab mit dem prekären Gespräch, das er mit Allendes ehemaligem Minister auf einem Parkdeck zehn Jahre nach Allendes Ermordung führte. Gespräche umgeben Gespräche, konterkarieren sie, Mündlichkeit schiebt sich in Schriftlichkeit und diese wieder in Mündlichkeit. Der Proust‘sche Fragebogen muss durch den Mund des Zuhälters und sozialistischen Bordellbetreibers Wolli Köhler hindurch. Das hat natürlich System.
Es ist ja auch heute noch erstaunlich, was in einem Gespräch alles passieren kann, vor allem, wenn ein Tonband läuft! Das Pingpongsystem Literatur, das nicht aus einem hüpfenden Ball, sondern vielen hüpfenden Bällen besteht, habe ich zumindest durch ihn kennenlernen können. Gespräche zu führen, um das grundsätzlich Dialogische der Literatur in Gang zu bringen, um der einzelnen Fiktionszumutung zu entkommen, der strukturell meist eher etwas Unerotisches anhaftet. »Lerne erst einmal die Welt kennen – nimm wahr! Setz dich in Beziehung, lass dabei niemals das Hegemoniale außer acht, die Aufspannung der Machtbeziehungen durch unsere Körper und mache niemals Entscheidungsträger nach Talkshowart menschlich! Entdecke Ordnungen, ästhetische Ordnungen, darin, beteilige dich an der Verwörterung der Welt, und, mach ein System daraus!«, höre ich ihn regelrecht sagen, auch wenn er es niemals so formulieren würde, er gab grundsätzlich keine Anweisung an jüngere Autorinnen, nur an Lehrer. Zumindest wurde mir einmal eine Kassette zugesteckt, die ein Lehrer aufgenommen hatte, eine Fichte-Session im Süddeutschen, Bad Mergentheim, soweit ich es in Erinnerung habe, die ich nachhören durfte. Die Techniken jedenfalls kann man in ›Explosion‹ nachlesen.
»Jäcki lernte alle die Schweigen.
Die Listen,
Die Fallen
Die sekundären Riten die sich unter Ethnologen an den Riten der Götter entlang entwickelten wie Favelas um die Prachthäuser der ehemaligen Hauptstadt
Er lernte die Taktlosigkeiten
Die Ökonomie der Frage
Die Zielstrebigkeit
Die Schärfe, Entwaffnung, den Schnitt ins Gesicht ins Bewusstsein
die Überrumpelung
Jäcki tat so, als würde er geduldig
All das Gerumpel einer geistlichen Kolonisierung das Jäcki oft interessant genug fand, weil er ja vierhundert Jahre Kolonialismus, wie er meinte in vier Monaten noch einmal wiederholte, dass er zögerte, ob er dies, die Fieber und Erschlaffungen der Weißen die Hitze, das Schwitzen der Ethnologen nicht lieber zum Gegenstand seiner Forschungen machen sollte als das Urmaterial, das Blutbad, die Kotsuppe, den geschächteten Dackel
Aber das stand ja nicht isoliert.
Die Könige von Abomey wollten ja auch die Gewehre haben
Ein Gewehr für einen Kriegsgefangenen, einen Sklaven.
Jäcki interessierte die Reinheit nicht.« (Explosion, S. 195f.)
Dass Fichte stets wusste, mit wem er sprach, ist klar. Er wusste auch, dass dem Interview etwas innewohnt, das stärker war als man selbst. »Du schreibst ein Interview nicht selbst, es wird mit dir gemacht«, notiert er im ›Kleinen Hauptbahnhof‹ (S. 193). Ein Interview ist stets auch ein Selbstporträt des Interviewers, und die für Fichte typische Genauigkeit, das Nachfragen, Nachhaken, erzählt uns so einiges über ihn. Doch was für ein Glück: »Jäcki interessierte die Reinheit nicht.«
»Bi
In Othmarschen über den Candomblé schreiben.
Über Irma an Mario denken.
Bikontinentalität.
Eins ganz.
Das konnte Jäcki nicht.
Die Reinheit fand Jäcki furchbar
Die Reinheit gibt es nicht.« (Explosion, S. 336)
Diese Fichte‘sche Abwendung vom Reinheitsprinzip war eines meiner ästhetischen Aha-Erlebnisse, wie es so schön heißt. Die Abwendung vom Prinzip der Reinheit als realistisches Programm. Die Silbe Bi vor allen Gesten. Die zwei Richtungen gleichzeitig. Die zwei Zeiten, die zwei Gesichter. Und genau das ist es vermutlich, was mich heute noch, nach meiner Beschäftigung mit Fichte vor über zehn Jahren, noch umtreibt.
Er erschien mir einfach wie jemand, der sich traute. Es imponierte mir, wie weit er ging, wie sehr er sich zu seiner ästhetischen Forschung ermächtigen konnte, wie er die prekären Wege beschritt und vor allem miteinander verbunden hat, die ich zu gehen erstmal nicht in der Lage war. Da war die Anmaßung des Reisens, die des Autobiographischen – das Wörtchen »ich« hat er, umgeben von aller 80er-Jahre-Gefühligkeit, wieder scharf gemacht, die Anmaßung der Forschung und die der ästhetischen Weltverknüpfung: Die ›Geschichte der Empfindlichkeit‹, eine synkretistische Megastruktur, ein ästhetisches Weltsystem, ein roman fleuve, ein auf 19 Bände angelegtes Monumentalwerk, ein episches Monster, wie Gustav René Hocke, der Barock- und Manierismusforscher es ausgedrückt hätte. Eine Verwörterung der Welt, zu der man einmal kommen muss, eine poetische Anthropologie.
In ›Explosion‹ wird Fichte von Dieter E. Zimmer von der Zeit befragt:
»Dieter E. Zimmer: Sie schreiben also an einem einzigen Buch, einem roman fleuve, von dem es bisher nur Bruchstücke gibt?
Hubert Fichte: Ra. Roman fleuve? ›Fluß ohne Ufer‹? Vielleicht ›Roman delta‹.
Und wie müsste der Roman heißen?
Hubert Fichte: ›Die touristische Entwicklung in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts‹.
Wie bitte?
Hubert Fichte: Von Ausnahmen abgesehen, gibt es zwei Gruppen von Leuten: die mit touropa reisen und die vor Hunger Militärkantinen plündern. Es geht mir darum, die Entwicklung eines Mitglieds der ersten Gruppe zu schildern und seine Reaktion auf die zweite.«
(Die Zeit, 9. April 1971; vgl. Explosion, S. 216-223)
Schon möchte ich ausrufen: »Das ist sowas von heutig!«, tu es aber nicht, denn »heutig« ist so ziemlich das schlimmste Wort, das einem zu Fichte einfällt. Die ganze Touristisierung, in der wir mehr und mehr stecken, lebt von dem Heutigen, wir kolonisieren ja jetzt auch die Zeit und besuchen das Heutige wie einen besonders gut konsumierbaren Erlebnisvorgang. Fichte ist insofern nicht heutig, und doch ganz gegenwärtig. Im Sinne eines Moments einer Krise, einer Suche, eines Wegs hin zu einer Entscheidung.
Ich habe nie verstanden, warum er nicht stärker rezipiert wurde. Lange Zeit dachte ich: »Jetzt ist aber Zeit für Fichte! Warum wird er immer noch als Randfigur wahrgenommen?« Es gibt keine wirkliche Antwort darauf, nicht einmal der S. Fischer Verlag ist schuld, er hat das meiste nachgedruckt und als Taschenbuch erhältlich gemacht. Schön wäre es, wenn sich nicht nur die Synkretismusmenschen im Fichte-Raum zu Wort meldeten, nicht nur die Ethnologen, die Homosexuellen, nicht nur die Freaks und die sophisticated somebodies, sondern sozusagen alle zusammen. Aber das ist vielleicht eine der unsinnigsten Utopien, die aus einem heterosexuellen Gehirn entspringen können.
(2016)
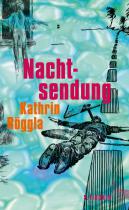
Kathrin Röggla erzählt von unserer Gegenwart. Unheimliche Szenen ereignen sich. Und wir sehen zu.
Die täglichen Bilder unserer Wirklichkeit gleichen Horrorszenen. Jemand ist dabei. Jemand sieht zu. Sind das wirklich wir? Kathrin Röggla schaut genau hin. Sie erzählt unheimliche Geschichten und entdeckt Risse, tote Winkel und das Unheimliche unserer Gegenwart. Gefahrenzonen breiten sich aus, es herrscht Desorientierung, Kommunikation bricht zusammen. Das betrifft das politische Reden, den wutbürgerlichen Aktivismus, den Absturz des Mittelstandes ebenso wie das Familientreffen in der deutschen Provinz. Sie entwirft politische, soziale und private Szenarien, die sich zu einem Nachtbild unserer gespenstischen Gegenwart zusammensetzen.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /