Kundige Kommentatoren des gegenwärtigen Frankreich werden nicht müde zu behaupten: Die Franzosen lügen sich etwas in die Tasche. Der Präsident seinem Volk oder auch das Volk seinem Präsidenten. Die Debatte darüber hält an. Doch wie dem auch sei, noch bevor dereinst die Geschichte darüber entschieden hat: Zum Schlafen legt Frankreich sich in die Tasche, in ein großes Bett, les draps bordés – wen wundert es, dass das, was einem über Jahr und Tag, über Nachahmung und Dressur lieb geworden ist, auch all denen, die ins Land kommen, als das Selbstverständlichste zugemutet wird? Kaum neigt sich der erste Urlaubstag im Nachbarland dem Abend zu und noch lange, bevor der gallische Hahn seinen Weckruf kräht, steht der Urlauber vor dem Faszinosum eines Arrangements, ein Bett als Handlungszumutung, ein Gestell, eine Bühne für die ebenso elementare wie triviale Verrichtung der allabendlichen Regeneration des Körpers. Schwüre auf die Freundschaft nach Jahrhunderten der Feindschaft, die seit Generationen erarbeitete Mission, sich Arm in Arm zur Avantgarde eines europäischen Projekts zählen zu dürfen – dergleichen Bekundungen werden auf eine harte Probe gestellt im Angesicht einer schier uneinnehmbaren Burg, forme carée: Eine Decke auf einem stramm gezogenem Oberlaken, beides an den Rändern unter der Matratze verstaut, eine Tasche mit kaum erkennbarem Eingang, ein Strich durch das Phantasma der Lässigkeit, in deren Aura sich der Reisende so gern begibt. Die Routiniers wie die unerfahrenen Neugierigen trifft es gleichermaßen, dass sich das französische Bett der Inbesitznahme durch den Benutzer zu verweigern scheint und es mit den Optionen, wie die Ermüdung gleichwohl zu ihrem Recht kommen könnte, geradezu einen Mentalitätsshift, eine Verkehrung der Stereotype erzwingt. Im Hotel, aber auch in den preiswerten Unterkünften von Airbnb steht man am Bett vor einem Rätsel, verdattert vor rätselhafter Kulisse. Das französische Bett, deren Sinnstruktur bis dato weder vom Großmeister Claude Lévi-Strauss noch von dessen spöttischem Schüler Roland Barthes erschlossen wurde, ist zweifellos geronnener Geist, doch welche kulturellen Traditionen liegen dem Geheimnis der ebenso akkuraten wie bizarren Verschlossenheit zugrunde? Folgt man den Regeln der soziologischen Kunst, so erschließt sich die Kulisse über Handlungsoptionen in einem Raum objektiver Möglichkeiten. »Die Vorstellung, dass das Sich-schlafen-Legen etwas Natürliches sei, ist vollkommen falsch«, heisst es bei Marcel Mauss, der schon in seinem »Handbuch der Ethnographie« empfahl, der Gesamtheit der Körperhaltungen nachzuspüren, der faszinierenden Interdependenz von physiologischen und sozialen Vorgängen, von Einübung und Dressur, sowie deren Ermöglichung durch die Materialität des Dings.
Wer auf ein Handbuch, eine Methode setzt, wie es die philosophische Tradition der Franzosen nahelegen würde, sucht vergeblich und so greift man auf just die Handlungsmuster zurück, die in den Verrichtungen vorm Bett tief verankert sind. Franzosen sind konservativ und revolutionär zugleich: Ernst Robert Curtius hat früh darauf hingewiesen, und wie lebenspraktisch plausibel dieses Einstellungsparadox sein kann, erfährt der Urlauber, der vorm Bett steht und sich zwischen Fügsamkeit, Eroberung und Ignoranz zu entscheiden hat. Beginnen wir mit der Fügsamkeit, dem »Wie man sich bettet, so liegt man« à la française, eine Einstellung, die dem Schlafwunsch gefällig entgegenkommt. Wenn und nachdem es einem gelungen ist, unter dem Kissenberg die Luke am oberen Ende des Betts freizulegen und sie mit vorsichtigem, dennoch kräftigem Zug in Richtung Fußende aufzuschälen, um sich dem strengen Diktat des Lakens vertrauensvoll zu überlassen und darauf zu warten, dass einen mit Hilfe der Nacht eine Art Mechanik des zur Ruhekommens ergreift. Körperkrümmungen sind so gut wie ausgeschlossen, die Füße erschöpft, nachdem sie sich innen am unteren Ende der Tasche um Entspannung bemüht haben. Anders dagegen die Eroberung: Mit kräftigem Griff beginnt man, vom Schlafwunsch getrieben, die gebordeten Enden von Laken und Decke unter der einteiligen Matratze hervorzuzerren, an drei Seiten und zwar vollständig, so dass sich am Ende einer schwungvollen bis hektischen Eroberung das Bett in einem Zustand – zerwühlt, wie geplündert, verwegen bis obszön – darbietet, als habe das Abenteuer der Nacht, leidenschaftliche Berührungen, schon stattgefunden. Oder auch als habe der Schlaf, der Hüter des Traumes, mit seinem Versprechen, die Motilität stillzustellen, vor aufwühlenden Wahrnehmungsresten des Tages kapituliert. Beinah schamvoll steht man vor dem dinglichen Zustand eines »Danach«, den man selbst herbeigeführt hat, womöglich noch mit dem traversin in der Hand und im Ungewissen darüber, ob dieser Wurst für das Kommende – sei es erotische Assistenz oder auch nur als Einschlafhilfe für Kopf und Hals – etwas abzugewinnen sei oder ob es zulässig sei, sie im hohen Bogen aus der Kulisse zu schleudern. Eine dritte Option liegt im lässigen Ignorieren, dem »Je m‘enfoutisme«. Man pfeift auf die normative Strenge des Zugemuteten, legt sich aufs Bett, gegebenenfalls mittig, im Vertrauen auf die Wärmewirkung einer Kuhle, in die es einen zieht, greift zur Weinflasche und vertraut aus Systemtrotz auf die einschläfernde Wirkung der ebenso großzügig wie unschuldig anmutenden Landschaft des Bettes, dessen textiles Arrangement man unterläuft. »Toujours au lit«, so wissen wir spätestens seit der Veröffentlichung seiner Briefe, lautete nicht selten die Abschiedsformel in der Korrespondenz Marcel Prousts. Und wie viele seiner Manuskripte sind nicht liegend auf der Decke, im erfolgreichen Transzendieren der Schlafaufforderung entstanden! Die Franzosen und ihr Bett, auf eine longue durée greift die Synchronizität von Konformität, Rebellion und Indifferenz zurück, die sich im nationalen Habitus der Franzosen stets aufs Neue reproduziert. Urlaub in Frankreich konfrontiert uns von der ersten Nacht an mit einem Stück Kulturgeschichte. Und wo, wenn nicht in der Choreographie des Zubettgehens, stößt man nachhaltiger auf die feinen Unterschiede unter den gleichen Gewohnheiten der Völker? Man hüte sich hingegen vor Klischees oder voreiligen Schlussfolgerungen, schließlich eröffnet das Innen des großflächig gepressten Zelts den Raum für ein reiches Intimitätspotenzial. Sich solipsistisch zu verkriechen, jeder auf seiner Matratze, unter dem suggestiven Versprechen eigener Zudecken, ist geradezu ausgeschlossen. In der Tasche begegnen sich die Schlafenden naturwüchsig, ohne eigenes Zutun und beinahe ohne ein Dazwischen, schicksalhaft wie in einem à propos und ohne, dass zarte Initiativen der Annäherung irgendjemandem zurechenbar sind – sind etwa die demographischen Rekorde unseres Nachbarn, die hierzulande nichts als Staunen und gelegentlich sogar Bewunderung auslösen, aus dem Nichts entstanden? Aber lassen wir die Spekulationen. Ob Merkel und Macron, ob Opel und Peugeot, Siemens und Alstom, in den neu angebrochenen Zeiten vielversprechender Fusionen wäre zukünftig zuallererst die Bettenfrage zu klären. Zu welchem Erwachen es kommt, oder an wen wer denkt, wenn er des Nachts »um den Schlaf gebracht«, wird sich dereinst zeigen, aber so viel ist gewiss: nur die Verschiedenheit, das Fremde, bringt Menschen einander näher.
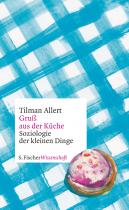
Nach dem großen Erfolg von »Latte Macchiato. Soziologie der kleinen Dinge« legt Tilman Allert nun den Nachfolgeband »Gruß aus der Küche« vor: Luftige Feuilletons über Lipgloss, den Knieschlitz in der Jeans, dunkle Brillen und den Dutt beim Manne, über Bemerkungen wie »genau« oder »lecker«, über den neuen Thermomix, die Tanzstunde, den Abschied vom Abschied oder jüdischen Humor – Tilman Allert gelingt es spielend und mit leichter Hand, aus den kleinen Dingen des Alltags deren gesellschaftliche Bedeutung prägnant zu destillieren. So muss Soziologie sein.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /