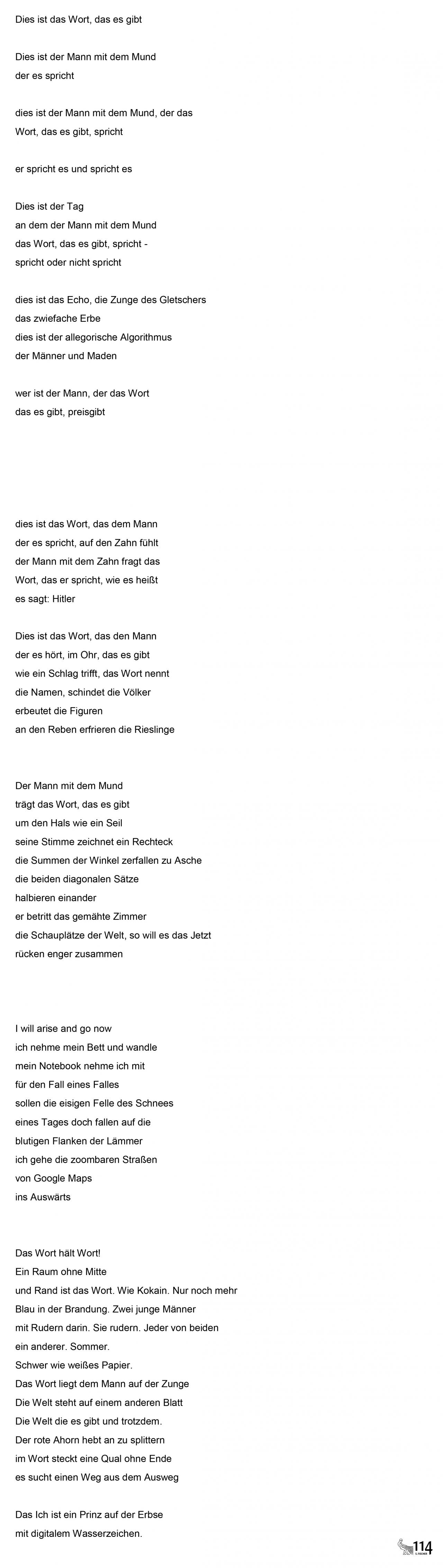
Kommentare
Kann mal jemand einen Germanisten rufen? Im Ernst, ich fürchte mich. Eindeutig ja angelehnt obig Geschriebenes an Celans Todesfuge; "er spricht es und spricht es", "Wir trinken und trinken" – "sein Auge ist blau" – wohl fände man auch sonst rhythmische Nähe und mit hinreichend Wissen ließe sich diese benennen, begründen und durch weitere Querverweise belegen? Rummstada! Mit Verlaub nun: liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle – Todesfuge … und dann eine herrlich bunte Karikatur von Papan schon drunter? Mir zittert’s … kann mal jemand einen Germanisten rufen?
Erinnert mich an dieses Gesellschaftsspiel, bei dem ein immer monströser werdender Satz vom jeweils Nächsten mit neuen Attributsätzen und Argumentationsschleifen versehen und weiter gereicht wird. Das Gedicht hat sich vorgenommen, keine Redewendung auszulassen, die das Wort „Wort“ nur irgendwie streift. Am Anfang ein Bild, das Becketts sprechenden Mund als Endpunkt der Theaterillusion evoziert, danach gewinnen sozus. der ganze Mann und das ganze Wort Konturen. Im Zentrum der Misstrauensantrag an das Wort, das, wie die Geschichte gezeigt hat, zu allem fähig ist; die kompromittierte Sprache, die das Schweigen über so viele Untaten einschließt? Wenn das Wort ein Name ist, können dadurch Leben zerstört werden, das steht fest. Folgerichtig die Machtübernahme des Wortes und das Schreckliche, das daraus folgt. Goethes Frühlingsgedicht hat, wie andere kanonische Zeilen auch, seinen verballhorten Auftritt (Ruth Klüger hat es sehr gemocht, weil es ihr wirklich das Erwachen der Lebensgeister nach dem Entsetzlichen anzeigte). „Einen Weg aus dem Ausweg“ finden: nur so kann Verdrängung umgekehrt, Geschichtsvergessenheit begegnet werden? „Ein Gott hat sie am Schopf gepackt / und aus dem Sack gerissen“ erinnert entfernt an Christine Lavants Lästergebete, die sich so vehement an Gottes Ohr wenden, dass sie es dadurch als Gegenüber vielleicht erst erschaffen. Am Ende der einsame, zu allem entschlossene Wolf, ein poetischer "Revenant", der sich in die Wildnis aufmacht, aber nicht ohne sein Notebook und vor allem nicht ohne sein Bett, und vor allem nicht dahin, wo zu den Schrecken des Eises und der Finsternis auch noch das Funkloch hinzukommt! Nicht unlustig. Die im Grashalm steckende „Zunge / des Linguismus“ ist in der Tat eine Herausforderung für die Hermeneutik. Ist er das Zünglein an der Waage? Nicht einmal das Fremdwörter-Lexikon versteht mich, wenn ich „Linguismus“ in die Suchmaschine eingebe: „Meinten Sie: Hinduismus, Jingoismus, Linguistik“? Linguismus als die Wissenschaft vom Anteil der Sprache in den Dingen? „Die Welt steht auf einem anderen Blatt“, das durfte nicht ausbleiben, das Gedicht also doch nur ein modriges Pilzgericht, alles umsonst, immer schon? War die Revokation der vor Jahren getroffenen Entscheidung, sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen, am Ende ein Fehler? Aber dann hätte es ja „das Wort“ ja nicht gegeben. Wäre Umblättern vielleicht eine Lösung? Da kann vieles nicht ernst gemeint sein bzw. da lacht sich, während ich das hier schreibe, jemand furchtbar ins Fäustchen.
die gute analyse von frau prammer bezeichnet auf indirekte weise auch das problem des gedichts, wenn gedichte denn probleme haben. wenn sie keine haben, ist der kommentar eben nur eine schöne trockene fußnote zu einem wasserschweren kopf.









 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /