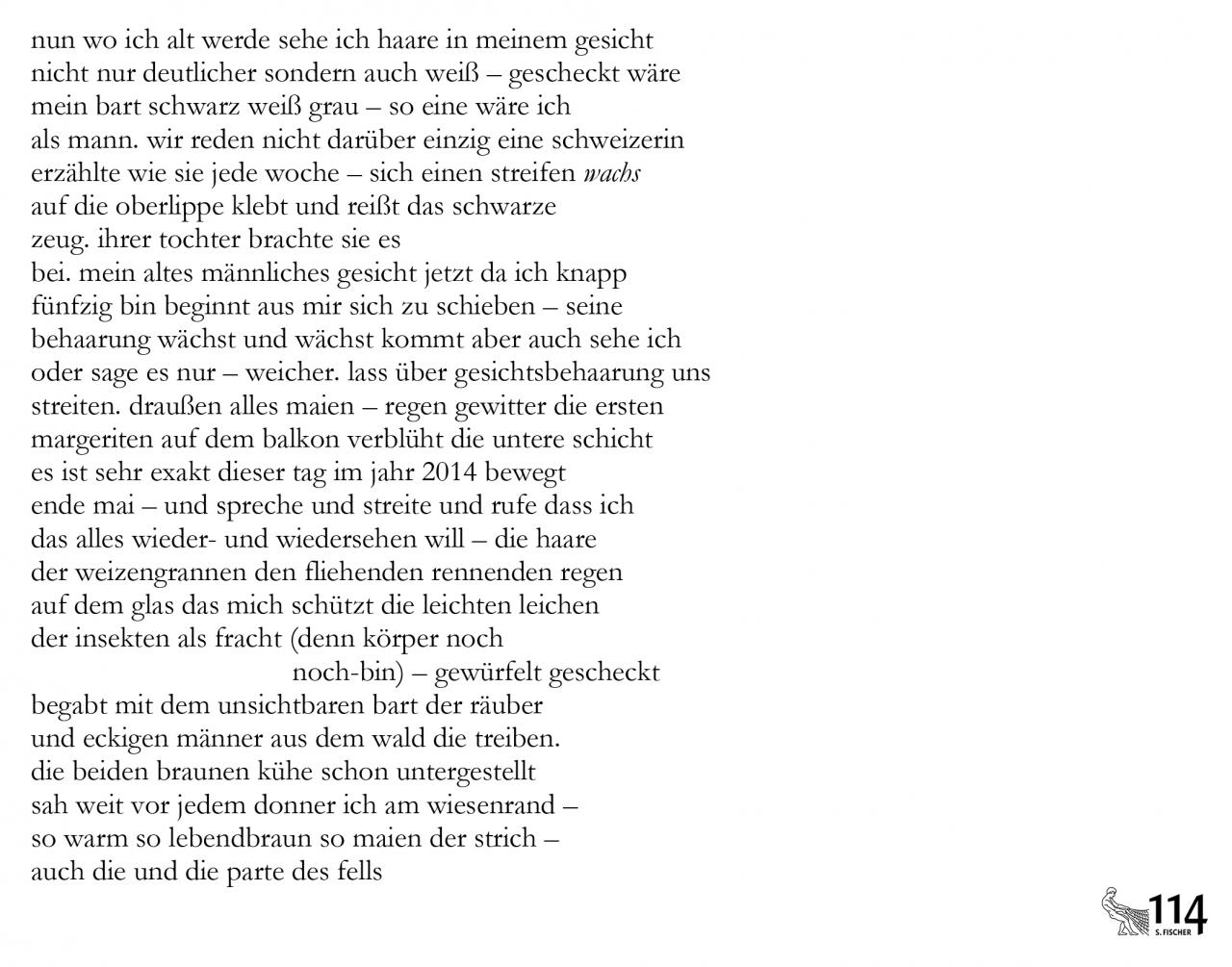
Kommentare
Irgendein Ver(s)bieter hat mal geschrieben, Gedichte über das eigene Gesicht im Spiegel (oder das eigene Gedicht im Spiegel) gehören verboten. Nun, ich begrüße sie, und erst recht dieses hier: so stattlich-traurig und gleichzeitig lustig-mokant (»so eine wäre ich/ als mann«), mit Handspiegel und Weitblick. In Zeitschwund krallt man sich in jede dusselige Einzelheit fest. Jawohl, du bist die Schönste im ganzen Land.
wie mich das freut, lieber michael hofmann: habe also mit dem gedicht einen gedichtverbieter getroffen (von dem ich nichts wusste). recht soll es ihm geschehen sein. regeln dzu, was und worüber man&frau schreiben darf, allemal im gedicht, und der untergründige spuk von der edelsten aller gattungen. das reizte mich, das frauenhaar, dort, wo es im gedicht noch nie war.
und alternd, ja. ausgesetzt der immer erneuerten aufgabe der verwandlungen - die geschehen, aus dem eigenen knochenmark heraus.
staunt man da nicht?
beruhigt ein wenig: das warme kauen der kühe?
vor der parte. DIESES wort, mit seinem anklang an das "paar", hat mich lang schon beunruhigt.
PS: es war kein spiegel, sondern die scheibe eines ICEs. was irrelvant wäre, als bloße biographische notiz. aber das spiegelgedicht in die reisegedichte spiegelt/stellt.
Nichts, was nicht ins Gedicht gehörte. Auch nicht die Gesichtsbehaarung. Denn es gibt sie, sogar mehrfarbig: ein ärgerliches Zeichen fortschreitenden Alters. Weg mit ihr. Die Autorin thematisiert ohne Scham das Unbehagen am eigenen Körper, doch die Klage switcht unerwartet-schön zu den "haaren der weizengrannen", und wir befinden uns unvermittelt in einem lichten Naturbild. Mai, "rennende regen", braune Kühe am Wiesenrand. In diesem Märchendekor kann es nicht schaden, "begabt mit dem unsichtbaren bart der räuber" zu sein. Und das Wort Fell, klingt es nicht versöhnlich?
ach ja. ich dachte, es gäbe hierzu nicht viel zu sagen, nur zu seufzen. aber dann las ich die schönen kommentare. und seufze indes noch mehr. ach ja.
lesen, während auf dem Schreibtisch zwischen Tastatur, Papieren, Füllern, Fernbedienungen, Wasserflaschen ein schon halbblinder Handspiegel liegt und auf ihrem Spiegelbild die täglich x-mal aufgenommene Pinzette –
Das eigene Gesicht im Spiegel ist sogar ein ganz vortreffliches Thema für ein Gedicht. Aber tut es dem Gedicht überhaupt gut, es vor allem als Überschreitung eines ungeschriebenen Gesetzes zu loben, also ex negativo doch normative Maßstäbe anzulegen? In der Tat gab es ja, zumindest in diesem Forum, keine Irritationen, nur ermunternde Zurufe. Dabei impliziert der Gestus des Gedichts schließlich schon die Annahme eines Verbots, das in der Folge sabotiert wird: „Lasst uns.“ Das ist ganz klar eine Einladung, und zwar eine, die voraussetzt, dass darüber 1. zu wenig gesprochen wird (da bin ich mir nicht so sicher), 2. im Gedicht zu wenig gesprochen wird. Das lenkt die Rezeption aber, jedenfalls für meinen Geschmack, in eine Richtung, die dem Träumerischen und Epischen, das sich im Gedicht später entfaltet, nicht mehr gerecht wird. Abgesehen davon wäre es ja durchaus möglich gewesen, gleich radikal in das Thema einzusteigen, ohne diese Exposition, ohne dieses charmant didaktische Beiderhandnehmen, ohne die Unterstellung einer Voreingenommenheit gegenüber dem selbstreferentiell-Körperlichen in der „Königsdisziplin“, das die Verse gleich so didaktisch zwischen Apologie und Manifest positioniert. Und ist es nicht genauso absurd, darüber zu frohlocken, „über alles schreiben“ zu können wie „über alles sprechen zu können“? Dann wären wir aber plötzlich doch wieder bei der Selbstaussprache, dem Seelenstriptease angekommen, und es kann ja nicht sein, dass das kommunikative oder korrekt politische Anliegen das sprachkritische jederzeit außer Kraft setzt.
Dabei stimmt es sicher, dass das weibliche Selbstporträt durch gesellschaftliche Ungleichheit usw. generell auf keine großartige Geschichte zurückblicken kann; eher hieß es dann schnell einmal von unangepassten, widerborstigen Frauen, sie hätten „Haaren auf den Zähnen“. Das hat sich nun aber zum Glück geändert, wenn frau etwa an Maria Lassnig, Sophie Calle und andere denkt. Eine queere Künstlerin aus meinem Bekanntenkreis macht Fotos von sich, auf denen sie mit einem Bart zu sehen ist, macht also ernst mit „so eine wäre ich / als mann“. Trotzdem, die bildenden Künstlerinnen haben leicht reden, sie haben ja das Problem mit der Sprache nicht und müssen also nicht Rechenschaft geben über ihre Haltung zu Scham und Diskretion, sie photographieren sich vielleicht nackt, aber sie machen keinen „Akt“ daraus, dass sie es tun. Und nur letzteres birgt eben die Gefahr, beim Format der exhibitionistischen Kundgebung zu landen, also im schlimmsten Fall bei Charlotte Roche.
Das geschieht in diesem Gedicht natürlich nicht. Trotzdem oder gerade darum fände ich es interessanter, es nicht in Hinblick auf das Verletzen etwaiger Tabus zu betrachten, sondern es auf uralte lyrische topoi abzuklopfen, zum Beispiel jenen der Klage, die durch technische Details in puncto Haarentfernung usw. nur noch aparter wird. Ob lyrisches und empirisches Ich übereinstimmen, wird in dann schnell sekundär. Oder zumindest ist es angenehm, wenn das Gedicht diese Abstraktion (auch) ermöglicht.
Sehr gefällt es mir, wie die Klage dann im zweiten Teil in ein Habenwollen umschlägt, sich verhaspelnd, hingerissen, hungrig und ein bißchen verzweifelt, sich gleichsam auf die Landschaft stürzend oder stützend, wobei das mit dem Zugfenster ein sehr guter Hinweis war: Durch das gespiegelte Gesicht ziehen sich die Regenspuren des Fensterglases ebenso wie die Erscheinungen der vorbeifliegenden Gegend. Plötzlich stimmt das, was der Blick einfängt, mit dem, was der Sprechenden ins Gesicht geschrieben ist, überein. Verblühende Blumen zum Beispiel, mehr Symbol geht nicht! Aber warum auch nicht, es gibt ja kaum ein besseres. Dazu die Wiederkäuer, an denen die von Erinnerungen Heimgesuchte sich weidet und die gutmütig und „parte“ pro toto für das ungetrübte Vor-sich-Hinleben stehen? Versöhnlich, ja, aber neben das Kuhfell würde ich mir dann noch ein „Pelzchen“ wünschen, damit die Erotik nicht ganz auf der Bahnstrecke bleibt. Bitte!!!
Ob man den Schock des Irreversiblen (dieses Härchen hier: es wird nie wieder nicht gewesen sein, selbst wenn ich es ausreiße!) wirklich als fruchtbares Staunen verbrämen kann, das bezweifle ich. Ein bisschen Flucht nach vorne ist da vermutlich auch dabei. Es liegt ja auch eine Süße in dieser Unerbittlichkeit und ein kleiner Triumph im Unterstreichen der Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber, ein „ich mache mir nichts vor“, „ich weiß, woran ich bin“ usw. Damit sollen keine niedrigen Beweggründe unterstellt werden, ich denke nur, dass die Psychologie in solchen Dingen immer komplexer ist als nur das Hintertreiben von Gemeinplätzen. Selbstdarstellung, Rollenspiel, Pose usw. haben zwar auch ihre Tücken, aber sie halten die Sache offener, während der angeblich so gerade Weg der „Aufrichtigkeit“ auch nicht vor Sackgassen gefeit ist.
Sehr schön kommt im Gedicht die Spaltung in der Konfrontation mit vergangenen Ichs zum Ausdruck. Das gibt wirklich zu denken. Führen hollywoodesk-schönheits-operierte Personen nicht vielleicht manchmal ein grausames Doppelleben, wenn ihnen neben dem Bild im Spiegel feixend auch das Gesicht vorschwebt, das ihres wäre, wenn niemand eingegriffen hätte? Eine Art umgekehrter Dorian-Gray-Effekt, bei dem das Gesicht zum Bild wird, während das wirkliche Gesicht auf Nimmerwiedersehen gelöscht ist... Und Vanitas ist ja doch ein wunderbar doppelzüngiges Wort, weil es die hilf- und haltlosen kosmetischen Eitelkeiten auf der einen Seite, und die Eitelkeit, ergo Vergänglichkeit, in eines fasst; die pedantische Klage über die Zeichen der Zeit und das Ende des Zeitlichen schlechthin. Das sind zum Teil auch die Themen, die du, Ulrike, so raffiniert in die Shakespeare-Sonette projiziert hast.
D’accord: Lasst uns also über Gesichtsbehaarung sprechen! Aber lasst uns darüber nicht vergessen, dass Gedichte auch alles Mögliche wegzaubern können, was wir nicht sehen wollen, oder mittelmäßig aussehende Menschen in Feen und Götter verwandeln, und vor allem unsterbliche (naja) Schönheit mit unauffälligen Mitteln erzeugen, zum Glück! Düpiert sind wir ja ohnehin schon genug. Schön wäre es übrigens auch, dieses Gedicht mit „Forsythien“ zu vergleichen, wo das „nichts kehrt zurück“ dem Kindheits-Ich galt, auf das hier bereits weitere Stationen folgen. http://www.lyrikline.org/de/gedichte/forsythien-die-knallgelb-noch-blatt...








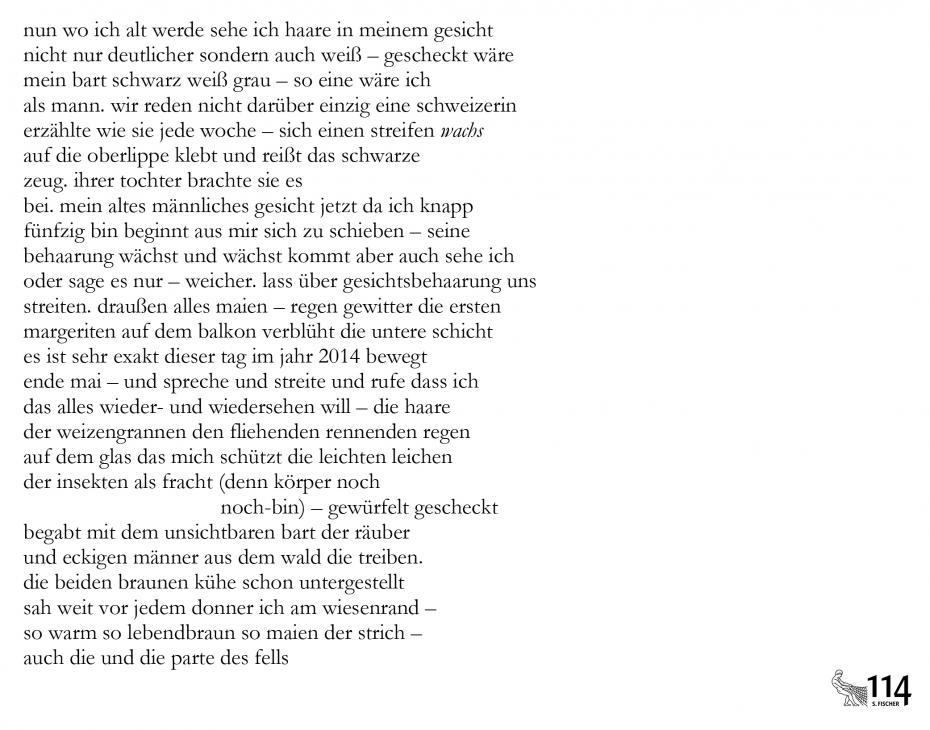
 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /