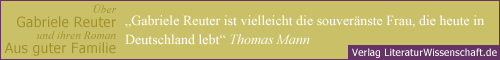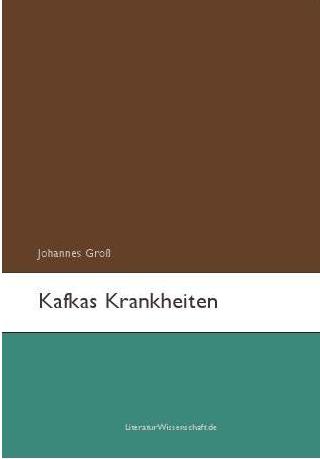Leserbriefe zur Rezension
Ziemlich schnuppe
Hans Wollschlägers gesammelte Essays und Literaturkritiken bieten nicht viel mehr als um sich selbst trödelnden Narzissmus
Von Jan Süselbeck
Gabriele Gordon schrieb uns am 03.03.2007 Es mit einem "staunenswerten Tausendsassa" aufzunehmen, der, o Wunder, "Schriftsteller" genannt wird, weil er einen Roman verfaßt hat, "Essayist", weil er Essays schreibt, "Übersetzer", weil er übersetzt, "Rhetor", weil er Vortragskünstler ist, "Organist", weil er Kirchenmusik studiert hat uswusf., das ist natürlich keine Kleinigkeit. Und so muß sich der werte Rezensent eben auch als Tausendsassa betätigen und ›enthüllen‹, daß der Autor "alle Elemente der zähen Moritat, die Wollschläger in seinem Essay zur Literaturkritik aufspielt, bei Schmidt entlehnt", und überdies die "aberwitzige Rechnung, nur die Dritte Wurzel aus P (für Population), also etwa 465 der hundert Millionen Deutschen, sei zu den "eigentlichen Kulturträgern einer Nation" zu zählen", von seinem "Bargfelder Lehrmeister" habe. Stimmt auffallend, wobei jeder nicht mal gute Leser dieses Plagiat Wollschlägers Essay unschwer entnehmen kann: schließlich wird SCHMIDT dort nicht nur in GROßBUCHSTABEN als Wurzelzieher identifiziert, sondern auch, erkennbar an den von Süselbeck übernommenen Kursiven, korrekt zitiert. Daß die Autoren-Klagen über den Literaturbetrieb, die Leser und die Kritik weder mit Schmidt anfangen noch mit ihm aufhören, wie Süselbeck anzunehmen scheint, hätte auch der Rezensent wissen können, der doch zumindest diesen einleitenden Essay gelesen zu haben scheint, in dem Entsprechendes von Lichtenberg, Wieland, Schopenhauer, Kraus u.a. wiedergegeben wird, sämtlich mithin "feinsinnige Nichtskönner" - oder? |
Guido Seifert schrieb uns am 14.03.2007 Die Wollschläger zugeschriebene „antifeministische Haltung“, die Sie, Frau Gordon, dem zuschreibenden Rezensenten sehr zu Recht mit der Höchststrafe vergelten wollen, erlaubt – neben sicher noch anderen - eine weitere Betrachtung und Erwiderung. Man könnte fragen, ob es denn wünschenswert sei, daß Wollschläger, anstatt uns seine „typische antifeministische Haltung“ zu beweisen, eine typisch feministische einnähme? Die Frage ist natürlich rhetorisch, denn wir möchten nicht, daß Wollschläger mit überhaupt irgendeiner Haltung aufwartet, deren Bestimmung auf –istisch endet. Fürchten müssen wir hier aber gar nichts, denn es gibt keinen einzigen Text Wollschlägers, der die Vermutung nahe legte - oder auch bloß die Ahnung erregte -, daß hier ein Ideologe zu uns spräche. Wäre es denn anders, so gäbe es keinen Hans Wollschläger. Es gibt ihn aber, und er ist zu intelligent, um es sich im Umfeld einer Ideologie behaglich zu machen. Und es gibt vielleicht auch jenen Tiefen Blick, der einen für alle erlebbare Zukunft vor dem Erwerb eines Augenfehlers schützt. Dort, wo sich Wollschläger vorwagt, geschieht dies immer mit einem formulierten Vorbehalt, mit dem Zugeständnis eines tastenden Denkens, mit dem Bekenntnis der Vorläufigkeit. Diese hohe Seriosität des Denkens ist nicht nur achtenswert und erwünscht, sondern sogar nötig, wenn in unsere Ohren gesprochen werden soll. Sie feit den kreativen Denker vor Ismus-Segmentierung und istischer Weltflucht, schützt ihn vorm ideologischen Spießertum. Kontrolle und Konzentration sind wesentliche Merkmale der psychoanalytischen Literaturbetrachtung Wollschlägers, und diese hohe intellektuelle Redlichkeit könnte der Rezensent auch in den literaturkritischen Essays des von ihm Geschmähten wiederfinden, könnte hier sogar ein literarisches Sensorium wirkend sehen, wie es nur selten jemandem zugeteilt wird. Statt dessen findet der Rezensent das alles nur langweilig und überholt. Er hat aber auch ganz offensichtlich anderes zu tun, und damit ihm dieses Tun auch selbst verständlich werde, empfehle ich ihm den „Bruder Kuhn“, dem Wollschläger im „Raben“ Nr. 4 ein Denkmal zu errichten begonnen hat. Dort kann der rasende Rezensent nachlesen, warum er sich seine Polemik ganz unmöglich verkneifen konnte. Er wird dann vielleicht auch ein wenig besser begreifen, warum er die „Geniestreiche“ Wollschlägers als „lähmende[] Lektüre“ empfinden muß. Und wenn alles gut geht, wird er auch nicht mehr ganz so lustig finden, was er unlängst nicht nur über den anderen Rezensenten - Tilman Krause - sondern auch gleich über sich selbst geschrieben hat: „Polemiken sind ein wichtiges Instrument der Literaturkritik. Ohne sie wäre unser Feuilleton ärmer, ja langweilig und belanglos. Lustig ist es zudem immer wieder, wenn sich erregte Kritiker in ihren blindwütigen Attacken kurzerhand selbst vernichten: Etwa dann, wenn sie das Buch nicht gelesen haben, über das sie sich so maßlos erregen. Oder wenn sie den Sachverhalt, über den sie sich empören, nicht einmal im Ansatz begriffen haben.“ Kurz und noch einmal: Ich empfehle dem Bruder des Bruders, den „Kuhn“ zu lesen. Mit etwas Glück – das braucht man ja immer – könnte er dieser Lektüre eine Frucht abgewinnen, deren heilende Wirkung seine Selbstvernichtung unwahrscheinlich macht. Sollte er es aber an künftigen Suizidversuchen nicht fehlen lassen, wäre nicht einmal ausgeschlossen, daß Wollschläger selbst ihn in den Blick bekäme; und dieser „Kulturmacho[]“ könnte ja auf den Gedanken kommen, auch dem Rezensenten ein Denkmal zu errichten. Das aber können wir nicht wollen; und schon gar nicht der Rezensent selbst, der sich in seiner Rezension ja nicht nur als Wollschläger-Verächter sondern auch als Arno-Schmidt-Kenner ausweist, und somit der Schrecknisse gewärtig sein dürfte, die uns dieser andere Kulturmacho mit der Tina-Hypothese nahe gebracht hat. So lange so wollen wir doch alle nicht leben. Da gehen Ego- und Altruismus aufs Reinlichste in eins: Jedem soll doch, bitte, das Nichts eher verfügbar sein als den Großen Dichtern und ihren Mitgeschleppten. Da unten aber, nach einer Dekade säuselnden Becksandstein-Sammelns, tobt und lästert man, als ob es den Abstieg nie gegeben hätte. |
Hilla Pretzer schrieb uns am 06.09.2007 "Um sich selbst trödelnden Narzissmus": finde ich eine sehr gelungene Formulierung. |