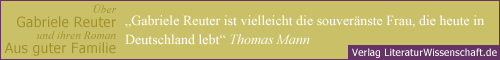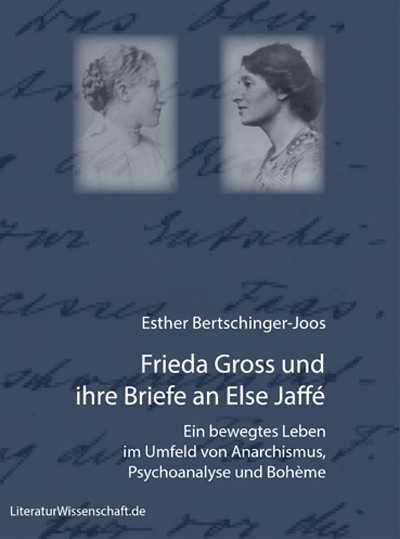Karl-Günter Zelle schrieb uns am 07.07.2010
Thema: Klaus-Jürgen Bremm: Allenfalls Indifferenz
Replik des Autors: Stimmt dieser Bericht?
Replik von Karl-Günter Zelle, Autor von: „Hitlers zweifelnde Elite: Goebbels – Göring – Himmler – Speer“ zur Rezension von Klaus-Jürgen Bremm
Wer ist der Rezensent
Klaus-Jürgen Bremm ist Militärhistoriker mit einem Lehrauftrag an der Universität Osnabrück. Zu seinen Forschungsgebieten gehört nicht das Dritte Reich.
Ein Verriss steht ihm natürlich frei, aber was er über den Inhalt berichtet, sollte schon stimmen. Einige Beispiele:
Was ist dieses Buch?
Bremm: Aber lassen sich der Nationalsozialismus und seine Jahrhundertverbrechen tatsächlich durch angeblich allgemein gültige psychologische Mechanismen erklären?
Nein, den Nationalsozialismus insgesamt erklären will dieses Buch nicht. Das wäre allzu kühn.
Es geht vielmehr darum, wie vier der mächtigsten Anhänger Hitlers ihren „Führer“ sahen, wie sie an ihn glaubten und wie sie an ihm zweifelten: Dennoch füllten sie ihre offizielle Rolle aus und folgten Hitler bis zum Schluss – mit Einschränkungen. Das erzeugte erhebliche innere Spannungen. Die Folgen waren bizarr: es kam zu massiven Fehlwahrnehmungen und zu Illusionen, die sich mit klarer Erkenntnis der Wirklichkeit abwechseln konnten. Und hier hilft Psychologie, das zu verstehen.
Die Zweifel
Bremm: Denn erstens waren die Zweifel an Hitlers Führungsfähigkeiten, sieht man einmal von der Endphase des Krieges ab, durchaus nicht prägend für das Verhalten seiner höchsten Paladine. Vor allem aber waren es eben nicht grundsätzliche Vorbehalte gegenüber der rassistischen Politik des Völkermordes, die Goebbels, Göring, Himmler oder Speer irgendwann auf vorsichtige Distanz zu ihrem geliebten Führer gehen ließ, sondern ausschließlich Fragen technischer Natur.
Es geht um mehr als die Endphase des Krieges. Goebbels erste Zweifel an seinem „Führer“ stammen von 1926, Görings von 1938. Und es geht nicht nur um Verhalten, ‒ das wurde in der Tat vielfach untersucht ‒ sondern um innere Fragen nach dessen Sinnhaftigkeit. Auch handelt es sich nicht um „Fragen technischer Natur“, sondern darum, ob der Glauben an Hitler als den heil- und siegbringenden „Führer“ Bestand haben konnte.
Die Zweifel betrafen kaum die ungeheuren Verbrechen des Nationalsozialismus, dies sieht Bremm richtig. Aber es bleibt genug. Einige Beispiele: Für den jungen Goebbels ging es zum Beispiel darum, ob auf dem Boden Russlands ein riesiges deutsches Kolonialreich zu errichten war – die Zweifel hieran waren dauerhaft nicht zu beschwichtigen. Und Göring musste in der Sudetenkrise erkennen, dass Hitler einen großen Krieg nicht scheute. Er wusste, dieser war nicht zu gewinnen. Dennoch befahl er ein gigantisches und illusorisches Rüstungsprogramm. Lösen konnte er diesen und vergleichbare Konflikte nie. Er versuchte, auszuweichen.
Der Verräter Himmler
Bremm: Wie aber der umtriebige und skrupellose Schöpfer einer krakenartigen Organisation von Massenmördern und Henkersknechten, die ganz Europa für ein halbes Jahrzehnt in Angst und Schrecken versetzt hatte, tatsächlich glauben konnte, er würde in einer von den Alliierten bestimmten Nachkriegsordnung noch eine politische Rolle spielen, ist auch bereits von Peter Longerich ausführlich untersucht worden.
Nein: Longerich sieht Himmler erst ab März 1945 auf der Suche nach einer neuen Rolle in einem Deutschland nach Hitler. Tatsächlich begann diese schon viel früher. Longerich untersucht auch nicht Himmlers früh einsetzende Zweifel an einem deutschen „Endsieg“, nicht sein Dulden des Widerstandes, nicht seine vielfältigen Friedensfühler zu den westlichen Alliierten und nicht die als Vorleistung gedachten Häftlingsfreilassungen. Dieses Agieren auf zwei widersprechenden Ebenen wird hier erstmals im Zusammenhang dargestellt.
Der Lügner Speer
Bremm; [k:]Zelle […] will auch nicht das bisher in der Forschung bestehende Bild des Rüstungsministers [Speer] als geschickter Lügner vor dem Nürnberger Tribunal gelten lassen.[:k]
Speers Auslassungen und Verschleierungen, nicht nur beim Nürnberger Prozess, werden ausführlich behandelt, hier wird nichts beschönigt. Aber eine biographische Studie sollte sich nicht mit diesem Aspekt begnügen. Vielmehr wird dargestellt, zu welchen inneren Konflikten und Widersprüchen Speers enge Bindung an Hitler führte. Noch in den langen Jahren der Haft sah er sich an Hitler gebunden und verabscheute ihn gleichzeitig wegen seiner millionenfachen Mordtaten.
Wo bleiben die Dämonen?
Bremm: Diesen moralischen Graben ebnet der Autor jedoch mit seinem psychologisierenden Ansatz wieder ein, da er versucht, das Verhalten seiner Protagonisten mittels des bekannten Schemas der kognitiven Dissonanz zu entdämonisieren.
Das Böse erscheint oft nicht im dämonischen Gewand. Hannah Arendt hat dies verstört, als sie Adolf Eichmann beobachtete und sie sprach dann von der „Banalität des Bösen“. Bremm kennt offensichtlich nicht die Täter- und Genozidforschung. Vorwerfen will ich ihm das nicht, Aber er hätte sich in meinem Buch informieren können, auch und gerade über die so wichtige moralische Frage. Der „moralische Graben“ ist an der richtigen Stelle zu ziehen.
Eine andere Rezension
Glücklicherweise gibt es auch eine andere Meinung (Martin Moll in: ZRG 126 (2009) (http://www.koeblergerhard.de/ZRG128Internetrezensionen2011/ZelleKarl-Guenter-HitlerszweifelndeElite.htm). Moll stellt fest, dass das Werk in gelungener Weise eine Forschungslücke schließt: der „Hitler-Mythos“ (Ian Kershaw) aus Sicht der engsten Anhänger.
Karl-Günter Zelle
|