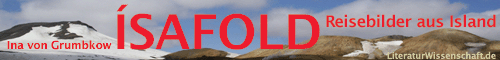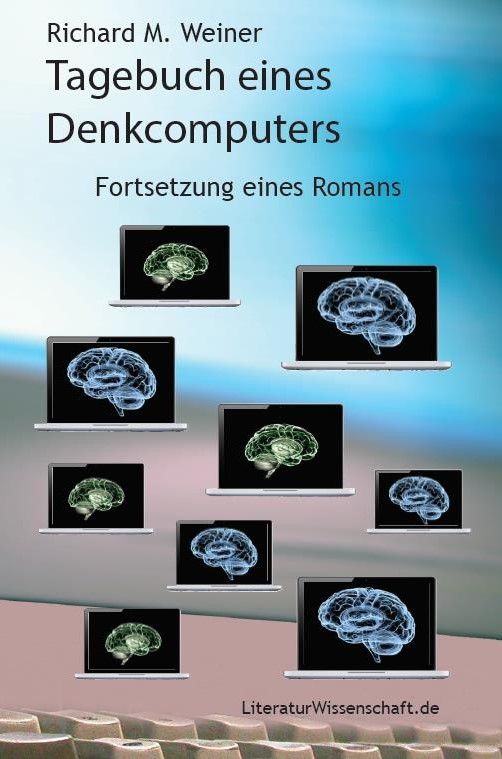Frank Müllers schrieb uns am 10.04.2006
Thema: Gesa Steinbrink: Eine riesig mühevolle Arbeit und vielleicht nicht mal geglückt
Liebe Frau Steinbrink,
ohne Ihnen zu Nahe treten zu wollen, aber die "Beiläufigkeit" des Erzählens als persönliche Feigheit des Dichter zu werten, die Dinge beim Namen zu nennen, zeugt nicht nur von ziemlich unziemlichen Unkenntnis von Fontanes Werk und seinen künstlerischen Zielen, sondern auch von einem mangelnden Gespür allem Literarischen und Künstlerischen gegenüber; wenn sich alle Dinge beim Namen nennen ließen, hätten wir weder Literatur, noch Kunst, sondern lediglich journalistischen Pamphlete.
Aber weg vom theologisch Allgemeinen, hin zum künstlerisch Konkreten: Die indirekte Erzählstrategie (das ist geläufige Umschreibung für die fehlende Traute, die Dinge beim Namen zu nennen) zielt auf eine Größe, die über den Verstand geht, nämlich die Phantasie, und auf die kam es Fontane vor allen Dingen an. Berühmt hierfür ist in "Effi Briest" etwa der Ehebruch Effis mit Major Crampas, die hinter den Kulissen des Romans stattfindet, lange nur im Bereich der Ahnungen verbleibt, und erst zum Ende durch den Fund der Briefe hin bestätigt wird. Diese Erzählstrategie ist weder von Fontane erfunden, noch seinem (vermeintlich) prüden Zeitalter geschuldet, sondern in der englischen Literatur in der Gothic Novel im Umgang mit dem Übernatürlichen, entwickelt worden. Vor allem namentlich von Ann Radcliff, die als erste entdeckte, wie sehr viel wirkungsvoller es ist, das Übernatürliche nicht direkt in Erscheinung treten zu lassen, sondern nur indirekt, über die personale Ebene der Figuren, durch deren Erzählungen und Briefe, in die Romanwirklichkeit treten zu lassen. Die Früchte dieser künstlerisch hoch innovativen Erzählstrategie lassen sich noch bis Dickens und sogar noch Henry James ohne viel Federlesens ausmachen. Natürlich kannte Fontane als Dickens-Verehrer und als bekennender Liebhaber der englischen Literatur Fauch Ann Radcliff, und auch Ihnen wird ja nicht unbekannt sein, dass das Übernatürliche in Fontanes Roman- und Lebenswelt eine auffällige Rolle spielt (die weiße Frau in "Unwiederbringlich", der Chinesenspuk in "Effi Briest" etc). Fontanes Zutat und Verfeinerung zu diesem Kunstmittel besteht darin, dieses eben nicht mehr allein auf die traditionellen Gebiete des Übernatürlichen des Schreckens anzuwenden (wie dies zum Teil bei Dickens noch der Fall ist), sondern eben auch auf dem Gebiet der illegitimen Liebe, womit er der Phantasie - auch in deren gefährdenden Ausmaßen im öden Realismus-Konzept des 19. Jahrunderts - , einen Platz in der Kunst zurückerobert hat. Dieser Phantasie (der „Macht der Vorstellung“ wie Fontane es nennt) ausgeliefert, ihr zu erliegen, mit all den Folgen bis hin zum Dahinsiechen das ist das eigentliche Thema, das sich hinter der Liebesaffären in Fontanes Romanen verbirgt.
Ich kann Ihnen natürlich nur ein paar Fingerzeige geben, die aber Ihnen vielleicht doch deutlich machen, dass es sich durchaus lohnen könnte, hinter mancher Kunst auch das Kunstwollen aufzuspüren (das des in jeder guten Kunst gibt, und nicht nur auf persönliche Marotten des Autors (das gibt es nur in der schlechten Kunst). Vielleicht brauchen Sie sich nur mal vorzustellen, wie Gustav-Freytag, bzw. Hedwig-Courth-Mahler-mäßig die Liebesaffären in "Cecil", aber auch in "Effi Briest", "Irrungen, Wirrungen", und „Schach von Wuthenow“ sich ausgemacht hätten, wenn Fontane, wie Sie es nennen, "die Dinge beim Namen“ genannt hätte, statt sie derartig kunst- und trickreich der Phantasie der Figuren, aber auch vor allem der Leser zu überantworten, wo sie ja bis heute noch lebendiges, sublimes Fortleben führen.
|