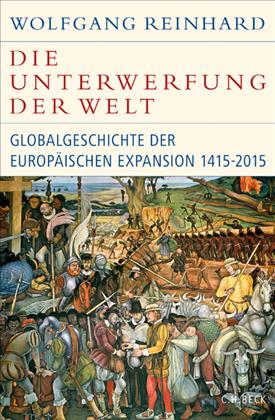Als hohe Geistlichkeit die Welt(en) definierte
Mona Kirsch thematisiert Organisation, Verhandlungen und Rituale in einer Arbeit über „Das allgemeine Konzil im Spätmittelalter“
Von Jörg Füllgrabe
Mögen in der Gegenwart Kirchentage im Allgemeinen – zumindest was den ‚Eventcharakter‘ angeht – womöglich die Rolle von Konzilien übernommen haben, war dies selbstverständlich nicht immer so; und gerade die Konzilien des späteren Mittelalters erscheinen aus heutiger Perspektive interessant, weil sie am Vorabend der Reformation liegend mitunter vertane Chancen der Reform dokumentieren. Aus diesem Grunde macht ein Buch zum ‚Allgemeinen Konzil im Spätmittelalter‘ neugierig.
Die vorliegende Publikation wurde von der Verfasserin als Dissertationsschrift angelegt und 2013 von der Universität Heidelberg akzeptiert. Allein der Umfang vermag schon zu beeindrucken, und auch der untersuchte engere Zeitraum vom 13. bis zum 15. Jahrhundert nötigt Respekt ab. Bereits in der Einleitung wird nicht nur die Fragestellung vorgestellt, sondern es werden auch die definitorischen Rahmen geliefert, unter denen der Zugang zum Konzilswesen des späteren Mittelalters erfolgreich ist. Symptomatisch ist bereits hier wie auch an anderen Stellen der mitunter nicht wirklich gut lesbare Textduktus.
Im zweiten Hauptteil (‚Die Konzilsordines als präskriptives Handlungsgerüst‘) wird überdies der Bogen noch weiter gespannt, thematisiert Kirsch auf neunzig Seiten doch entsprechende Phänomene bereits des früheren Mittelalters bis ins 15. Jahrhundert. Diese breite Basis und auch die zum Teil vorweggenommene Thematisierung später behandelter Konzile schadet zwar nicht, hätte in kürzerer Form aber vermutlich lektürefreundlicher und damit letztlich zielführender gewirkt.
Die beiden folgenden Hauptabschnitte befassen sich mit Aufbau und Handlungsmustern der Konzilien im 13./14. und 15. Jahrhundert. Hier werden konkretere Untersuchungen vorgelegt und zu den jeweiligen Unterpunkten ‚Verhandlung‘, ‚Inszenierung‘ und ‚Organisation‘ Beispielskonzilien in den Blick genommen. Diese ‚eigentlichen‘ Kapitel zeugen von der Sorgfalt und Arbeitsintensität, mit denen die Verfasserin an ihr Thema gegangen ist. Die theoretischen Parameter werden mit den tatsächlichen Ereignissen abgeglichen beziehungsweise auf diese angewandt, wobei allerdings mitunter der Eindruck entsteht, dass eben diese Systematik gegenüber der historischen Wirklichkeit (soweit diese für uns überhaupt fassbar ist) prioritär gestellt wird. Mit anderen Worten: Das vorgegebene theoretische Raster wird nicht auf jeweils ein bestimmtes Konzil angewandt, sondern die Grundkonstanten scheinen auf unterschiedliche Konzilien des gewählten Großzeitraums bezogen zu werden.
Das vereinfacht die Lektüre der vorliegenden Publikation nicht unbedingt, und es ist mitunter nicht ganz einfach, sicherlich vorhandene Stringenz zu erkennen. Verwirrend erscheint auch der Perspektivwechsel. Wird etwa unter Punkt [III] 1.5 – die Binnenzählung wird ohne die Hauptkapitelzählung dargestellt – noch über den Punkt der ‚Inszenierung‘ in eher allgemeiner Form berichtet, folgt das konkrete Beispiel unter Punkt [III] 2, der ‚Konzilsversuch Gegors IX.‘ Der nächste Unterpunkt 2.1 (‚Papst und Kaiser im Konflikt‘) wird mit folgenden Worten eingeleitet: „Innonzenz III. wäre sicherlich überrascht gewesen, hätte er geahnt, welche abgrundtiefe Feindschaft sich zwischen seinem ehemaligen Mündel, dem verwaisten Stauferkaiser Friedrich und dem Stuhl Petri entwickeln sollte.“ Hier wie an anderen Stellen gilt es festzuhalten, dass die gewählten Formulierungen, vorsichtig ausgedrückt, unglücklich sind. Zum vorliegenden Beispiel sei nur die Anmerkung gestattet, dass, hätte Innonzenz diese Feindschaft vorausgeahnt, er aufgrund seiner Weitsicht mit ziemlicher Sicherheit eben nicht überrascht gewesen wäre. Selbstverständlich ist erkennbar, worauf die Autorin hinweisen möchte, die Frage, warum dieser Rückgriff auf Innonzenz gewählt wurde, sei an dieser Stelle dennoch gestattet.
Derlei Formulierungen trüben neben den bereits angesprochenen Brüchen in der Stringenz der Darstellung den Lesegenuss. Wünschenswerter wäre eine Verdichtung der Argumentation, aber auch des theoretischen Überbaus, der vieles von dem, was im ‚Allgemeinen Konzil im Spätmittelalter‘ steckt, auch für die nicht in den letzten Details der Diskurslage Bewanderten den Zugang zum Thema gewiss vereinfacht hätte. Eine entsprechende, auch stilistische, Überarbeitung der Dissertationsarbeit hätte dem veröffentlichten Buch in jedem Falle gut getan.
Ein Weiteres noch: Besonders zu bedauern ist, dass Bildbeispiele zwar detailliert beschrieben werden, aber nicht reproduziert sind. So ist es schon ein wenig ärgerlich, folgendes zu lesen: „Zu einer der wenigen bildlichen Darstellungen des Pisaner Konzils gehört eine farbige Illustration aus der amtlichen Berner Chronik […]. Das Bild zeigt ein seltsames Schauspiel: In trauter Eintracht beobachten König Sigismund und der neu gewählte Papst Alexander V. gemeinsam mit den Kardinälen und Bischöfen einen großen Scheiterhaufen, in dessen Mitte zwei Männer an einen Pfahl angebunden sind. […] Damit können nur die auf dem Konzil abgesetzten Anwärter auf das Papsttum, Benedikt XIII. und Gregor XII. gemeint sein.“ Davon abgesehen, dass die beiden Unglücklichen sich zwar auf das Papstamt, jedoch kaum auf das ‚Papsttum‘ beworben haben können, verweist Kirsch auf die Fiktionalität dieser Darstellung und den Umstand, dass Sigismund gar nicht an diesem Konzil teilnahm. Mindestens so interessant wäre allerdings das hier thematisierte Bild gewesen. Auch an anderer Stelle hätte sich statt einer mitunter recht weitläufigen Bildbeschreibung eine Reproduktion der jeweiligen Illustration angeboten.
Gleichwohl ist vorliegendes Buch zumindest einer intensiveren Lektüre anzuempfehlen. Bereits das knapp einhundert Seiten umfassende Quellen- und Literaturverzeichnis sowie das 18 Seiten umfassende Register erlauben den Zugriff zu weiterführender Beschäftigung beziehungsweise weisen einen Zugang zur Basis aus. Das Buch als Ganzes ist – trotz der angesprochenen Kritikpunkte – durchaus der Lektüre wert, wenngleich eben nicht immer einfach zu verdauen. Da sich der Verkaufspreis überdies im vertretbaren Rahmen hält, wird Kirschs Publikation auch in mancher Privatbibliothek seinen insgesamt berechtigten Platz finden.
Ein Beitrag aus der Mittelalter-Redaktion der Universität Marburg
|
||