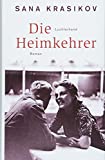Die große Illusion
In ihrem ersten Roman folgt Sana Krasikov den Wegen und Irrwegen von amerikanischen Naiven im Sowjetreich und darüber hinaus.
Von Heribert Hoven
Das Verhältnis der USA zu Russland steht zur Zeit im Fokus des Interesses. Beleuchtet wird diese schwierige Beziehung in Amerika auch durch ein dort blühendes literarisches Genre, den russisch-jüdischen Emigranten-Roman, dessen Vertreter wie Gary Shteyngart, Boris Fishman oder Ellen Litman in der Sowjetunion zur Welt kamen und das Land dann als Kinder oder Heranwachsende verlassen haben. So auch die 1979 in der ukrainischen Sowjetrepublik geborene Sana Krasikov, die Ende der achtziger Jahre mit ihren jüdischen Eltern in die USA auswanderte und nach einem Erzählband In Gesellschaft von Männern nun mit Die Heimkehrer (2017) ihren ersten Roman vorlegt.
In dem Mehrgenerationen-Roman kehrt sich jedoch zunächst einmal die Bewegungsrichtung um. Denn Krasikov schickt drei Generationen einer Familie von den Vereinigten Staaten nach Russland. Allen voran die eigentliche Protagonistin Florence Fein, Tochter litauischer Einwanderer, die sich 1934 an Bord des Schiffes „Bremen“ begibt, um, wie so mancher westlicher Intellektueller, das „Arbeiterparadies“ mit seinen großen Gleichheits-Versprechungen kennen zu lernen. Allerdings nicht auf einer Kurzvisite, wie etwa zur selben Zeit Joseph Roth, Oskar Maria Graf, Klaus Mann, Lion Feuchtwanger, André Gide und viele andere, sondern um dort zu leben und zu arbeiten. Das „Warum?“ reflektiert sie fast am Ende ihres Lebens in einer umfangreichen Rechtfertigungsrede:
Nicht dass sie nicht an Veränderungen in Amerika geglaubt hätte – es änderte sich ringsum ja vieles, sogar damals. Aber wer hätte vorhersehen könne, was alles kam: die Spaltungen, die Kriege, die Rassenunruhen, die gesamte Epoche von ‚Sexus und Herrschaft‘, von der sie heute schrieben. Die Frauenrechtlerinnen. Wer hätte die Pille vorhergesehen – die Frauen von einer jahrtausendelang getragenen Last befreite. Ja, sie hätte bleiben und darauf warten können, bis all diese Veränderungen kamen – ein jahrzehntelanger Weg in den Fortschritt. Sie hätte bleiben und diesen Weg mitgehen können. Aber dafür hatte ihr die Geduld gefehlt. Sie wollte all die Verbote und Hindernisse, die Vorurteile und Lebensregeln überspringen und sich gleich in die Zukunft stürzen. Und die verkörperte für sie damals die Sowjetunion – ein Land, in dem die Zukunft bereits gelebt wurde. Sie war aus dem Land der Freien geflohen, um sich frei zu fühlen.
Dass dies schief gehen könnte, dämmert ihr bereits bei der Ankunft, als sie merkt, dass zum Beispiel das Ideal der freien Liebe stets auf Kosten der Frauen geht. Mit einigem Glück findet sie allerdings Arbeit und schließlich einen Ehepartner mit Namen Leon Brink, der ebenfalls aus New York stammt und den selben hohen Idealen anhängt wie sie. Zunächst genießen die beiden im Land der Gleichen als Ausländer sogar einige Privilegien. Rasch jedoch geraten sie während der sogenannten „stalinistischen Säuberungen“ in die Mühlen der sowjetischen Bürokratie und schließlich gar in die Mordmaschinerie des Gulag. Als ihnen die Russen die amerikanischen Pässe entziehen, gelten sie auch für die US-Botschaft als Abtrünnige. Damit sind sie, wie alle Sowjetbürger der Stalinzeit, völlig rechtlos. Seine Begeisterung für das Sowjetsystem, die am Ende immer mehr von ihrer Naivität einbüßt, bezahlt Florenceʹ Ehemann Leon dann auch mit dem Leben.
In Florenceʹ Lebenslauf wird das Schicksal ihres 1943 geborenen Sohnes Julian verwoben, der wiederum als Ich-Erzähler auftritt und nun, im Jahre 2008, seinen Sohn Lenny in Moskau besucht, wo dieser als Unternehmensberater in dubiose Geldgeschäfte verwickelt ist. Julian hat Ende der siebziger Jahre in einer Phase der internationalen Entspannung der Sowjetunion, wo er einen wachsenden Antisemitismus zu spüren bekam, den Rücken gekehrt und ist gemeinsam mit seiner Familie und seiner Mutter, die sich lange dagegen gesträubt hat, in die USA ausgewandert. Als quasi heimgekehrter Amerikaner weiß er jetzt seine Russlandkenntnisse zu nutzen, um mit den postsowjetischen Oligarchen in den Öl-Handel einzutreten. Gleichzeitig gelingt es ihm, über seine internen Kontakte die Akten seiner Mutter zu sichten, die eine Zeit lang als Spitzel für den Geheimdienst gearbeitet und im Dienste der idealen Sache auch Freunde und Freundinnen denunziert hat. So entsteht ein bewegendes und anfangs nicht leicht zu durchschauendes Kaleidoskop aus mehreren Erzählsträngen, Rückblicken, historischen Diskursen.
Das alles verbindende Thema ist allerdings der Totalitarismus, seine Heilserwartungen und vor allem seine Unterdrückungsmechanismen, die man sich nicht oft genug vor Augen führen kann. Zunächst fühlt sich Florence aufgehoben in einer großen Gemeinschaft, der sie ihre Individualität unterordnet. An dieser Entscheidung hält sie fest, selbst als ihr klar wird, dass sich alle Versprechungen längst in ihr Gegenteil gekehrt haben, dass die klassenlose Gesellschaft eine neue und brutale Hierarchie hervorruft mit einem alles durchdringenden Überwachungsstaat, der allgemeines Misstrauen sät und miserable Lebensumstände produziert. Sie will nicht wahrhaben, dass der Terror des Geheimdienstes NKWD keineswegs der Rechtspflege und der Wahrheitsfindung dient, sondern allein dem Machterhalt von Gangstern, die sich, der paranoiden Staatslogik folgend, ständig und von allen Seiten bedroht fühlen. Den Absurditäten des Alltags und der permanenten Verfolgung begegnet sie mit einem unerschütterlichen Idealismus. Denn die unübersehbaren Opfer der sozialen Utopie, so rechtfertigt sie ihr Beharren, dürfen nicht umsonst gewesen sein. Krasikov illustriert in ihrem Familienepos gleichsam das Diktum, das Rüdiger Safranski an anderer Stelle über Friedrich Schillers Dramenfigur Marquis de Posa formulierte:„Die revolutionäre Moral verrät im Einzelfall, was sie für die Gesamtheit zu erstreben beansprucht: die Freiheit. Einerseits fordert sie, dass der Mensch sich selbst zum Zweck werde, andererseits macht sie ihn zum Mittel ihrer Kalküle.“ Florence‘ Tod wird nur beiläufig erwähnt. Ihre Welt endet ohne Trost. Vielmehr pflanzt sich ihr naives Wunschdenken in den Generationen fort.
Denn Korruption und Beamtenwillkür, diesmal in Vladimir Putins Reich, lernt auch ihr Sohn Julian kennen. Anders als seine Mutter, die ja am Fortschritt mitwirken wollte, glaubt Julian wenigstens an gute Geschäfte, bis auch er erlebt, dass er nur ein Spielball mächtiger Interessen ist. Im Hinblick auf diese Erfahrungen wirkt der amerikanische Originaltitel The Patriots wie ein sarkastischer Kommentar.
Während Alexander Solschenizyn oder Lew Kopelev die inneren Widersprüche des Sowjetsystems eindrucksvoll an Fakten dokumentiert haben, steht Krasikov eher in der Nachfolge Boris Pasternaks. Sie vertraut den Mitteln eines atmosphärisch dichten Erzählens, nutzt diese allerdings, wie schon das eingangs angeführte Zitat belegt, oft etwas zu nachdrücklich. Dem 800-Seiten-Opus hätten einige Verschlankungen nicht geschadet. Unklar bleibt überdies, was eigentlich die jüdische Identität der amerikanischen Kommunisten ausmacht, die sie bisweilen mit Emphase thematisieren, ohne allerdings religiösen Ritualen anzuhängen. Gleichwohl zeichnet der Roman, auch Dank der geschmeidigen Übersetzung, ein mitreißendes und facetten- und figurenreiches Familienportrait und liefert damit einen Beitrag über die Wege und Irrwege der Weltgeschichte bis in die Gegenwart.
|
||